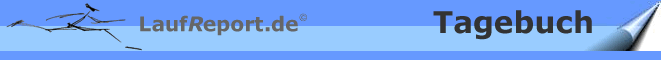

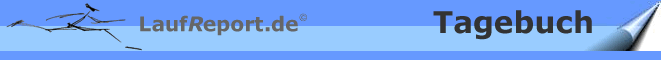  |
|
Laufen, Schauen, Denken Sonntags Tagebuch |
 |
Der Frühling ist ausgeschildert. Erstmals habe ich im Körschtal, unweit jenes Baches, der in den Neckar fließt, ein Warnschild erblickt: Krötenwanderung. Eine weitere Tiergattung, der ich auf meiner Strecke begegnen könnte, ohne daß ich es wußte. Doch ich habe noch keine Kröten meinen Weg kreuzen sehen. Unweit der Straße ist ein Kiosk aufgestellt worden, er trägt das Schild: Lahrer Spargel. Doch noch wird dort keiner angeboten. Der Frühling wirft seine Schilder voraus.
Über dem traurigen Ereignis vom 11. März habe ich meine Tagebuch-Notizen über den Ärzte-Protest am selben Tage bis jetzt verschoben. Da ist der Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie mit einer Aktionskampagne „Gesundheitspolitik macht krank. Wehren und beschweren Sie sich!“ an die Öffentlichkeit gegangen. Ein Berufsverband hat die Interessen seiner Mitglieder im Blick. Insofern müßte man eine solche Aktion nicht weiter beachten. Doch in den Unterlagen habe ich Fakten gefunden, die uns nicht gleichgültig lassen sollten. Orthopäden sind wahrscheinlich unsere wichtigsten ärztlichen Partner. Mag jemand kerngesund sein und seinem Hausarzt vielleicht nur noch beim Marathon begegnen, – die Wahrscheinlichkeit ist hoch, irgendwann im Läuferleben einen Orthopäden konsultieren zu müssen. Eine Infektion heilt vielleicht auch ohne ärztlichen Beistand aus, aber Schmerzen im Knie oder an der Achillessehne treffen uns im Kern. Wenn wir dann noch laufen, – Laufen wird zur Qual. Wenn wir ein paar Tage lang nicht laufen, leiden wir. Der Orthopäde soll helfen, unseren vormaligen Gemütszustand wiederherzustellen, indem er uns von den Schmerzen erlöst und den Heilungsverlauf möglichst beschleunigt. Koste es, was es wolle. Wir sind ja krankenversichert. Der Orthopäde, dem wir zur Not die Füße küssen würden, wenn er uns hilft, kämpft um Honorare, die auch nur seine Kosten decken. Dabei hätten wir nicht einmal etwas dagegen, wenn ein erfolgreicher Orthopäde zum Millionär würde; ihm würden wir im Gegensatz zu Bankern der Chefetagen und anderen Drohnen der Gesellschaft einen gehobenen Lebensstandard gönnen. Er hätte ohnehin wenig Zeit dafür, ihn zu genießen.
Doch die Honorarreform, teilt der Berufsverband mit, habe die Kostenerstattung durch die Krankenkassen auf nur noch einen Bruchteil der Behandlungskosten reduziert. Ein niedergelassener Orthopäde oder Unfallchirurg erhalte im Bundesdurchschnitt pro Quartal und Patienten 32,01 Euro. Allein an Startgeldern im Quartal geben wir das Mehrfache davon aus. Je häufiger ein Patient behandelt werden muß – und gerade orthopädische Verletzungen sind langwierig –, desto geringer der Fallwert. „Besteht auf Grund der Schwere der Erkrankung des Patienten die Notwendigkeit, den durchschnittlichen Behandlungsumfang zu überschreiten, sinkt das Honorar des Arztes, also der Fallwert.“ Es kann doch nicht sein, meine ich, daß ein Arzt, der unsere Achillessehne abtastet, eine Diagnose stellt und wenigstens die Symptome lindert, dies um den Preis von ein paar Powergel-Riegeln tun soll. Und das nach langem Medizinstudium, womöglich unter Entbehrungen, nach Ausbeutung und Demütigung als Assistenzarzt und Berufsjahren spezialisierter Erfahrung.
Ich habe mich mangels Fachwissens nicht mit der Gesundheitsreform beschäftigt. Doch ich unterstelle, daß die Kritik berechtigt ist. Nach meiner Lebenserfahrung gehen politisch gesteuerte Reformen immer in die Hose, will sagen zu Lasten der Betroffenen. Die Rentenreform, die Steuerreform – wenn ein Politiker, der als finanzpolitisch kompetent gilt, die Steuererklärung auf die Größe eines Bierdeckels reduziert wissen wollte, zeigt das nur, wie weit er sich von der Realität entfernt hat. Selbst die wertneutrale Rechtschreibreform hat zu einem Chaos geführt; der Hauptzweck, das Niveau der orthographischen Kenntnis in der Schule anzuheben, ist, wie man an der Orthographie ausgebildeter Akademiker sehen kann, nicht erreicht worden. Nach allen Reformen, einschließlich der pädagogischen, der Ganzwort-Leselern-Methode und der Mengenlehre, wundert es unsereinen nicht, daß auch mit der Gesundheitsreform keiner glücklich ist. An warnenden Stimmen hat es nicht gefehlt. Was wir brauchten, wäre eine Staatsreform. Vielleicht auch eine Abgeordnetenreform – was soll man von einem Abgeordneten halten, der Kinderpornographie im Internet dadurch beikommen will, daß er ohne Abstimmung mit Fachleuten der Kriminalpolizei sie sich privat besorgt! Falschmünzerei bekämpft man ja wohl auch nicht dadurch, daß man erst mal selber Falschgeld druckt. Wir brauchen mehr gesunden Menschenverstand in der Politik.
Den Orthopäden geht es bei ihrer Initiative nicht allein um Honorare. Sie fordern mehr Prävention. In einem Statement zum Thema Anpassung von Behandlungsstrukturen an die veränderte demographische Entwicklung heißt es: „Problemzone und Korrekturansatz gleichermaßen ist die sitzende Gesellschaft: zu wenig Bewußtsein für körperliche Aktivität und Sport, insbesondere aber die mangelnde Erziehung unserer Kinder zur Bewegung. Kinder sitzen heute im Durchschnitt 8,5 Stunden täglich. Schulsport ist Mangelware, Sport vorwiegend eine Frage der Medien und des passiven Konsums. So kann kein Bewußtsein oder körperliches Bedürfnis für Bewegung entstehen. Mangelnde Anleitung in Sport und Spiel verhindern die Entwicklung motorischer, aber auch geistiger Fähigkeiten.“ Als ich das Laufen entdeckt hatte und Redakteur der „Stuttgarter Zeitung“ war, habe ich dem Sportressort eine wöchentliche Seite „Sport für Aktive“ vorgeschlagen. Ich Narr! Als ob es den Medien darum ginge, nach Goethes Faust „die Menschen zu bessern und zu bekehren“! Mit Publikumsmedien soll Geld verdient werden. Wenn Zeitungsverlage Volksläufe begründet oder sich in bestehende eingebracht haben, so nicht als Sponsoren, sondern um von dem öffentlichen Interesse, das wir inzwischen mit unseren Stadtläufen hervorgerufen haben, zu profitieren. Als wir noch Pioniere waren, wurden wir von den Medien ignoriert. Und so lange ist es ja auch noch nicht her, daß uns öffentlich vorgeworfen wurde, wir würden mit der Lauferei unsere Gelenke ruinieren. Und nun ermuntern uns die Orthopäden, uns doch bitte mehr zu bewegen.
Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, so kann ich mich nicht erinnern, daß einer von uns jemals über Rückenschmerzen geklagt hätte. Heute leiden 53 Prozent der Schüler an Rückenschmerzen und auch jeder Zweite über dreißig Jahre. Rückenschmerzen sind, wie der Berufsverband der Orthopäden mitteilt, der häufigste Grund für Frühberentungen.
Was will ich mit all dem sagen? Den Orthopäden weniger zu tun geben und sie dafür besser bezahlen!
Schwager Hans meinte gestern, die Erderwärmung habe uns voll im Griff. Verführt durch den Sonneneinfall auf der Terrasse, zog ich für die Trainingsrunde die dünne Hose des Regenanzugs an. Kaum war ich damit auf der Straße, fror ich. Also kehrte ich um und tauschte die dünne Hose gegen die wärmeren Tights. Wieder vor der Haustür merkte ich, daß auch die Jacke zu dünn war. Ich wechselte auch sie, setzte eine Mütze auf und zog die Handschuhe an. Der Winter hat sich nicht an den Frühlingsanfang gehalten.
Auf dem leichten Gefälle, das ich hinunter ging, kam mir ein Läufer entgegen. Er trug einen Hut. Auch Dr. Adolf Weidmann bewältigte die 100 Kilometer in Biel mit einem Hut, aber er ging sie. Jetzt aber habe ich den ersten Läufer mit einem Hut auf dem Kopf gesehen. Wahrscheinlich lief er noch nicht sehr lange. Als wir uns begegneten, sagte er: „Sie müssen laufen, so wie ich, dann werden Sie achtzig!“ Ich war so verdutzt, daß mir die Sprache wegblieb. Doch dann kamen mir zwei Erkenntnisse: Wer mit dem Laufen begonnen hat, ist offenbar so voller Entdeckerfreude, daß er sie auch anderen mitteilen will. Er fängt an, anderen gute Ratschläge zu geben. Das haben wir vor Jahrzehnten auch so gemacht. Schön wär’s ja, wenn man durch Laufen noch einmal achtzig werden könnte. Ich bin im dreiundachtzigsten Lebensjahr. Offenbar hatte der Mann mit Hut mich für einen rüstigen Siebziger gehalten, Na bitte, irgendwie scheint sich das biologische Alter auszudrücken, auch wenn das kalendarische Alter schon seine Spuren hinterlassen hat.
Am Samstag habe ich die Trauerfeier in Winnenden im Fernsehen verfolgt. Sie war bewegend. Sicher hilft die gemeinsame Trauer den Angehörigen und Freunden der Opfer. Doch sie bleibt ohne Folgen. Der Trauerprozeß nach der Bluttat von Erfurt hat weitere Bluttaten nicht verhindern können. Meine Forderung nach dem Verbot von Waffen in Privatbesitz ist radikal. Das Wort hat politisch einen schlechten Beigeschmack. Dabei kommt es von radix, der Wurzel. Ich bin radikal, weil ich zur Wurzel vordringen möchte.
Unangemeldete Kontrollen privater Waffenbesitzer zu fordern, ist purer Aktionismus. Im Rems-Murr-Kreis, zu dem Winnenden gehört, sind 1400 Waffenbesitzkarten ausgestellt. An 200 Arbeitstagen müßte ein Kontrolleur je sieben Besuche machen, wenn alle 1400 Waffenbesitzer einmal im Jahr kontrolliert werden sollten. Da die Kontrolle unangemeldet erfolgen soll, macht wahrscheinlich in der Hälfte der Fälle niemand auf, weil die Bewohner auf Arbeit oder verreist sind. Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, hat nichts Eiligeres zu tun gehabt, als die weitere Verschärfung des Waffenrechtes abzulehnen. Wahrscheinlich sorgt er sich um die Schützenvereine in seinem Lande.
Mir ist klar, daß meine radikale Forderung selbst jetzt nicht, noch nicht, durchzusetzen ist. Meine Vorstellung an dieser Stelle war, daß die Angehörigen der Opfer selbst aktiv werden. Genau das ist geschehen. Die Familien von fünf ermordeten Schülern haben sich in einem offenen Brief an den Bundespräsidenten, die Bundeskanzlerin und den baden-württembergischen Ministerpräsidenten gewandt. „Wir wollen, daß sich etwas ändert in dieser Gesellschaft, und wir wollen mithelfen, damit es kein zweites Winnenden mehr geben kann.“ Es folgen ganz konkrete Hinweise; sie müssen von Fachleuten diskutiert werden. Sie fordern aber auch: „Wir wollen weniger Gewalt im Fernsehen. ... Wenn wir es zulassen, daß unseren Mitbürgern weiterhin täglich Mord und Totschlag serviert werden, ist abzusehen, daß die Realität langsam, aber stetig dem Medienvorbild folgen wird.... Die Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche fernsehen, sollten generell gewaltfrei sein.“ Killerspiele sollten verboten werden. „Wir wollen mehr Jugendschutz im Internet,“ heißt es weiter. Wie das zu bewerkstelligen ist, muß erörtert werden; die Gesellschaft ist gefordert.
Die Familien von fünf ermordeten Schülern möchten, daß der Name des Amokläufers nicht genannt und seine Bilder nicht mehr gezeigt werden. Eine Heroisierung des Täters wäre sonst die Folge. Der offene Brief gipfelt in der Forderung: „Wir wollen wissen, an welchen Stellen unsere ethisch-moralischen Sicherungen versagt haben.“
Hoher Respekt vor den Menschen, die in der Trauer um rationale Verarbeitung bemüht sind, obwohl sie ihnen selbst nichts mehr nützen kann. Politik funktioniert nur, wenn man Politiker vor sich her treibt. Das ist hier geschehen. Es darf nicht sein, daß Schützenvereine und ein Sport mit Tötungsinstrumenten politisch höher bewertet werden als die mögliche Prävention, eine Prävention, die vielleicht auch Bluttaten in der Familie reduzieren könnten. Solche Bluttaten geschehen nicht selten im Affekt, manchmal ereignen sie sich nur deshalb, weil in einem bis dahin verbalen Streit eine Waffe greifbar ist. Schußwaffenbesitzer werden auf andere Möglichkeiten hinweisen, auf Messer und Äxte. Doch dazu muß der Täter gewöhnlich erst in die Küche oder in den Keller rennen. Die Pistole oder den Revolver trägt er bei sich, das Opfer hat nicht die geringste Chance.
Respekt auch vor 20 Waffenbesitzern im Rems-Murr-Kreis, die ihre Waffen und ihre Waffenbesitzkarten bei der Behörde abgegeben haben. Das sind zwar nur etwa 1,5 Prozent, aber sie haben durch ihren Verzicht ein Zeichen gesetzt. Dieser reale Ausdruck der Solidarität mit den Hinterbliebenen der Opfer berechtigt zu der Hoffnung, daß sich in der Gesellschaft vielleicht doch etwas ändert. Die Alternative beim Schutz vor Bluttaten in der Schule wäre sonst wie in den USA, dem Land des freien Waffenbesitzes, ein fürchterliches Scenario, die Durchleuchtung aller, die eine Schule betreten. Alle Aufwendungen, die jetzt für die sichere Aufbewahrung privater Waffen getroffen werden, und jeder Verlust an Umsatz im Waffenhandel dürften niedriger sein als jenes amerikanische System, das ja bestimmt nicht von der Waffen-Lobby finanziert wird. In jedem Schüler einen potentiellen Mörder zu sehen, den man aussortieren muß, wäre eine pädagogische Bankrotterklärung. Wie tief ist ein Land gesunken, das dies in Kauf nehmen muß! Versuchen wir’s weiterhin mit Vertrauen, aber verhindern wir den „induzierten Mord“. Diesen Begriff habe ich dem „induzierten Suizid“ nachgebildet. Man versteht darunter, daß sich ein depressiver, suizidgefährdeter Mensch spontan zur Selbsttötung entschließt, weil er eine Gelegenheit sieht, zum Beispiel ein Röhrchen mit Schlaftabletten im Bad. Da es einen „induzierten Selbstmord“ gibt, muß es bei Verhaltensgestörten auch einen „induzierten Mord“ geben, die Bluttat deshalb, weil erst die Erreichbarkeit einer Schußwaffe dazu veranlaßt. Die Dutzende von Psychologen, die sich jetzt um die Angehörigen der Opfer von Winnenden kümmern, sollten später ein Symposium darüber veranstalten. Wir müssen zu den Wurzeln vorstoßen.
Warum? Wie konnte es geschehen? Nach der Bluttat in Württemberg erheben sich wieder einmal dieselben Fragen. Journalisten versuchen, sie mit Informationsschnipseln zu beantworten, Politiker mit demonstrativen Bekundungen der Trauer. Auch die Ratlosigkeit in der Trauer darf nicht verhindern, daß weitergefragt wird, immer wieder. Nach der Bluttat von Erfurt ist das Waffenrecht verschärft worden. Damit ist eine mögliche Antwort gegeben worden, sie reicht nicht aus, sie hat nur beruhigt.
Schon der Begriff „Amoklauf“ oder „Amokschütze“ ist falsch. Ursprünglich hat man unter einem Amokläufer einen Täter im Blutrausch verstanden, und da der Begriff aus dem Malaiischen kommt, hat er etwas Mythisches gehabt. In Wikipedia habe ich gelesen, daß Amok entgegen dem späteren Sprachgebrauch im indonesischen Kulturkreis keine Einzeltat ist, sondern eine kriegerische Aktion, bei der einige wenige Krieger den Feind blindwütig attackieren, eine Aktion also, die von den Japanern in der erzwungenen Selbstaufopferung der Kamikaze-Flieger gegen Ende des zweiten Weltkriegs institutionalisiert worden ist. Dieser gesellschaftliche Hintergrund scheint mir wichtig zu sein – ohne Krieg gäbe es keinen Amok-Begriff! Ohne den Begriff Amok möglicherweise keine Nachahmungstäter.
Was in den Industrienationen als Amoklauf bezeichnet wird, wird mitnichten von völlig ausgerasteten Tätern begangen. Bei dem 17jährigen Amokschützen aus dem schwäbischen Landkreis Waiblingen entsprangen nach den Morden in der Realschule von Winnenden allenfalls die Anschlußtaten am Psychiatrischen Krankenhaus und im Autohaus in Wendlingen am Neckar einem Kontrollverlust. Wer – das gilt für alle Schußwaffentaten in Schulen – eine Waffe erwirbt, um zu töten, oder eine Waffe entwendet und mit dieser Waffe eine Schule betritt, handelt mit Vorsatz. Daran ändert auch der vorübergehende Verlust der Impulskontrolle, die „innere Leere“ während der Tat, nicht das geringste. Der sogenannte Amoklauf in Industrienationen ist kaltblütiger Mord, allenfalls ein erweiterter Suizid. Der Täter will sein Leben beenden oder nimmt zumindest sein eigenes Ende in Kauf, will aber noch andere „mitnehmen“. Ganz sicher sind viele terroristische Anschläge ideologisch motivierte erweiterte Suizide. Es ist auch nicht auszuschließen, daß mancher rätselhafte Begegnungsunfall im Straßenverkehr ein Suizid ist; der Suizidant will nicht allein sterben; seine „Aggressionsumkehr“, ein Merkmal des von Erwin Ringel geprägten präsuizidalen Syndroms, wendet sich in diesen Fällen nicht ausschließlich mehr gegen den zum Suizid Entschlossenen. Inzwischen ist Amok auch um den Begriff „Amokfahrt“ erweitert worden.
Im Falle des 17jährigen Tim K. wird untersucht werden, wie weit sich der Vater strafrechtlich schuldig gemacht hat. Ein Sportschütze, der ein Waffenlager im Haus hat, was für Sportschützen als ganz normal gilt, und offenbar eine Pistole sowie Munition nicht unter Verschluß hält, muß die Verantwortung für die Folgen übernehmen. Doch nun etwa eine strengere Überwachung von Sportschützen zu fordern, wäre zwar hilfreich für die Bewußtseinsschärfung, muß aber als Aktionismus anmuten, weil es das Problem nicht löst. Wer eine Bluttat begehen will, beschafft sich eine Waffe, möglicherweise sogar ganz legal.
Einzelne Maßnahmen, die jetzt gefordert werden, so wie sie nach Erfurt gefordert worden sind, dringen nicht zu den gesellschaftlichen Ursachen des Waffenmißbrauchs vor, der grundsätzlichen Akzeptanz von Mordwaffen. Ich fordere dazu auf, unser Verhältnis zu Waffen zu überdenken. Mein Standpunkt ist der eines entschiedenen Pazifisten. Ich bin es spätestens im Mai 1945 in einem verschlossenen Güterwaggon mit Stacheldraht vor der Luke geworden. In diesem mit 50 Soldaten vollgepferchten Waggon eines sowjetischen Gefangenentransportes waren wir alle Pazifisten; ich bin es geblieben. Als ich im September 1945 nach Hause kam – die meisten anderen aus dem Waggon waren wahrscheinlich in Sibirien –, fand ich es ganz in Ordnung, daß jeglicher Waffenbesitz streng geahndet war. Wer irgendwo eine Armeepistole versteckt hatte, spielte mit seinem Leben. Schützenvereine – mein Großvater war geachtetes Mitglied in einem solchen gewesen – waren verboten. Hat irgend jemand sie vermißt?
Das Volk der zwangsläufigen Pazifisten wurde von den Besatzungsmächten selbst umgepolt. Mit der Wiederbewaffnung durch Adenauer und seine Helfer, zu denen auch die katholische Kirche zählte (Karlheinz Deschner), einerseits und die kommunistische These vom „gerechten Krieg“ andererseits durften Deutsche wieder Waffen erwerben und sich in Schützenvereinen organisieren. In der DDR geschah dies unter stringenter Kontrolle; der Privatbesitz von Waffen blieb verboten, übrigens auch in ganz Berlin bis zum Jahr 1991. Hat dies irgend jemand wirklich als Beschränkung der persönlichen Freiheit empfunden?
Die Situation heute: Die Zahl der legalisierten Waffen in Privatbesitz ist von null auf schätzungsweise 10 Millionen gestiegen. Man kennt die Zahl der Kraftfahrzeuge, die Zahl der ausgewiesenen Rechtsextremisten und die Zahl der Pferdehalter, aber man kennt nicht die exakte Zahl der legal verwahrten Schußwaffen in Privatbesitz. Wahrscheinlich spielt es auch keine Rolle, denn die Zahl der illegal beschafften Schußwaffen wird auf das Zweifache der Zahl legal erworbener Schußwaffen geschätzt. Wer bei Rot über die Kreuzung fährt, muß gewärtig sein, daß die Kreuzung überwacht und er bestraft wird, denn er könnte ja andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Zwanzig Millionen Schußwaffen, die irgendwo zwischen Flensburg und Konstanz frei flottieren, sind kein Grund, daß sich dieser Staat einen Kopf darüber macht.
Weshalb denn wird erst nach einer Bluttat wie in Erfurt, Emsdetten und Winnenden nach dem Warum gefragt? Weshalb fragt man nicht erst beim Täter, sondern bereits bei den Waffenliebhabern nach den psychischen Strukturen? Wie sind sie bei denjenigen beschaffen, die Waffen zu ihrem Hobby gemacht haben und im Umgang damit einen Sport sehen? Waffen wirken offenbar auf viele, gerade auch auf Kinder und Jugendliche, als ein Faszinosum. Doch niemand untersucht, weshalb es das ist. Psychologen wenden sich den Opfern zu, allenfalls den Tätern, aber nicht den Ursachen der Waffen-Liebhaberei. Diese Beschränkung der Forschung auf Symptome statt auf Ursachen kommt uns außerordentlich bekannt vor.
Tiefenpsychologisch müßte man heute bei Erich Fromms Nekrophilie und Alexander Mitscherlichs analer Fixierung ansetzen. Was könnte nekrophiler sein – nicht die Vergötterung der Technik, das Futuristische Manifest von Filippo Tommaso Marinetti, dessen kürzlich zum Hundert-Jahr-Jubiläum in den Feuilletons gedacht worden ist, die „Liebe“ zum Kraftfahrzeug, der Rausch der Geschwindigkeit, nicht die nekrophile Sprache, die Fromm rügt – was kann nekrophiler sein als der Schuß ins Schwarze? Der schwarze Punkt auf der Scheibe markiert den tödlichen Einschuß. Das in meinen Augen obszöne Faszinosum der Waffen wird durch die Medien verstärkt. Alle Welt diskutiert nur über Gewaltvideos. Doch man muß nur an den Schußwaffengebrauch im deutschen Fernsehen denken; von sex and crime überwiegt jede Woche bei weitem crime. In den Trailern zu den Folgen von Kriminalserien dominiert der Schußwaffengebrauch. Die Trailer werden zu Zeiten ausgestrahlt, an denen Kinder und Jugendliche vor dem Bildschirm sitzen. Auf diese Weise werden sie an die Waffe als Konfliktlösungsmodell gewöhnt.
Ich mag, schon wegen eigener früherer Aktivität, den Skilanglauf. Am Biathlon stört mich das Schießen. Doch das Fernsehen zeigt nicht Skilanglauf, sondern Biathlon, und vom Biathlon außer dem Zieleinlauf der Ersten ausschließlich das Schießen. Weshalb? Und wem wird das bewußt?
Man fragt deshalb nicht, weil sich nach den erzwungenen waffenfreien Jahren null eine Waffenkultur oder besser -unkultur ausgebreitet hat. Weil Waffen ein Faszinosum sind, hat sich ein Markt entwickelt; er reicht von der Waffenproduktion über den Waffenhandel bis zum Modebereich, zur Waffenmesse und zur Fachzeitschrift. Wer wollte ihn antasten? Die Zahl der Mitglieder in den deutschen Schützenvereinen ist von ursprünglich null auf 1,2 Millionen gestiegen. Das ist ein Drittel mehr als die Zahl der Mitglieder im Deutschen Leichtathletik-Verband. Mit Sicherheit gibt es mehr Schützenhäuser als Marathonstrecken. Wohl jeder von uns Läufern ist wahrscheinlich irgendwann einmal im Leben gefragt worden: Wovor lauft ihr eigentlich davon? Welchem Schießsportler hingegen ist die Frage gestellt worden: Auf wen zielst du, wenn du ins Schwarze zielst? Wen willst du eigentlich erschießen? Feuerwaffen sind das einzige Sportgerät, das von der Gebrauchsbestimmung her, ohne Reglementierung angewandt, den Tod anderer bezweckt. Sicher, das war der Speer auch, doch seine Gebrauchsbestimmung ist seit der Erfindung der Feuerwaffen derart sublimiert, daß niemand mehr auf den Gedanken kommt, einen Mord mit dem Speer auszuführen. Selbst Boxen als die aggressivste Sportart bezweckt nicht den Tod, sondern nur die temporäre Schädigung des Gegners. Dabei ist das schon schlimm genug, so daß erstmals mit den Queensberry-Regeln Schutzmaßnahmen getroffen worden sind. Erfurt ist vorübergegangen, Winnenden wird vorübergehen – der Markt muß bleiben. Tränen sind kein Wirtschaftsfaktor. Deutschland ist, habe ich gelesen, der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Waffen fallen auch in falsche Hände, sorry.
Schützenvereine und Schießsport haben bei uns eine Jahrhunderte alte Tradition, und sie hat für das Bürgertum sogar etwas Emanzipatorisches gehabt. Wenn es nur bei der Traditionspflege geblieben wäre, bei den Böllerschützen und musealen Waffenkammern! Doch insbesondere unter amerikanischem Einfluß hat sich ein Kult um Waffen gebildet. Das Recht, Waffen zu besitzen, gilt in den USA als bürgerliches Grundrecht. Es gibt sogar Orte, in denen die Bürger verpflichtet sind, Feuerwaffen zu besitzen. Angeblich will man damit die Kriminalität bekämpfen – mit einer legalisierten Selbstjustiz also. Etwa 30 Prozent der amerikanischen Haushalte haben mindestens eine Waffe, in Deutschland sind es etwa 10 Prozent.
Der pazifistische Standpunkt kann nur der sein, Deutschland zu einer im bürgerlichen Leben wieder schußwaffenfreien Zone zu machen und Waffen allein zur Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols und, wenn’s denn sein muß, zur Jagd zu verwenden. Im Gegensatz zu anderen Sportarten könnte der Schießsport virtuell ausgetragen werden. Im Hinblick auf das, was in zehn Jahren alles an Software programmiert worden ist – bis hin zu fiktiven Flugprogrammen –, müßte es auch gelingen, reale Waffen durch virtuelle zu ersetzen. Da brauchte man nicht einmal alle Killerspiele zu verbieten.
 |
Was so utopisch klingt, ist die einzige realistische Lösung des aus den USA importierten Problems. Der andere Weg, nämlich labile Menschen, Menschen mit psychischem Defizit, potentiell Straffällige herauszufiltern und sie von Waffen fern zu halten, kann nicht funktionieren. Jedes gesunde Kind durchlebt eine Phase von Omnipotenz; alles scheint möglich. Wahrscheinlich muß man das Gefühl erlebt haben, die Sterne vom Himmel holen zu können, um zum Beispiel eine hohe berufliche Motivation zu haben. In einer gesunden Entwicklung machen die Omnipotenzgefühle der frühen Kindheit der Realitätsorientierung Platz. Doch wie in jeder anderen Lebensphase kann es zu einer Fixierung kommen, einem Stillstand der Entwicklung. Gerade verwöhnte Kinder, die alles bekommen, was sie sich nur wünschen, können in der Phase der Allmachtsgefühle verharren. Durch die Helden von Action-Filmen werden sie konditioniert. Worin kann sich die eigene Omnipotenz stärker zeigen als darin, Herr über Leben und Tod zu sein? | |
|
Revolverfotos als Reklame für Fernsehgeräte.
Heuchelei der Gesellschaft: Obszöne Bilder vom Waffengebrauch veröffentlichen
und dann Tränen vergießen, wenn einer wirklich zur Waffe greift
|
Von Omnipotenz sind gerade Journalisten nicht frei; wir wissen alles besser. Doch wir haben unsere Allmachtsgefühle, aus denen heraus wir Politikern sagen, wo es lang zu gehen hat, sublimiert. Woran will man bei einem Jugendlichen oder Heranwachsenden erkennen, ob er seine Allmachtsphase geglückt bewältigt hat oder nicht? Gewiß brauchen wir Schulpsychologen; doch selbst wenn es an jeder Schule einen gäbe, – Tim K. wäre unentdeckt geblieben, abgesehen davon, daß kein Schulpsychologe seine Schule vor ehemaligen Schülern schützen kann. Schulen in Hochsicherheitstrakte zu verwandeln, wie das in den USA geschieht, wird unter pädagogischem Aspekt zu Recht abgelehnt. Wenn wir schon psychische Defizite, die um so folgenreicher sind, je größer die Kluft zwischen dem Gefühl der Omnipotenz und der Realität ständiger Kränkung ist, nicht oder nur in wenigen Fällen erkennen können, bleibt uns nichts anderes, als uns vor den möglichen Fehlhandlungen zu schützen. Entweder ganz konkret oder durch Prävention, durch ein gesellschaftliches Klima, in dem Normen der Gewaltlosigkeit in psychosozialen Konflikten gesetzt werden.
Im Hinblick auf umweltbedingte Schädigungen hat sich in den letzten Jahren ein ungeheurer Wandel des öffentlichen und des individuellen Bewußtseins vollzogen. Welcher Nichtraucher hätte noch vor zwanzig Jahren zu hoffen gewagt, daß Raucher zu einer Randgruppe werden würden und niemand mehr gezwungen ist, in öffentlichen Einrichtungen mitzurauchen? Wenn die Zeitzeugen von Bluttaten an Schulen und anderen Orten – es sind ihrer immer mehr geworden – ihre Trauer in politische Aktion zur Ächtung von Schußwaffen umsetzen könnten - mit Vorträgen, in Vereinsgründungen, in Publikationen -, würden sie viele Mitstreiter gewinnen, davon bin ich überzeugt. Die Politik müßte schließlich agieren; der immense Einfluß der Waffen- und Waffenbesitz-Lobby würde unter dem Druck der öffentlichen Meinung zurückgedrängt. Raucher, die noch immer rauchen, kann man nicht bestrafen. Doch diejenigen, die bei einem Schußwaffenverbot noch immer eine Feuerwaffe besitzen, kann man kriminalisieren. Die illegal geführten Waffen kann man unter Zusicherung der Straffreiheit einzuziehen versuchen. Straftäter, die eine Waffe besitzen, hätten eine Strafverschärfung zu gewärtigen. Zur Drogenkontrolle muß sich die Kontrolle auf Waffenimport gesellen. Warum bedarf es erst eines Weltkrieges, um die Bewohner eines Landes waffenfrei zu machen?
Politische Folgerungen sind sinnvoller, als etwa ein Schulgebäude deshalb abzureißen, weil in ihm eine Bluttat verübt worden ist. Der erste Schritt wäre, das Hobby Waffenbesitz und Waffengebrauch psychologisch zu durchleuchten und in der „Anatomie der menschlichen Destruktivität“ (Erich Fromm) seinen nekrophilen Charakter zu erkennen. Vielleicht wäre dann mancher „Waffennarr“ über sich selbst erschrocken. Der zweite Schritt wäre, auf die Ächtung der Waffen deren gesetzliches Verbot folgen zu lassen.
*
Ich widme diesen Text einem unbekannten polnischen Partisanen, der im Februar
1945 in den Beskiden seine Pistole auf mich richtete, zielte und nicht abdrückte.
Leute, lauft – gönnt euch was! Nichts ist mehr sicher, nicht der Arbeitsplatz und nicht die Ersparnisse, nicht das Haus und nicht die Rente. Nur was ihr erlauft, kann man euch nicht nehmen.
Wahrscheinlich denken viele Menschen ähnlich, leben im Hier und Jetzt, auch wenn sie nicht laufen. Sie leben so, wie sie bisher gelebt haben, schaffen sich jedoch jetzt schon an, was sie sonst vielleicht noch aufgeschoben hätten. Die Abwrack-Prämie für das Auto, das es noch getan hätte, hat die Hemmschwelle beseitigt. Wenn, warum nicht jetzt? Und wenn schon das nächste Auto vorfristig gekauft wird, warum dann nicht erst recht andere Dinge? So erklärt sich vermutlich, daß die Krise noch nicht auf den Konsumgütermarkt durchgeschlagen ist. Doch ich bin davon überzeugt, daß sie uns auch im täglichen Leben noch ereilen wird. Das Geld, mit dem der stotternde Motor der Finanzwirtschaft und „systemrelevanter“ Branchen am Laufen gehalten wird, ist unser Geld. Da wir es nicht mehr in der Tasche hatten, sondern an den Staat abgeführt haben, merken wir es nur noch nicht. Der Staat wird es uns merken lassen.
Mit den Banken ist viel mehr zusammengekracht als nur Unternehmungen, die man wieder aufpäppeln könnte. Eine ganze Ideologie ist zusammengebrochen, im Prinzip nicht anders als vor zwanzig Jahren der Sozialismus als Gegenentwurf zum Kapitalismus, nur viel schlimmer, denn es existiert jetzt kein Gegenentwurf mehr. Die Sozialisten der insolventen DDR sind vor fast zwanzig Jahren sehr rasch auf den Zug des Kapitalismus aufgesprungen. Doch der ist nun entgleist, wir sitzen irgendwo fest, niemand holt uns ab. Ehe wir uns selbst auf die Füße machen, müssen wir wissen, wohin wir wollen. Zurück geht’s wohl nicht mehr, das glauben wahrscheinlich nur ein paar langjährig verblendete Börsenzocker. Für den Weiterweg müssen wir uns von ideologischen Fixierungen der Vergangenheit befreien, voran von dem Kartenhaus der Globalisierung. Versteht man unter Globalisierung insbesondere die internationale wirtschaftliche Verflechtung, so hat sie sich als Falle erwiesen.
Die Hungernden in Afrika haben es zuerst zu spüren bekommen. Doch es hat uns nicht weiter bekümmert; erst als hier die Falle zuschnappte, haben es die Manager gemerkt, und zwar reichlich spät. Jürgen Schrempp konstruierte auf dem Papier einen Weltkonzern, obwohl andere Firmen sich bereits bei Aufkäufen die Finger eingeklemmt hatten. Es kam, wie es kommen mußte, Daimlers Fusion mit Chrysler offenbarte sich als Faß ohne Boden. Jeder Kleinaktionär war mißtrauischer gewesen als die Manager. Es ging nicht anders, als das Faß mit einem Fußtritt von sich zu schleudern. Ein paar Milliarden waren noch im Faß. Die Deutsche Post hat ihr verlustreiches Amerika-Geschäft aufgegeben – was hatte sie in den USA zu suchen, als ob es dort nicht auch tüchtige Paketausträger gegeben hätte! Die Allianz, deren Aktien einst zu den teuersten gehörten, hat sich von der Dresdner Bank getrennt. Und dem neuen Käufer, der Commerzbank, liegt sie wie ein Stein im Magen. Man muß nicht alles kaufen, was billig zu haben ist.
Welches heuchlerische Jammern, als Nokia sein deutsches Mobilphone-Werk schloß! Der Konzern hat doch nur das Gesetz der Globalisierung angewandt! Immer haben „globalisierende“ Eigentümer deutsche Unternehmen in den Abgrund gerissen: Im Januar 2009 die irische Mutter Waterford Wedgwood den traditionsreichen Porzellan-Hersteller Rosenthal. Das geht ja seit Jahren so. Der Nähmaschinenhersteller Pfaff, auch er ein Traditionsbetrieb, war 1999 von einem italienischen Unternehmen übernommen worden, dann von einer Investmentgesellschaft. Im September 2008 wurde der Insolvenzantrag gestellt.
Die Globalisierungsfalle bei Opel: Der Betrieb ist nur dann zu retten, wenn er sich von General Motors löst. Doch im dortigen Tresor liegen die deutschen Opel-Patente! Vielleicht liegen sie auch gar nicht mehr dort, sondern sind zu Geld gemacht. In meiner Nachbarschaft kämpft der renommierte Modellbahn-Hersteller Märklin ums Überleben. Über seinen Besitzer, einen britischen Konzern, ist geklagt worden, es habe ihm das Herzblut für Märklin gefehlt. Das fehlt überall, wo globalisiert worden ist. Was haben nordamerikanische Investoren mit deutschen Verkehrsbetrieben, Wasserwerken, Kläranlagen und Müllentsorgern schon im Sinn? Die beiden großen Wasserversorger in Baden-Württemberg haben Mitte Februar das Cross-Border-Leasing mit dem US-Investor Wachovia beendet – auf den Schrecken ohne Ende nun ein Ende mit Schrecken, nämlich ein Freikauf mit riesigen Verlusten. Das Wasser aus den Hähnen der Landeswasserversorgung und der Bodensee-Wasserversorgung wird daher teurer werden müssen. Ohne die Globalisierungs-Ideologie wären vernünftige Menschen, so es sie in den Rathäusern noch gegeben hat, niemals auf die Idee des Cross-Border-Leasings gekommen. Laut „Spiegel“ haben deutsche Kommunen Leasing-Verträge im Wert zwischen 30 und 80 Milliarden Euro geschlossen. Häufig spielte die amerikanische Versicherungsgesellschaft AIG dabei die zentrale Rolle; sie gab bei den Leasing-Geschäften Garantien für die Investoren. Nun ist der Versicherungsgigant allein durch 150 Milliarden Dollar des Staates vor dem Zusammenbruch gerettet worden. Die amerikanischen Investoren sind angesichts dessen bereit, Verträge wie mit den baden-württembergischen Wasserversorgungsgesellschaften vorzeitig zu beenden; aber sie ziehen die Daumenschrauben an. Lieber gestehen jetzt die Kämmerer, daß sie Mist gebaut haben, als weiter das Damokles-Schwert über der Kasse zu haben. Der Hauptmann von Köpenick, der in der Uniform vom Trödler die Stadtkasse beschlagnahmen ließ, war ein Pfuscher gegen die Investoren von Köpenick.
Ohne den Globalisierungswahn in den Vorstandsetagen der Banken hätte es beim Umkippen amerikanischer Banken nicht diesen Domino-Effekt gegeben. Die relativ kleinen Genossenschaftsbanken, die sich auf ihr regionales Geschäft beschränkt haben, kommen wohlfeil durch die Krise. Bei den Autos sind wir nun wohl so weit: Small is beautiful. Warum nicht auch wieder in der Wirtschaft? Wobei ordentliche Mittelstandsbetriebe mit 500 Beschäftigten so small auch wieder nicht sind. Aufkäufe wie der von Continental durch Schaeffler erweisen sich als real nicht finanzierbar.
Zu den Kollegen Wirtschaftsredakteuren habe ich in meinem Berufsleben aufgeblickt. Sie blickten durch, habe ich mir gedacht. Nachdenklich wurde ich Anfang der siebziger Jahre, als einer auf die laienhafte Bemerkung, mit dem Wirtschaftswachstum könne das doch so nicht weitergehen, erwiderte: Es muß, anders funktioniert es nicht. Nun maße ich mir an, über Wirtschaftsfragen zu schreiben, und ich habe nicht das mindeste schlechte Gewissen dabei. Gesunder Menschenverstand ist allemal mehr wert als die Fach-Idiotie von Spezialisten, deren Kompetenz offenbar nur in der Beherrschung einer Geheimsprache besteht.
*
Die Eintragung wäre abzuschließen. Doch während dessen habe ich als Mitglied
des GutsMuths-Rennsteiglauf-Vereins das Protokoll der Jahresversammlung vom
Dezember übermittelt bekommen. Erst durch das ehrende Gedenken an die im vorigen
Jahr verstorbenen Mitglieder habe ich erfahren, daß Wilfried Flöter aus Erlangen
nicht mehr lebt. Ein Sportfreund, der zu den Stillen im Lande zählte. Wenigstens
an dieser Stelle soll ihm ein Denkmal gesetzt werden, denn in die Annalen mit
Bestleistungen ist er nicht eingegangen. Aber er war einer der treuesten Altersläufer,
die ich kenne. Bei großen Läufen, am Rennsteig, in Biel, beim Schwäbische-Alb-Marathon,
sind wir uns begegnet. An ihm habe ich mich orientieren können. Wenn er startete,
war ich meistens nicht der Letzte. Wenn er vor mir war, lautete die Frage: Würde
ich noch zu ihm aufschließen können? Im Jahr 2006 verbesserte er sich auf den
Bieler 100 Kilometern auf 17:36:57 Stunden, im Jahr 2007 war er mit 19:10:28
Stunden der Zweite in M 75, und er war im selben Jahr unter den 154 Teilnehmern
des Europa-Cups der Ultramarathone der einzige in M 75. Auch an zahlreichen
anderen Läufen hat er teilgenommen, unter anderem im Jahr 2007 am Kyffhäuser-Berglauf.
Maximale Leistungen hat er nicht angestrebt; dazu hielt er seinen Trainingsumfang
für zu gering. Denn der Diplom-Ingenieur Flöter, obwohl im sogenannten Ruhestand,
war beruflich noch stark engagiert. Er bleibt ein Vorbild für diejenigen –
das ist die Mehrzahl –, die realistischerweise keine andere Wettkampf-Ambition
haben als die Teilnahme. Eine mentale Qualität, die sich in Ergebnislisten nicht
widerspiegelt.
Für eine Läufer-Biographie wäre wünschenswert, was ihm widerfahren ist: drei Monate vor seinem Tod noch im Wettkampf zu laufen. Doch der Tod – die Umstände kenne ich nicht – ist viel zu früh eingetreten; Wilfried Flöter, geboren am 26. Januar 1932, ist zwei Tage vor seinem 76. Geburtstag gestorben. Unter denjenigen, denen ich den erfolgreichen Eintritt in die Altersklasse M 80 prognostiziert hätte, wäre er unbedingt gewesen. Auch wenn unsere Begegnungen eher flüchtig waren, jedesmal ein kurzes Gespräch oder die Autobusfahrt von Schmiedefeld zurück nach Eisenach, – er wird mir fehlen.
Ich müßte den Vorfrühling besingen. Vor kurzem noch mußte ich über Miniatur-Eisgebirge eiern und mir danach nasse Füße holen. Am Wochenende habe ich die Winter-Tights in die Wäsche gegeben, mir die dünne Windjacke angezogen und die dünnen Handschuhe, und selbst diese brauchte ich nicht mehr. Erstmals wieder habe ich einen Läufer in kurzen Hosen gesehen. Überhaupt sind wieder viel mehr Läufer unterwegs als vor vierzehn Tagen. Ich probiere es mit dem Laufen, in 50- bis 100-Meter-Abschnitten. Ich weiß, ich werde es nicht mehr schaffen, meine Trainingsstrecke von 11 Kilometern zügig durchzulaufen. Mein Ehrgeiz muß sich darauf beschränken, die Laufpassagen allmählich zu verlängern.
Auf den Feldern wird gearbeitet. Der Imker hat nach den Bienen geschaut. Kaum daß der Schnee weg ist, kommen schon die Schneeglöckchen. Ich müßte, wie gesagt, den Vorfrühling besingen. Doch mir geht so viel anderes im Kopf herum.
Ein Tagebuch ist zwar kein Monatsbuch, aber Dietrich hat mir jetzt seine Empörung über ein Vorkommnis vor über vier Wochen mitgeteilt, das mir nicht bekannt war. Wenn ich nicht nur die lokale Zeitung läse, hätte ich erfahren können, was sich vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos abgespielt hat. Die Graubündner Kantonalpolizei hat aus einem Schaufenster an der Promenade die tibetische Flagge entfernen lassen. Ursprünglich sollten auch die ausgestellten Bücher des Dalai Lama sowie tibetische Gebetsbücher verschwinden. Die Polizei hatte die Beschlagnahme angedroht, falls sich die Geschäftsinhaberin, Margrit Merz, der Weisung widersetzt hätte. Auf Intervention der Inhaberin, einer Sympathisantin der tibetischen Menschenrechtsbewegung, durften die Bücher wieder ausgestellt werden. Der Grund der behördlichen Maßnahme war klar: Der chinesische Premierminister Wen Jiabao, der über die Promenade, die Hauptgeschäftsstraße, bummeln wollte, sollte nicht durch den Anblick der tibetischen Fahne mißgestimmt werden. Die Polizeiaktion hat bei den Schweizer Bürgern beträchtliche Entrüstung hervorgerufen.
Dietrich hat befürchtet, auch Läufer, die sich vielleicht demonstrativ zur Freiheit Tibets bekennten, könnten eines Tages Schwierigkeiten bekommen. In diesem Falle müsse man Davos boykottieren.
Der Gedanke, Laufveranstaltungen könnten in die Fänge der Politik geraten, ist nicht aus der Luft gegriffen. Beim Marathon in der Universitätsstadt Freiburg im Breisgau waren im vorigen Jahr zahlreiche Häuser an dem durch die Innenstadt führenden Kurs mit tibetischen Fahnen geschmückt. Fahnenträger standen am Straßenrand. Einer von ihnen gesellte sich zu mir und fragte, ob er ein Stück mitlaufen dürfe. Das war korrekt. Vielleicht gibt es nun ein Bild, das mich neben der tibetischen Fahne zeigt. Das wäre auch in Ordnung. Mir ist durchaus bekannt, daß Tibet vor der chinesischen Annexion kein Musterland der Demokratie war und die Fahne erst 1947 geschaffen und vom 14. Dalai Lama als Armeefahne bezeichnet worden ist. Erst die Exiltibeter haben sie zur Nationalflagge gemacht. Doch auch ein rückständiges Land darf man nicht annektieren. Bereits Mitte der sechziger Jahre, als ich dem Dalai Lama persönlich begegnet bin, gewann ich den Eindruck, er sei alles andere als ein Scharfmacher. Demonstrationen für die kulturelle Autonomie Tibets und die Menschenrechte sind legitim. Die Behörden in Davos haben eine Demonstration von Tibetern während des Weltwirtschaftsforums genehmigt; allerdings war sie auf die Fläche vor dem Bahnhof Davos-Platz beschränkt worden. Damit ist auch die Entfernung der Flagge begründet worden, nämlich damit, daß Demonstrationen anderwärts nicht gestattet seien. Als eine solche ist das Zeigen der Flagge in einem Schaufenster gewertet worden – eine juristisch merkwürdige Begründung.
Die Entfernung der tibetischen Fahne anzuordnen, halte ich für puren Opportunismus. Er ist nicht nur in Graubünden zu suchen. Die kantonale Polizei sah sich vor das Problem gestellt, auf Anweisung aus Bern einen Eklat zu unterbinden. Doch der Bündner Legislative ist nun auch nicht wohl; die Justizdirektorin Barbara Janom Steiner hat sich wenige Tage später bei der Davoser Ladenbesitzerin für die „Umtriebe“ entschuldigt. Laut „Neuer Züricher Zeitung“ könne sie jedoch in Anbetracht der Umstände der Polizei keinen Vorwurf machen. Die rechtliche Würdigung sei schwierig. Also eine windelweiche Reaktion auf den emotionalen Aufruhr.
Mag sein, daß sich mancher Läufer fragt, ob er dort laufen soll, wo das Wohlgefallen eines diktatorischen Machthabers wichtiger ist als das Bürgerrecht auf freie Meinungsäußerung. Grundsätzlich muß ein Boykott erlaubt sein, auch der Boykott einer Wahl – insofern ist die Ableitung, daß das Wahlrecht auch eine Wahlpflicht enthalte, irrig. Auch mit einer Enthaltung kann man seine Meinung ausdrücken. Hätten nur die Nationen 1936, als längst die Repressalien gegen die deutschen Juden begonnen hatten, die Olympischen Spiele in Berlin boykottiert! Doch wenn schon alle bei den Olympischen Spielen in China mitgemacht haben, wäre es bei weitem überzogen, Volksläufe zu boykottieren, wenn sie in politisch mißliebigen Ländern stattfinden.
Daher sehe ich nicht, daß nun, auch wenn Davos ins Gerede gekommen ist, auf den Swiss Alpine ein Schatten fallen könnte. Laufveranstalter sind glücklicherweise nicht für den Opportunismus ihrer Regierung verantwortlich und auch nicht für behördliche Mißgriffe am Veranstaltungsort.
Allerdings erinnert der opportunistische Akt in Davos an viel Schlimmeres. Davos war eine Insel der Nazis in der angeblich neutralen Schweiz. Hier lebte Wilhelm Gustloff, ein Mecklenburger, der 1917 nach Davos gekommen war, um seine Lungenerkrankung zu kurieren, hier blieb und für die Nazis aktiv war, bis ihn 1936 der jüdische Student David Frankfurter erschoß. Nicht nur das Großbürgertum hatte vor dem Ersten Weltkrieg die Sanatorien gefüllt, es kamen in den zwanziger Jahren Intellektuelle und in den dreißiger und vierziger Jahren vor allem Nazis. Sie kamen wohl nicht in der Absicht, die Schweiz zu unterwandern, sondern um sich und ihre Kinder im Lungenkurort Davos therapieren zu lassen. Später, nach Beginn des Luftkriegs über Deutschland, schickten höhere Nazi-Führer ihre Kinder nach Davos, um sie in Sicherheit zu bringen. Es gab in Davos eine deutsche Schule, das Fridericianum. In jener Zeit lebten ständig etwa 1500 Deutsche in Davos, die überwiegend in den von Deutschen frequentierten Einrichtungen tätig waren. Das waren nicht alles Nazis, aber sie standen unter Anpassungsdruck. Der deutsche Diplomat Hans Sigismund Freiherr von Bibra hatte die Nachfolge Gustloffs angetreten und betrieb unter dem Schutz seiner Immunität Propaganda für die NSDAP, die in Davos eine eigene Ortsgruppe unterhielt. Deutsche, die sich in Davos dem Anpassungsdruck widersetzt hätten, mußten mit Denunziation im „Reich“ rechnen. Üblich war bei Begegnungen auf der Straße der Hitlergruß, und in Davos wehten Hakenkreuzfahnen. Erst als sich gegen Ende des Krieges auch amerikanische Soldaten zur Rehabilitation in Davos aufhielten, kam es zu Protesten, die zur Entfernung der Hakenkreuze führten.
Man sieht, das „Hitlerbad“, wie die Opfer der Nazifizierung Davos nannten, hat ziemlich Dreck am Stecken. Die Fortsetzung des Romans „Der Zauberberg“ von Thomas Mann, dessen Tochter Erika mit dem Kabarett „Pfeffermühle“ in Davos aus Rücksicht auf die Nazis nicht gastieren durfte, harrt noch des Autors, den Titel hätten wir: „Der Faule-Zauber-Berg“. Vielleicht wird ja auch eine Trilogie daraus, der Stoff ist mit der Anti-Tibet-Aktion und der ebenso opportunistischen Entschuldigung gerade entwickelt worden.
Die Entfernung der tibetischen Fahne aus einem Schaufenster zeigt, daß Politiker nur sehr begrenzt aus der Geschichte lernen. Fest steht, daß die Androhung der Flaggen-Beschlagnahme den Ruf der Kurstadt nicht verbessert hat. Macht nichts, Hauptsache, die Chinesen kommen. Die tibetischen Emigranten dagegen sind so lästig, wie Emigranten ohne Schweizer Konto immer gewesen sind.
Wer seit zehn Jahren fleißig läuft, hat – so will es die Industrie – etwa zwei Dutzend Paar Laufschuhe verschlissen. Die sehen äußerlich noch ganz passabel aus, also werden sie aufgehoben. Man wird sie zur Gartenarbeit anziehen. Alle 20 oder 30 Paar?
Vor zwanzig oder dreißig Jahren war die Entsorgung noch ganz einfach. Ich nahm jeweils einige Paar mit zu einem Start im Ostblock und ließ sie dann in der Umkleide-Garderobe stehen. Damit es nicht so aussah, als ob ich sie vergessen hätte, und die Gastgeber womöglich alle Hebel in Bewegung setzten, sie dem Verlierer zurückzugeben, legte ich einen Zettel dazu: „Gift“ und die Schuhgröße. Wer mochte, konnte die Wahrheit herauslesen: Gift für meine Füße. Ob ich mich nicht geschämt habe, Abgelegtes zu verschenken? Wer nach dem Krieg einen umgefärbten Mantel der deutschen Wehrmacht getragen hat und dankbar für Abgelegtes war, schämt sich nicht, Abgelegtes zu verschenken. Verschiedentlich ist auch der Versuch unternommen worden, den Versand gebrauchter Laufschuhe nach Osteuropa zu institutionalisieren. Als in einer Laufzeitschrift eine Kontaktadresse in Rumänien genannt worden war, machte auch ich ein Paket mit Läuferklamotten fertig. Das Porto dafür wurmte mich – noch mehr aber, daß das Paket seinen Empfänger wahrscheinlich nie erreicht hat. Heute kann man sich wahrscheinlich nur blamieren, wenn man bei einem Start in Polen oder Tschechien ausgediente Laufschuhe hinterließe. Da sollte es schon ein Kleinwagen sein.
Einige Paar Schuhe habe ich so lange aufgehoben, bis sie museumsreif waren. Das ist wörtlich zu nehmen. Meine Brütting Lydiard stehen im Sportmuseum zu Berlin. In depressiven Phasen stelle ich mir gern vor, man werde sie vergolden und meinen Namen einritzen – die Vorstellung hilft dem Selbstgefühl auf die Sprünge. Ein Paar Nike, das ich mir 1978 in New York gekauft und binnen kurzem schiefgetrampelt hatte, habe ich Carl-Jürgen Diem geschickt – als Demonstrationsobjekt für den von ihm gegeißelten Unfug zu weicher Schuhe.
Manchmal stellt eine Altwaren-Firma einen Plastic-Eimer vor die Tür, in den man abgelegte Schuhe tun kann. Es kostet mich immer Überwindung, darin ein Paar zu entsorgen. Man könnte die Schuhe vielleicht doch noch....
Doch nun atme ich auf. Genau genommen, seit dem 14. Dezember 2008. Das ist der Tag, an dem sich der irakische Journalist Muntazer al-Zaidi in einer Pressekonferenz mit George W. Bush (W. steht für Walker!) seiner Schuhe entledigte und sie in die Richtung des mächtigsten Staatsoberhauptes schleuderte. Nun bin ich freilich Pazifist und verabscheue Gewalt. Doch das hier war symbolische Gewalt. Einem Ei konnte Bundeskanzler Kohl nicht ausweichen, auch der spätere Außenminister Fischer einem Farbbeutel nicht. Doch einen Schuh, so er einen nicht am Hintern trifft, sieht man kommen. Bush duckte sich. Fertig. Ein Schuh schrieb Geschichte – wieder einmal.
Nach dem Abschuß eines US-Spionageflugzeugs über sowjetischem Boden im Mai 1960 versuchte Nikita Chruschtschow auf der 15. Generalversammlung der UNO-Vollversammlung, eine Debatte darüber zu entfesseln. Was ihm offenbar nicht gelang, da mußten stärkere Argumente her, zum Beispiel ein Schuh, mit dem er auf das Pult einhämmerte. Sowjetische Führungskreise sollen betroffen gewesen sein. Zu Unrecht. Was weiß der einfache Mann noch von Chruschtschow? Das mit dem Schuh.
Schuhwerfen ist keineswegs ein so spontaner Akt, wie es den Anschein hat. Erst nach dem denkwürdigen Akt der Schuhwürfe gegen Bush entdeckte ich – dank Wikipedia, die nun dem geliebten Brockhaus endgültig den Garaus macht –, daß es sich beim Schuhwerfen um einen überlieferten Brauch handelt, nämlich eine Art Orakel, aus dem noch im 19. Jahrhundert Dienstleute herauszulesen glaubten, welche Zukunft sie bei ihrem Dienstherrn erwartete. Wer die Auskunft erheischte, schleuderte einen Schuh, in dem der Fuß nur noch zur Hälfte steckte, über sich hinweg. Je nachdem ob die Spitze oder die Ferse des Schuhs zur Tür zeigte, konnte der Fragende erkennen, ob er im selben Jahr bei seinem Dienstherrn wieder eine Anstellung bekam oder nicht.
Man sollte den Brauch wiederbeleben; die Dienstleute von Opel hätten gern gewußt, woran sie sind. Wenn sie das Schuhorakel auf dem Firmengelände mit abgetragenen Laufschuhen machten, wäre auch das private Entsorgungsproblem gelöst.
Einmal in der Historie des Schuhwerfens soll das Orakel tödlich ausgegangen sein. Es war nicht der Schuh – auch Laufschuhe können nur zu Blasen führen, aber sie töten nicht. Beim „unglücklichen Schuhwerfen zu Cossebaude“ – so im Sagenschatz des Königreichs Sachsen verzeichnet – trug eine Magd ein Brotmesser am Busen. Als sie sich beim Schuhwerfen bückte, stieß sie sich das Messer ins Herz. Man soll daher nie ein Brotmesser am Herz tragen und auch nicht, fügen wir hinzu, auf dem Fensterbrett liegenlassen, wenn man Polizeichef in Passau ist.
Leider, leider hat sich der Schuhwurf nicht in Aktionärsversammlungen durchsetzen können. Man stelle sich vor, ein Heer von Kleinaktionären hätte in den von Professor Dr. h. c. Jürgen Schrempp geleiteten Hauptversammlungen von DaimlerChrysler auf diese Weise seine Laufschuhe entsorgt! Sie wären einem wahrhaft nützlichen Zweck zugeführt worden. Vielleicht hätte ein Schuhtumult den verhängnisvollen Beschluß der Fusion mit dem notleidenden Unternehmen Chrysler in letzter Minute verhindern und damit einige Milliarden Euro retten können.
Die arabische Welt scheint da weiter zu sein als wir im Okzident. Wie wir nach dem Schuhwurf gegen den amerikanischen Präsidenten erfahren haben, gilt es unter Arabern als eine der schlimmsten Beschimpfungen, jemanden mit einem Schuh zu schlagen oder ihm die Schuhsohle zu zeigen. Der irakische Fernsehjournalist Al-Zaidi ließ zudem keinen Zweifel daran, wie der Schuhwurf gemeint war: „Das ist ein Abschiedskuß, du Hund! Dies ist von den Witwen und Waisen und allen, die im Irak getötet worden sind.“ Gegen den Journalisten ist der Prozeß wegen Angriffs auf ein Staatsoberhaupt eröffnet worden, die nächste Verhandlung findet im März statt. Mag er verurteilt werden oder nicht, ich bin überzeugt, viele Jahre später wird man ihm ein Denkmal errichten. Oder aber einen sportlichen Wettbewerb nach ihm benennen.
 |
 |
Einen Gummistiefelweitwurf-Verband gibt es in der Bundesrepublik bereits; ihm gehören Vereine an wie Gib Gummi 03, GuStiWeiWuFF, 1. GWV Rauen Latex 04, 7-Meilenstiefel e. V., TWG Schlabbeschubser, Gib Leder 04 oder Spitzsteingummi 05. Laßt uns die Disziplin, erweitert auf Zielwurf, auf ausgediente Laufschuhe ausweiten! Die hat jeder mehrfach im Haus, so daß man – anders als bei Gummistiefeln – auch einmal aufs Einsammeln verzichten kann. Haben die Läufer genügend trainiert – nach dem stretching das throwing – und ist runner’s throwing erst einmal zum Volkssport geworden, kann man dem Sport in politischen Aktionen lohnende Ziele setzen. Wir brauchen kein Politbarometer mehr; daran, wie oft ein Politiker zum Objekt von Laufschuhwerfern wird, könnte man den Grad seiner Beliebtheit viel eindrucksvoller ablesen. Möglicherweise würde sich allerdings eines Tages beim Sportgerät ein Versorgungsproblem abzeichnen; die Zahl der abgelegten und verschleuderten Laufschuhe könnte in Anbetracht der zahlreichen potentiellen Objekte der Nachfrage nach Wurfobjekten nicht mehr genügen.
Über Horst Preisler weiß man eine ganze Menge, wenn auch nicht immer die genaue Zahl seiner Marathone, weil er inzwischen wieder ein paar gelaufen ist. Aber das habe ich nicht gewußt, daß sich dieser eher realistisch orientierte Sportfreund mit der deutschen Romantik beschäftigt hat. Das Ergebnis liegt im Buchhandel vor: „Gesellige Kritik. Ludwig Tiecks kritische, essayistische und literarhistorische Schriften“. Man weiß so manches nicht. Zum Beispiel, daß Dieter Baumann am Stock geht, vielmehr an Stöcken. Mindestens jeden Mittwoch nachmittag in der Nähe des Neckars, da betreut er eine Nordic-Walking-Gruppe. Wie kann ein Mensch so tief sinken! fragt sich mancher besorgt. Gemach, beim Stuttgarter-Zeitung-Lauf im Jahr 2002 waren zwei Dieter-Baumann-Zeiten verzeichnet. Denn es liefen zwei Dieter Baumänner, der eine in 1:48:06, der andere 0:46:33, der eine Halbmarathon, der andere 10 km. Quizfrage: Welche Strecke ist der „echte“ gelaufen? Preis: Der Gewinner darf die Tagebuch-Eintragung zweimal lesen. Ein Jahr später waren wieder zwei Baumänner am Start, nein, nur einer von den beiden aus dem Jahr 2002, nämlich Dieter Baumann vom TSV Wernau, diesmal in 1:48:15. Der andere von der KSG Ellrichshausen war langsamer: 2:07:52. Dieter Baumann lief dann auch in den Jahren 2006, 2007 und 2008. Nein, nicht der aus Wernau am Neckar, es war der vierte der Bauleute, von www.lear-laeuft.de in 2:30:34. Tut mir leid, Dieter Baumann ist so einmalig nicht.
Doch wer ist das schon? Horst Preisler ist es nicht. Helmut Urbach war es nicht, er hat seinen Kölner Namens-Doppelgänger, einen bekannten Karnevalisten, im vorigen Jahr verloren. Werner Sonntag vielleicht? Das muß ein Hansdampf in allen Gassen sein. Er praktiziert als Allgemeinmediziner in Lohra und als Zahnarzt in Freiburg i. B., ist Pathologe in Ravensburg, hat eine Massage-Praxis in Schönenberg-Kübelberg, betreibt ein Schuh- und Sportgeschäft in Marktleuthen, aber auch eine Eisenwarenhandlung in Bad Honnef, er hat die Muße, Diözesangeschäftsführer der Malteser-Jugend in Trier zu sein ebenso wie Schützenkönig in Windhausen, wo mit einem Ehrungsmarathon der Schützenbruderschaft wenigstens eine Beziehung zum Marathon hergestellt worden ist; in Schwiegershausen hat er sich mit flüssiger Feder, wie anzunehmen ist, an der Dorfchronik beteiligt, schwieriger war es dann schon, ein Buch über Mietrecht mitzuverfassen, von dem Thema der Arbeitsgemeinschaft Qualitätsguß „Fräsen der Form erspart die Modellherstellung“ von Ing. Werner Sonntag gar nicht zu reden. Und das alles, während Werner Sonntag zwischen seinem Konsultationsbüro in Unna und dem in Peking pendelte, wo er deutsche Firmen berät und Musikinstrumente importiert und exportiert. Werner Sonntag als Torwarttrainer der Spielvereinigung Bayreuth, darüber erfährt man nicht viel. Der echte Werner Sonntag, den es in Wahrheit ebensowenig gibt wie einen falschen, empfindet es als Beleidigung, daß man sich im Fußball mit diesem Namen schmücken darf. Doch es kommt noch viel schlimmer, Werner Sonntag ist auch Vizepräsident der KeyBank in Cleveland, Ohio.
Höchstes Glück der Erdenkinder sei nur die Persönlichkeit, läßt Goethe im Westöstlichen Divan Suleika sagen. Ist Werner Sonntag danach ein unglücklicher Mensch? Er kommt schließlich als Dutzendware vor. Die Müller, Meier, Schulze wissen wenigstens, daß man sie nicht auseinander halten kann, und das Gesetz gestattet ihnen ohne weiteres Zusatznamen, bekannt ist Müller-Lüdenscheid, der mit der Ente. Herbert Steffny hat wenigstens nur einen älteren Bruder und keinen Namensvetter. Verwechslungen sind da nicht weiter schlimm, man landet in jedem Fall beim Laufen.
Früher haben wir in vollem Bewußtsein unserer Einzigartigkeit gelebt. Seit man die Suchfunktion im Internet betätigen kann, ist das vorbei. Wer unter Walter Wagner den LaufReport sucht, muß sich zum Beispiel über einen Heizungsbauer in Wien und einen in Geisenfeld sowie über den Rezensenten Dr. Walter Wagner in der Nähe von Linz vortasten und bleibt womöglich bei dem Spiegel-Artikel hängen: „Walter Wagner hat Angst. Er fürchtet, daß Schwarze Löcher entstehen könnten“, nämlich durch den Teilchenbeschleuniger LHC in Genf, und klagt daher im US-Bundesstaat Hawaii. Welches Glück, daß Schwarze Löcher im LaufReport nicht zu befürchten sind, irgendwer, irgendwas läuft immer.
Unheimlich ist es schon, seinem eigenen Namen im Internet zu begegnen. Da bleibt nichts verborgen. Bei der Suche nach mir selbst bin ich Artikeln begegnet, die ich vor undenklichen Zeiten für die „Zeit“ geschrieben habe. Die „Zeit“ nämlich hat ihr Archiv digitalisiert und Jahrzehnte alte Texte ins Netz gestellt. Wer will, kann nun eine geriatrische vergleichende Textkritik an mir üben. Der Staatssicherheitsdienst der DDR hätte es heute einfach – ein paar Klicke, und die ideologischen Abweichungen in den Blogs wären ans Licht gekommen. Womöglich wäre die Stasi sogar überflüssig geworden? Der VEB Google, vormals Horch & Greif, hätte alles schneller und zuverlässiger erledigt. Ich frage mich, weshalb wir noch Datenschutzbeauftragte haben. Inzwischen sind von uns so viele Informationen im Netz, meistens durch uns selbst dahin befördert und sei es über die Lauf-Ergebnisliste, daß es schon gar keinen Spaß mehr macht, andere auszuforschen. Die Fülle ermüdet. Für Amateur-Detektive mag die Leiche im Keller der anderen noch aufregend sein; doch wenn in jedem Keller eine Leiche liegt, wird’s ziemlich langweilig.
Inzwischen haben sich die Verdachtssymptome umgekehrt: Erst bei denjenigen, die nicht von Google gespeichert worden sind, ist höchste Vorsicht geboten. Das sind die Schläfer, und man weiß, sie sind am verdächtigsten.
Den Titel der jüngsten Fragerunde Maybritt Illners im ZDF fand ich treffend: Sind wir noch Papst? Die Anspielung auf die „Bild“-Titelzeile zur Wahl des deutschen Kardinals Ratzinger zum Papst nun mit Fragezeichen. Da hat in der Tat ein kritischer Denkprozeß eingesetzt. Wie haben sie sich an Benedikt XVI. rangeschmissen! Auf einmal gab es den traditionalistischen Josef Kardinal Ratzinger, den Vorsitzenden der Glaubenskongregation, Nachfolgerin der heiligen Inquisition, nicht mehr. Ein Deutscher auf dem Papstthron – die katholische Welt sah selbst für Protestanten, wahrscheinlich auch für Gottlose, auf einmal ganz anders aus. Papst-Audienzen sind zu Wallfahrten geworden. Politiker verschiedener Couleur ließen sich mit dem gütig lächelnden Papst für daheim abbilden. Die Jugend jubelte ihm zu wie einem Popstar. Und nun? Ein Fettnäpfchen nach dem anderen, wobei die Wiederaufnahme eines Holocaust-Leugners in die Kirche schon ein großdimensionierter Fettnapf ist. Welche Berater hat der Papst? wird gefragt. Als ob das im Hinblick auf die Leugnung der Shoah eine Rolle spielte! Ein deutscher Papst hat nun wahrhaftig genug über die historische Schuld seiner Nation gelesen.
Sicher, auch hier muß man alles differenzierter sehen, als es geschehen ist. Der Papst hat die Kirche den Abtrünnigen der Pius-Bruderschaft geöffnet. Die beste Absicht ist zu unterstellen, nämlich die Einheit der katholischen Kirche wiederherzustellen. Doch warum hat er nicht bei dem Theologie-Professor Hans Küng angefangen und denjenigen, die zum Beispiel die Ökumene nicht nur verkündet, sondern auch praktiziert haben? Als Kardinal hat er 1986 den zuständigen deutschen Bischof zu Maßnahmen gegen Professor Eugen Drewermann gedrängt. Die Pius-Bruderschaft ist keine faschistische Organisation; der Vater ihres Gründers, des Bischofs Lefèbvre, ist im Nazi-Konzentrationslager umgekommen, habe ich gelesen. Doch sie ist die Schritte des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht mitgegangen, und just auf diesem Konzil ist, noch auf Betreiben von Papst Johannes XXIII. in Nostra Aetate die katholische Lehrmeinung aufgegeben worden, die Juden seien für den Tod Jesu Christi verantwortlich. Gegenüber einem solchen Brückenschlag ist wahrhaftig unerheblich, wie die Messe gelesen wird. Die Traditionalisten der Pius-Bruderschaft stehen in einem merkwürdigen Licht da, daß sie einen Leugner des Holocaust, Richard Williamson, als Bischof dulden. Man hat zwar in der Bundesrepublik auch Nazis zu Ministern, ja zum Bundeskanzler und zum Bundespräsidenten gemacht, aber diese Nazis waren es spätestens nach dem 8. Mai 1945 nicht mehr. Williamson ist kein tumber glatzköpfiger Neofaschist; er hat die Möglichkeit, sich über die historische Wahrheit zu informieren. Niemand kann sich vorstellen, daß Papst Benedikt XVI. nicht die Geschichtslüge des Bischofs Williamson gekannt haben soll; jeder Zeitungsleser hat sie gekannt.
Der Vatikan hat sich immer viel auf seine Diplomatie zugute getan und sei es seinerzeit das mit Hitler abgeschlossene Reichskonkordat. Wie kann man die Gnade der Barmherzigkeit einem Mann zuteil werden lassen, der unbarmherzig gegen die Opfer die Shoah abstreitet? Alle Beteuerungen, daß die Haltung der katholischen Kirche zum Mord an den Juden klar sei, können dem Erklärungsnotstand nicht abhelfen.
Die Rücknahme der Rücknahme der Exkommunikation unter der Bedingung, daß der britische Bischof widerrufe – im Widerrufen Andersgläubiger hat die katholische Glaubensjustiz Erfahrung – kommt mir zwar als schlauer jesuitischer Schachzug vor, aber sie mindert den Skandal nicht. Hätte Williamson seine Geschichtslüge widerrufen, stünde er als Opportunist da. Da er nicht widerrufen will, kann man die Heimkehr in den Schoß der allein seligmachenden Kirche nun verhindern. Als ob man den Widerruf nicht vor Aufhebung der Exkommunikation zur Bedingung hätte machen können!
Der Fall ist über den Anlaß hinaus bedeutungsvoll. Auf einmal zeichnen sich die ultrakonservativen Züge des lieben deutschen Papstes ab. Der Fall Williamson war nur der Tropfen, der den Weihwasserkessel zum Überlaufen gebracht hat. In den deutschen Gemeinden rumort es, im mildesten Fall herrscht Ratlosigkeit, selbst Bischöfe proben den Aufstand – eine ganz neue Qualität der Beziehung zum Vatikan wird sichtbar. Wenn man die Zeiten überblickt, so ist bemerkenswert, daß man jetzt in der katholischen Glaubensgemeinde offen sagen darf, was man denkt. Die Demokratie ist in der Jahrzehnte lang auf Gehorsam beruhenden Glaubensgemeinschaft angekommen. Kirchenaustritte häufen sich. Das freilich kommt mir auch merkwürdig vor. Ein bloßes Ungeschick, eine wenn auch gewaltige Irritation zum Anlaß zu nehmen, die Glaubensgemeinschaft, deren Glaubensinhalte ja nicht angetastet worden sind, zu verlassen, scheint mir auf tiefere Gründe hinzudeuten.
Was geht das alles den Läufer Sonntag an, was vor allem gehen die Läufer dessen Ansichten an? Die Antwort: Wann jemals wird insgesamt soviel gedacht wie beim Laufen? Wie wenig wird dabei doch an das Laufen gedacht! Und da sollen wir uns nicht darüber mitteilen, was den mentalen Hauptteil des Laufens im Alltag bildet? Ein Tagebuch ist mehr als eine Fachzeitschrift, die sich Zweckmäßigkeit auf den Titel geschrieben hat. Der Läufer Sonntag sagt hier, was er denkt. Er ist katholisch getauft und weiß, worüber er gerade nachdenkt.
Die Sachbearbeiterinnen meiner Krankenkasse sind sowohl adrett als auch nett. Bei einer von ihnen legte ich meinen Fitneß-Nachweis vor, um einen Beitrags-Bonus für das Jahr 2008 zu erhalten. Zahnärztliche Untersuchung – ach, wäre es nur bei dieser geblieben! –, Impfbuch – wenigstens habe ich es, denn impfen lasse ich mich nur im Notfall, zum Beispiel Auffrischung der Tetanus-Impfung im aktuellen Fall, aber keine Vorsorge-Impfung gegen Grippe –, und dann also der Fitneß-Nachweis. Die AOK hatte dazu 2 Kilometer Walking auf dem Sportplatz angeboten. Ich weiß nicht, wie rasch man die 2 Kilometer als Zweiundachtzigjähriger walken muß, um als fit zu gelten. Jedenfalls walke ich derzeit mindestens viermal in der Woche 11 Kilometer. Also kein Problem. Doch wie nachweisen? Ja, da ist doch Biel, 100 Kilometer Walking in 19:49 Stunden – ein Donnerschlag, sogar ein bißchen viel für die Provinz. Außerhalb der AOK ist man ja wer. Die nette, adrette Sachbearbeiterin runzelte die Stirn, als ich ihr die Kopie der Finisher-Urkunde vorlegte. Biel – das ist ja in der Schweiz? Anerkannt wird nur die Teilnahme an Veranstaltungen in Deutschland. Möglicherweise hat sie meine verwunderte Reaktion beeindruckt: 100 km Biel sei eine sehr bekannte Veranstaltung; vielleicht wollte sie auch nur nett sein. Daher wird sie meine Unterlagen einschließlich der Urkunde von Biel weiterreichen. Doch noch immer wiege ich mich in der fürchterlichen Ungewißheit, ich könne nach den Richtlinien der AOK womöglich nicht fit sein. Und wenn nicht, büßte ich den Bonus ein, nämlich 30 Euro, die ganz knappe Hälfte des Startgeldes von Biel, das in der Schweiz liegt und nicht in der Nähe von Karlsruhe, wo Prof. Dr. Klaus Bös die AOK Baden-Württemberg darüber berät, wer fit ist. Kennt jemand eigentlich die Marathonzeit von Professor Bös?
Nun aber im Ernst. Würde die Teilnahme am New York-Marathon etwa auch nicht als Fitneß-Nachweis anerkannt? Oder Honolulu? Da fungiert ja Herbert Steffny als Reiseleiter, und Herbert Steffny ist für das AOK-Programm Laufend in Form verantwortlich. Vom New York-Marathon hat hier jeder einmal gehört, doch von einem 100-km-Lauf in Biel? Es zeigt sich, daß der Ultralanglauf die längste leichtathletische Disziplin nur auf dem Papier und nicht im Bewußtsein der Öffentlichkeit ist.
Zur Popularisierung des Ultramarathons hat der DLV nichts beigetragen, erst recht nicht nach dem Schisma der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung. Der DLV hält’s mit dem abgewählten Verlierer der seinerzeitigen Präsidenten-Wahl, der mit dem VFUM den Ultramarathon durch Förderung der Leistungsspitze zu fördern meint. Die DUV wird offenbar nur noch als der Geselligkeitsverein der Volksläufer und -marschierer angesehen. Immerhin, wir sind das Volk. Doch auf diese Weise, hier der mit 1300 Mitgliedern wohl noch immer größte Verband von Ultraläufern in der Welt, dort der DLV mit einem abgewählten DUV-Präsidenten als Ultramarathonberater und Repräsentanten im Bundesfachausschuß Laufen, läßt sich wohl kaum erreichen, daß der Ultramarathon seinen Bekanntheitsgrad steigert. „Gemeinsam sind wir stärker“, Harry Arndts Geleitwort in jedem Heft von „Ultramarathon“, ist zur Farce geworden.
Dabei gibt es durchaus hoffnungsvolle Anzeichen; sie zeigen sich mehr in der subjektiven Wahrnehmung als in der Statistik. Von so vielen Läufern habe ich erfahren, daß sie einen Ultramarathon anstreben, und die „Bieler Juni-Nächte“ verkaufen sich so kontinuierlich, wie ich das nicht erwartet hatte. Der ThüringenULTRA, in diesem Jahr zum drittenmal, und die 1. Ulmer Laufnacht sind weitere Indizien für einen heimlichen Trend zum Ultramarathon. Ein weiterer neuer 100-km-Lauf wird am 3. Oktober in Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgetragen. Doch dies ist als Deutsche Meisterschaft eine Elite-Veranstaltung. Mit Verwunderung registriere ich, daß der DLV auch im Zeichen demographischer Veränderungen und der Erhöhung des Rentenalters an der Definition von Senioren festhält: Senioren sind Läufer von 40 Jahren an und Seniorinnen sind es von 35 Jahren an. Ja, ja, die alten Damen, ganz schön fit noch. Muß man für die Deutsche Meisterschaft auch sein, 13 Stunden ist das äußerste. Eine M 75 und W 70 oder gar M 80 sind nicht vorgesehen. Da die offizielle DLV- und VFUM-Statistik nur die Zeiten von Startpaß-Inhabern verzeichnet, ergibt sich das groteske Bild, daß der Sport Hochaltriger in der Statistik nicht vorkommt. Sie hat damit nur einen Aussagewert für den Hochleistungssport, spiegelt aber nicht im mindesten das Sportverhalten der Bevölkerung wider.
Zu meiner Kritik an dem Termin der 1. Ulmer Laufnacht, der genau auf dem Termin der Bieler Lauftage mit dem 51. 100-km-Lauf liegt, habe ich eine Zuschrift erhalten, in der ich getadelt werde, weil ich den Verantwortlichen unsportliches Verhalten vorgeworfen habe. Man solle doch froh sein, daß die drei von Sun Management mit Erfolg etwas aus der „Laufwüste Ulm“ gemacht hätten. Einspruch, Euer Ehren! In Ulm mag zwar vielleicht in den Jahren vor dem Einstein-Marathon mit Laufveranstaltungen nichts losgewesen sein, aber eine Laufwüste war es nicht. In Ulm-Söflingen fand bereits 1968 der erste Volkslauf über 10,5 km und 1972 der erste Marathon statt; 1976 wurde hier, auf der Strecke im Blautal, die baden-württembergische Marathonmeisterschaft ausgetragen. Im nahen Heidenheim gab es von 1968 an den Brenztal-Marathon, einen der ersten Marathons in Baden-Württemberg, und im nahen Illertissen 1974 den 1. 100-km-Lauf. Auch nach dem Ende dieses Ultralaufs 1978 wurde in Illertissen noch Marathon gelaufen.
Und selbst wenn Sun Management eine Wüste belebt hätte, wäre es kein Grund, dem Bieler 100-km-Lauf am selben Tage Konkurrenz zu machen.
Mein Fax-Gerät hat sich soeben gemeldet. Sonst kommen außer Buchbestellungen immer dubiose Angebote von Autohändlern, die mein Auto haben möchten, ohne es zu kennen, jüngst für den Export nach Estland, oder es wird Interesse an einer gebrauchten Druckmaschine bezeigt. Diesmal aber.... Also wenn in der nächsten Woche keine Eintragung mehr folgt, dann habe ich das verlockende Angebot aus dem Faxgerät angenommen. Die Japan Investment Corp. in Hongkong, Investment Bank & Venture Capital, will meine Firma kaufen, schreibt sie. Dem sehr geehrten Inhaber teilt sie mit: In kleine bis mittelständische Firmen wie meine sollen 30 Millionen Euro investiert werden. Ich muß heute nur noch Frau Dr. Petra von Spangenberg anrufen, die nämlich Deutsch spricht und mein Treffen mit Herrn Sumitomo Satou, dem Präsidenten, abstimmen wird. Mr. President weilt diese Woche in Deutschland. Hach, wer wird danach für mich schreiben? Dabei hätte ich ein so schönes Thema – über Heuschrecken.
Kann ich noch über Laufen schreiben? Unversehens bin ich vom Läufer zum Geher geworden. Quälender Husten vor Weihnachten. Dann sanken die Temperaturen. Ich gab es auf zu traben, weil ich die angegriffenen Bronchien schonen wollte. Fünf Schichten übereinander, ich hatte das Gefühl, mich nicht bewegen zu können. Ich hatte befürchtet, mir die Zehen zu erfrieren. Da zog ich mir die Wanderschuhe an. Die Vibramsohle war ohnehin besser für Eis und Schnee geeignet als die Laufschuhe. Ich hatte den Eindruck, auch andere gaben das Laufen auf.
Offenbar wurde ich von den Walkern als einer der ihren wahrgenommen, einer grüßte mich. Der erste Walker, der mich grüßte. Willkommen im Club! Doch mir fehlt Entscheidendes – die Stöcke! Nein, den Schritt zum Nordic Walking mag ich nicht vollziehen. Als mich dann nach dem Jahreswechsel doch ein Läufer überholte, wünschte er mir „Ein gutes Neues Jahr, Meister!“ Er hatte in mir, dem Walker, den Läufer erkannt, schon weil ich Läuferkleidung trug. Da kam ich mir vor wie ein Hartz-IV-Empfänger, der einmal bessere Tage gesehen hat.
Ich hätte mich quälen können. Ich hätte mich damals auch quälen können, einen Marathon in 3 Stunden zu laufen. Dann wäre ich womöglich nicht mehr in M 80 Marathon gelaufen. Wahrscheinlich wäre ich überhaupt nicht mehr gelaufen. Immer war es mein Grundsatz, zumindest im Training so zu laufen, daß es mir Freude machte. Ich habe jetzt das Bedürfnis gehabt, nicht mehr zu laufen, sondern flott zu gehen. Ich fühle mich danach ebenso gut wie nach dem Laufen. Die Zeit ist gekommen, den Übergang vom Läufer zum Walker zu akzeptieren. Ich kann mich nicht an den wenigen Großen in den Altersklassen orientieren. Ich bin immer nur guter Durchschnitt gewesen. Das bin ich halt auch als Hochaltriger. Josef Galia bleibt für mich unerreicht. Die Marathonzeit von Arthur Lambert habe ich schon, als ich einige Jahre jünger war als er bei seinem Marathon, nicht mehr erreicht. Doch er ist nur einen einzigen Marathon gelaufen. Vermutlich hat auch er Grenzen gesehen. Heinrich Gutbier ist immer erheblich besser gewesen als ich, Horst Feiler ist es auf der Ultralangstrecke. Ich kann mich nicht an den besten Altersläufern, den wenigen, orientieren, ich muß die vielen Altersgenossen, die am Stock gehen oder am Gehwägelchen hängen, im Blick haben. Danach bin ich äußerst fit. Auch im Alter muß man seine Identität finden, seinen Platz im Feld.
Resignation ist das nicht. So wie mit fortschreitendem Alternsprozeß meine Lauf-Trainingsrunde von Gehpassagen an Steigungen unterbrochen war, so habe ich jetzt angefangen, meine Walking-Runde durch Laufeinlagen zu unterbrechen. Siehe da, auch andere, die in der Kälte offenbar mit dem Training ausgesetzt haben, beginnen wieder zu traben. Vor mir ein Walker ohne Stöcke, der sich im Laufschritt in Bewegung setzt, vor mir ein Läufer, der plötzlich in den Gehschritt fällt. Alles beobachtet. Ich bin auch in dieser Hinsicht nicht allein.
Kummer macht mir die Gewichtszunahme. Schon immer habe ich im Spätherbst etwa ein Kilogramm zugenommen. Das erschien mir als ganz natürlich, der Körper legt Vorräte an für die Zeit, in der man nicht sammeln und nicht jagen kann. Diesmal jedoch sind es 3 Kilogramm. Es wird Anstrengung kosten, sie zu reduzieren.
Ich werde mich nicht mehr wie im vorigen Jahr zu einem Marathon im April anmelden, das wäre bei weitem zu früh. Ob es überhaupt noch zu einem Marathon reicht, muß dahingestellt bleiben. Ich habe mich zum Rennsteig-Marathon von Neuhaus nach Schmiedefeld angemeldet. Da kann ich bis zum Zielschluß ankommen. Den Mut, eine halbe Stunde und mehr nach dem Vorletzten anzukommen, habe ich längst trainiert.
Die aktuellen Nachrichten lassen mir keine Ruhe. Heute ist Dr. Klaus Zumwinkel verurteilt worden. Seit Jahr und Tag reden uns Politiker und willfährige Medien ein, Steuerhinterziehung sei kein Kavaliersdelikt. Ist es doch. Der Staat, als Steuer-Gläubiger, will es nur nicht wahrhaben. Aus den 1,2 Millionen hinterzogener Steuer sind 970 000 Euro geworden. Angeblich sind die Hinterziehungen aus dem Jahr 2001 verjährt. Was macht man, wenn man ertappt worden ist? Doch bloß nicht auf einen Rechtsstreit einlassen, dessen Ausgang erlebt man nicht mehr.
In Diktaturen wie der DDR gab es nur eines: Selbstkritik, öffentliche Zerknirschung. Alles andere wäre Widerstand gewesen, und den hätte das Regime gebrochen. Mit irgendwelchen ideologischen Anwürfen war vor über fünfzig Jahren der Leiter der Bühne der Jugend in Görlitz aus der SED und der FDJ ausgeschlossen worden. Das Programm der Bühne war zu bürgerlich, er selbst auch. Also bereute er seinen Kurs. Er durfte sich bewähren, in dem er auf andere Intellektuelle angesetzt wurde. Und nach der Bewährung wurde er Intendant in Bautzen. Auch die demokratische Staatsmacht läßt nicht mit sich spaßen. Also hat Dr. Zumwinkel den „schlimmsten Fehler seines Lebens“ bereut. Damit hat er sich nichts vergeben. Ein Fehler ist immer nur dann ein Fehler, wenn etwas schief gelaufen ist. Hätte die Staatsanwaltschaft nicht durch Kriminelle von der Stiftung bei der LTG-Bank in Liechtenstein erfahren, wäre es kein Fehler gewesen. Auch in der Politik sind Fehler nur dann Fehler, wenn etwas schief gelaufen ist.
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben Zumwinkel auch ohne Urteil verurteilt. Sie haben ihm aufgelauert an jenem Februarmorgen, ihn Spießrutenlaufen lassen vor den Millionen Zuschauern. Und sie werden es auch künftig bei jeder Gelegenheit tun. Einer der Wirtschaftsmächtigsten auf dem Weg zum Untersuchungsrichter, das hat doch Unterhaltungswert. Mehr davon, bitte!
Nun ist Dr. Zumwinkel vorbestraft. Na und? Er befindet sich in guter Gesellschaft. Im Alter von 65 Jahren wollte er ohnehin seinen Posten bei der Post aufgeben. Jetzt hat er auch noch seine Posten in den Aufsichtsräten verloren. Es waren eh zu viele. Und was ist denn eine Million? Für die Deutsche Bank waren die an Dr. Schneider verlorenen 50 Millionen Deutsche Mark Peanuts. Eine noch unbekannte Zahl von Managern hat die Bundesrepublik und uns Steuerzahler und unsere Nachkommen eine noch unbekannte und unbekannt bleibende Zahl von Milliarden Euro gekostet. Dies wird bis auf wenige Fälle, die man als exemplarische Fälle braucht, ungesühnt bleiben. Gegen die Milliardenverluste ist eine Million, die sich halt in mehreren Jahren zusammengeläppert hat, ein Nichts. Sicher, er mußte Steuer mit Zins und Zinseszins nachzahlen, und nun kommt noch die Geldstrafe dazu. Wenn ich nicht irre, ein knappes Zehntel seines Vermögens. Du meine Güte, wir haben nichts verbrochen und müssen seit 1. Januar ein Viertel unserer Kapitalerträge, so es sie gibt, abgeben. Dr. Zumwinkel muß sich halt nun einschränken wie andere Leute auch. Da wird er einmal sehen, wie das ist, mit 50.000 Euro im Monat auskommen zu müssen. Doch vielleicht lebt sich’s auf seiner Burg in Oberitalien billiger. Und das Große Bundesverdienstkreuz samt Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen würde bei eBay vielleicht auch etwas abwerfen.
Wieder eine Erinnerung aus meiner Vita. Meine frühere Arbeitgeberin vor über fünfzig Jahren war wegen Steuerhinterziehung von 100.000 Mark zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Damals kam bei diesem Strafmaß keine Bewährungsfrist mehr in Frage. Kein noch so guter Anwalt konnte sie herauspauken. Da mußte ein Arzt ran, der sie für haftunfähig erklärte. Es muß ein guter Arzt gewesen sein, denn sie erholte sich von der schweren Krankheit rasch und für mehrere Jahrzehnte dauerhaft. Die 100.000 Mark waren, versteht sich, damals erheblich mehr wert als 50.000 Euro heute. Aber dennoch, gegen ihre Bestrafung sind zwei Jahre Freiheitsstrafe mit Bewährungsfrist in Anbetracht der Summe human. Natürlich wird sich Dr. Zumwinkel bewähren, so einen Fehler macht man nicht zum zweitenmal. Anders so ein dummes Schwein, das aus dem Knast kommt und sich nicht anders zu helfen weiß, als wieder irgendwo Mist zu bauen. Was ich sage, auf höherer Ebene sind strafbewehrte Abgabenhinterziehungen eben doch Kavaliersdelikte. Man muß sich nur wie ein Kavalier verhalten. Dann wird man auch so behandelt.
Was das Wesen eines Tagebuchs ausmacht, das Persönliche, ist in den letzten Wochen eindeutig zu kurz gekommen. Die aktuellen Ereignisse haben mich überrannt, ich mußte mich dazu äußern. Und, bitte, das geht ja weiter.
Wir stehen vor einer Zäsur: Der neue amerikanische Präsident übernimmt sein Amt. Nicht nur die Hoffnungen der Vereinigten Staaten richten sich auf ihn. Er hat weiter zwei Kriege zu führen, und er sollte im Nahen Osten Frieden stiften. Obama kann der Realität nicht ausweichen, wahrscheinlich wird er sich fügen. Der baden-württembergische Ministerpräsident, Oettinger, hat die USA als Sanierungsfall bezeichnet – von einem CDU-Ministerpräsidenten ein hartes Wort. Vor ein paar Jahre wäre ihm das vermutlich nicht über die Lippen gekommen. Wenn der Mutterkonzern USA ein Sanierungsfall ist, dann wird er, um im Bild zu bleiben, erst einmal die Tochtergesellschaften außerhalb des Landes heranziehen. Die wichtigste Tochtergesellschaft ist die Bundesrepublik Deutschland.
Was sich hier vollzieht, entbehrt nicht grotesker Züge. Ein ganzes Volk, von dem ein Teil durch verantwortungslose Bankberatung und der Systemstützung durch die Medien (Die Deutschen haben zu wenig Aktien) seine Ersparnisse verloren hat und in der Wirtschaftskrise weiter verarmt, muß nun die Milliarden aufbringen, mit denen die Banken vor dem Zusammenbruch gerettet werden sollen. Im Grunde müßten auch die Banken in der Bundesrepublik Insolvenz anmelden. Da sie gestützt werden und dies vor allem von künftigen Generationen bezahlt werden muß, kann man von einer Art Insolvenzverschleppung sprechen. Im bürgerlichen Leben ein Fall aus dem Strafgesetzbuch.
Die erste Stützung galt der Automobilindustrie. Die ehemalige Regierungspartei Bündnis90/Die Grünen hat nun eines ihrer politischen Ziele erreicht, die Drosselung des Autoverkehrs, nämlich durch weniger Autokäufe und sparsameres Fahren. Und nun, da die Menschen keine Autos mehr kaufen, wenn sie es nicht unbedingt müssen, ist dieses Verhalten auch nicht recht. Durch Prämien sollen sie davon wieder abgebracht werden und sich, bitte, so verhalten wie früher, als die Grünen sie von ihrem damaligen Verhalten abzubringen versuchten. Und sie sollen doch, bitte, ihr neun Jahre altes Auto zum Schrotthändler fahren. Wäre mein Auto nicht sieben, sondern neun Jahre alt, hätte es höchstens 120 000 Kilometer auf dem Tacho. Ökologisch wie ökonomisch ein Unsinn, einen scheckheftgepflegten Diesel dann zu verschrotten. Wären die Grünen noch an der Regierung, hätten sie die Subventionierung der Automobilwirtschaft mittragen müssen. Eine Groteske. Sie findet beileibe nicht nur bei den Grünen statt.
Anfang der achtziger Jahre hat der damalige CDU-Sozialminister die Schleuse moralischer Hemmungen für die Firmen geöffnet, ältere Arbeitnehmer zu entsorgen, weil sie erstens mit Ende Fünfzig abbauen, wie man an den Bankmanagern deutlich gesehen hat, und zweitens zuviel Geld kosten. Keine zwanzig Jahre später erhöht diese CDU das Rentenalter auf 67. Zu der Altersklasse derjenigen, die in den achtziger Jahren mit dem Zuckerbrot der Frühverrentung oder der Peitsche der Arbeitslosigkeit aus dem Arbeitsleben gedrängt worden sind, gehört in den USA ein 57jähriger Pilot. Er, Chesley Sullenberger, der in Germany vor der Frühverrentung stünde, hat gerade 155 Menschen durch eine gekonnte Notwasserung vor den Türmen Manhattans das Leben gerettet. In Deutschland sind Erfahrung und die daraus resultierende Umsicht der Älteren und jungen Alten als zu teuer angesehen worden.
Weiter, die SPD hatten wir noch nicht. Es gibt sie ja auch seit dem Hessen-Wahltag noch. Niemand hat auf die Stimmen gehört, die davor gewarnt haben, sich mit der Gasversorgung von Rußland abhängig zu machen. Jetzt wird – wieder einmal – die Unberechenbarkeit der russischen Seele sichtbar. Doch vielleicht ist es die Ukraine? Was ändert das daran, daß sich bei uns die Speicher leeren. Selbstverständlich sind wir bei Ausbruch der Gaskrise mit dem Hinweis auf die Kapazität unserer Gasspeicher beschwichtigt worden. Jetzt schon sind sie halbleer. Und die Menschlichkeit gebietet es, daß wir davon auch noch etwas abgeben für die Krankenhäuser und Kindergärten in osteuropäischen Ländern, den früheren sozialistischen Bruderländern des Kreml. Im Grunde müßten wir jetzt sagen können: Wie gut, daß wir einen ehemaligen SPD-Bundeskanzler haben, der auf der Gehaltsliste von Gazprom steht und den Aktionärsausschuß der Nord Stream AG, einer Tochtergesellschaft von Gazprom, leitet. Er ist dort nicht der einzige Deutsche. Geschäftsführer der Gesellschaft, die den Bau einer Pipeline durch die kampfmittelverseuchte Ostsee betreibt, ist ein ehemaliger hauptberuflicher Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (1974 - 1989), wie ich bei Wikipedia gelesen habe. Sein Rüstzeug hat er danach beim Klassenfeind geholt, bei der Dresdener Bank. Welche Möglichkeiten hat Gerhard Schröder bei Gazprom genutzt? Wir lesen darüber nichts. Er wird nicht dafür bezahlt, daß er, wie einst sein Amtseid als Bundeskanzler lautete, Schaden vom deutschen Volke abwende.
Manchmal sind wir Läufer in der Vergangenheit hämisch gefragt worden, wovor wir denn davonliefen? Von alledem.
Entwicklungen verlaufen selten linear, sondern häufig in Schüben oder, marxistisch definiert, spiralförmig, – seit vorigem Jahr ist Karl Marx wieder zitierfähig. Oberflächlich betrachtet, könnte man meinen, der Ultralanglauf in Deutschland habe Rückschläge erlitten. Ein deutscher Ultralauf nach dem anderen stellte die Austragung ein. Eine Zeitlang fiel einem bei deutschen Ultraläufen nur der Supermarathon des GutsMuths-Rennsteiglaufs ein, was nicht einmal stimmte. Wenn man sich klar macht, daß gerade Ultramarathon-Veranstaltungen auf persönliche Initiativen zurückzuführen sind, muß man akzeptieren, daß das Ausscheiden der Initianten nicht selten auch das Ende der Veranstaltung bedeutet, es sei denn, man kann wie in Biel oder in Schmiedefeld die Kontinuität rechtzeitig institutionell sichern.
Auf die ersten deutschen 100-Kilometer-Läufe, 1969 in Unna und 1973 in Illertissen, sind andere Neugründungen gefolgt; wie bei den ersten bildete der 100-km-Lauf von Biel das Muster. Oder aber man wollte sich, wie von 1976 an mit der 10-km-Runde bei Hamm, von Biel deutlich abheben und mit der Möglichkeit exakter Leistungsvergleiche den sportiven Charakter des Ultralaufs betonen. Mit dem Bestreben der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung, den 100-km-Lauf in den Rang einer leichtathletischen Disziplin zu erheben, war es folgerichtig, daß Harry Arndt in Rodenbach eine meisterschaftsfähige, nämlich nicht anfechtbare 10-Runden-Strecke ins Leben rief. Damals befürchtete ich schon, daß darüber der Erlebnis-Charakter des Ultralaufs verloren gehen könnte; denn mir war, schon aus eigener Erfahrung, bewußt, daß es den meisten, die zum Ultralauf fanden, nicht um Bestzeiten, sondern um das Bestehen einer bis dahin unbekannten Herausforderung ging. Ultraläufer finden ihren Maßstab bei sich selbst. Die DUV hat trotz Rodenbach sehr bald beide Richtungen, die zur schnellen, vergleichbaren Zeit und die zum Erlebnislauf, als gleichrangig behandelt und gefördert. Es scheint, daß auch heute das größere Teilnehmerpotential beim Erlebnislauf liegt.
Um die 100-Kilometer-Strecke war es in Deutschland eine Zeitlang schlecht bestellt. Dafür hat die Zahl der Ultradistanzen unterhalb von 100 Kilometern zugenommen. Regionale Veranstaltungen wie der Schwäbische-Alb-Marathon haben gezeigt, daß dafür ein ausreichendes Teilnehmer-Potential vorhanden ist. Man sah nicht immer die Entwicklungslinie, doch die nächste Windung der Spirale war erreicht. Wieder erleben wir eine sichtbare Drehung in die Höhe.
Der ThüringenULTRA, eine 100-Kilometer-Runde im Thüringer Wald, hat sich mit zuletzt 139 Finishern etabliert; er wird am 4. Juli zum drittenmal veranstaltet. Da bei über 2000 Höhenmetern und einem Zielschluß nach 18 Stunden das Potential an Einzelläufern erheblich begrenzt ist, muß er sich auf Staffelläufer stützen.
In diesem Jahr gibt es zwei neue Ultraläufe. Axel Reusch in Sonthofen, der beim Allgäu-Panorama-Lauf Erfahrungen im anspruchsvollen Landschaftsmarathon gewonnen hat, bietet nun zum selben Termin wie dem Marathon, am 22. August, den Ultra-Trail an, eine Strecke von 69 Kilometern und 3000 Höhenmetern. Das Angebot wendet sich ausdrücklich an erfahrene Bergläufer; erstmals wird das Mitführen eines Mobilphons, einer Rettungsdecke und einer Signalpfeife vorgeschrieben. Soweit ich das nach meinen Wanderungen im Allgäu beurteilen kann, enthält die Strecke weder ausgesetzte Stellen noch extreme Steigungen, ist also wohl nicht mit dem Lauf vom Hochgrat zum Mittag vergleichbar. Zudem ist die Möglichkeit geboten, nach 49 Kilometern in Oberstdorf den Lauf regulär zu beenden; von Oberstdorf zurück nach Sonthofen besteht eine gut bediente Bahnverbindung. Mir gefällt das Vorhaben sehr. Dem Rennsteiglauf als einem Mittelgebirgs-Ultra wird nun ein alpiner Ultra zur Seite gestellt.
Ebenso könnte man die 1. Ulmer Laufnacht begrüßen, eine lang vermißte 100-Kilometer-Runde mit nur etwa 400 Metern Höhenunterschied, wäre da nicht der Termin. Die 1. Ulmer Laufnacht ist nicht nur nach Bieler Muster konzipiert – 21 Stunden (nicht 18, wie auf der DUV-Seite angegeben), mit eigenen Wertungen für Einzelstarter bei km 50 oder 80, ebenfalls für Staffeln geöffnet –, sondern auch auf denselben Termin wie der 51. Bieler 100-km-Lauf gelegt, den 12./13. Juni. Da kann man nur den Kopf schütteln. Wenn die Terminierung wirklich nicht als Provokation gemeint war, dann ist es Naivität, die dazu geführt hat. Nahegelegen hätte es, die Ulmer Laufnacht – auch im Namen eine Anleihe bei dem Marketingkonzept von Biel – mit dem Einstein-Marathon zu kombinieren. Der Termin des Einstein-Marathons ist immer der Tag des Berlin-Marathons, in diesem Jahr also am 20. September. Das ist in Ordnung, Berlin tut es absolut nicht weh, wenn am selben Tage 1000 Läufer oder weniger woanders Marathon laufen. Und für Läufer bedeutet es eine echte Alternative, zumal wenn sie in Berlin keinen Startplatz mehr bekommen haben. Ganz anders ist die Situation am 12./13. Juni. Wer diesen Termin für seine Kopie wählt, beschneidet in voller Absicht das Potential in Biel. Wenn Rücksicht auf andere, regionale, um nicht zu sagen: lokale Veranstaltungen genommen wird, den Herrlinger Lautertallauf am 20. Juni, den Stuttgarter-Zeitung-Lauf am 21. Juni, den Erbacher Triathlon am 28. Juni, dann hätte diese Rücksicht zuerst einer gleichartigen Veranstaltung gelten müssen, dem Bieler 100-km-Lauf. Wer am Lautertallauf in Blaustein-Herrlingen (Halbmarathon oder 10 km) teilnimmt, den interessiert nicht, wenn am Tag zuvor in Blaustein ein 100-km-Lauf gestartet wird und umgekehrt. Auch die Zahl derjenigen, die eine Wahl zwischen Halbmarathon oder einem Triathlon und den 100 Kilometern vor Probleme stellt, dürfte minimal sein. Einen neuen 100-Kilometer-Lauf auf den Tag des Laufes zu legen, den man abkupfert, – ein Ultraläufer bezeichnete dies als Unverfrorenheit.
Der mildeste Ausdruck: unsportliches Verhalten des Veranstalters. Es läßt darauf schließen, daß ihm die Bedeutung des 100-km-Laufs von Biel nicht bewußt ist. Wer so wenig Respekt vor der Leistung der Schweizer für den Ultralauf zeigt oder sie gar nicht ermessen kann, sollte besser die Hände von einer Nachahmung lassen. Auch anderes kommt mir unprofessionell vor: Obwohl der Termin bereits in den vor Wochen zusammengestellten Laufkalendern steht und Anmeldungen möglich sind, wird uns auch jetzt noch die Höhe des Startgeldes vorenthalten. Bekannt ist nur, daß nur 9 Verpflegungsstationen vorgesehen sind (in Biel sind es 17) und kein Anspruch auf Rücktransport beim Aufgeben besteht. Allerdings kommt man bei km 50 und km 80 ohnehin ins Stadtgebiet von Ulm; Start und Ziel sind im benachbarten Blaustein. Die Streckenführung in Stadtnähe erinnert an die 100 Kilometer von Marburg.
Mir scheint, daß die Kommerzialisierung des Laufsports eine neue Blüte getrieben hat. Sowohl der Einstein-Marathon als auch die Ulmer Laufnacht werden von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung veranstaltet, der SUN Sportmanagement GmbH, das bedeutet ja wohl, daß nun auch Ultramarathonläufer, die in Ulm melden, mit der Startgebühr 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen müssen. Wie fühlt man sich als ehrenamtlicher Helfer bei einem kommerziellen Projekt?
So kränkend die Verlegung eines 100-km-Laufs auf den seit Jahren bekannten Termin in Biel für das OK der Bieler Lauftage auch ist, man wird dort zwar eine Einbuße bei den Anmeldungen deutscher Teilnehmer erleiden, aber bisher hat der Bieler 100-km-Lauf alle ähnlichen Veranstaltungen an Lebenszeit übertroffen. Die deutschen Nachahmungen sind sang- und klanglos untergegangen. Alle. Wie heißt doch der Roman von Botho Strauß? „Die Fehler des Kopisten“.
Tod auf der Skipiste – die Meldung hätte es außer in der Regionalzeitung allenfalls in die „Süddeutsche“ geschafft. So aber... Wenn eine Skiläuferin mit dem thüringischen Ministerpräsidenten zusammengestoßen ist, vergeht kein Tag, an dem nicht von allen Medien über das Unglück referiert wird, wobei nicht die zu Tode gekommene Sportlehrerin im Mittelpunkt steht. Niemand kann zur Zeit den tragischen Fall anders als mit fragendem Blick kommentieren. Doch es ist ein Fall, der das Risiko des alpinen Skilaufs schlagartig deutlich macht. Unwidersprochen wird mitgeteilt, daß sich in jedem Winter allein in Deutschland etwa 45.000 Unfälle beim Skilaufen und Snowboarding ereignen, in den Alpenländern Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz zusammen sind es jährlich 250.000, eine ungeheuere Zahl. Da ganz sicher nicht jede durch einen Sturz verursachte Prellung registriert werden wird, handelt es sich allein um die statistisch erfaßbaren Unfälle, also eher schwerwiegende, bei denen Hilfe angefordert werden muß, vom Schlüsselbeinbruch über den Sehnenabriß bis zum Schädel-Hirn-Trauma und zur Wirbelsäulenverletzung. Illustriert wird die Statistik durch die Aussagen von Rettungsmannschaften und Ärzten in den Krankenhäusern von Wintersportgebieten.
Bei 4,2 Millionen deutschen Skiläufern sind 45.000 Verletzte nicht ganz 1 Prozent. Doch stellen wir uns zum Vergleich den Berlin-Marathon vor. Wenn von den 40.000 Teilnehmern 1 Prozent ins Krankenhaus gebracht werden müßten, nämlich 400, würden die Medien Zeter und Mordio schreien. Reinhold Meßner, Fachmann für Extrembergsteigen, hat nach den beiden Todesfällen beim Zugspitzlauf gar ein Verbot solcher Extrembergläufe gefordert. Was sagt er eigentlich zu dem Risiko auf der Piste? Das ist doch im alpinen Skilauf weit größer als beim Berglauf. Wer an einem Marathon teilnimmt, hat im allgemeinen ein ordentliches Training absolviert. An Bergläufen und gar einem Extremberglauf nehmen durchweg erfahrene Läufer und Berggänger teil. Vom alpinen Wintersport kann man auf keinen Fall sagen, daß hier alle Könner sind. Und was hülfe dies? Gerade bei den Könnern – das zeigt auch der Zusammenstoß des sportlichen Ministerpräsidenten mit einer Sportlehrerin – verschärft sich das Risiko erheblich. Hinzu kommt, daß ein Teil der nachmittäglichen Abfahrten nach Alkoholgenuß stattfindet. Man stelle sich vor, an den Autobahn-Raststätten würde fleißig „Jagatee“ ausgeschenkt! Angeheitert kann man nicht laufen, sehr wohl aber alpin Ski laufen, ja, die natürliche Angstbremse wird durch Alkohol stillgelegt.
Die Probleme im alpinen Wintersport sind bekannt, und man muß den Fachverbänden auch attestieren, daß sie sich um die Sicherheit auf den Pisten und um die Aufklärung des Skifahrervolks bemüht haben, ebenso sind die Touristiker in den Wintersportgebieten um die Sicherung der Abfahrten bemüht. Niemandem ist entgangen, daß sich der tödliche Unfall und die schwere Verletzung des Ministerpräsidenten Althaus an einer Stelle ereignet haben, an der unübersehbar zum Langsamfahren aufgefordert wird. Offenbar hat sich der Unfall durchaus nicht bei hoher Geschwindigkeit ereignet; auf den Pisten werden manchmal Geschwindigkeiten von 70 km/h erzielt. Die Skiläuferin hatte kurz zuvor einen Halt eingelegt, und der Ministerpräsident ist für sein Risikobewußtsein, das für einen Sporttaucher wie ihn lebensnotwendig ist, bekannt. An diesem Unfall erkennt man, welche Folgen eine Kollision selbst bei gemäßigter Geschwindigkeit haben kann. Kein Medium hat versäumt darauf hinzuweisen, daß die Skiläuferin im Gegensatz zu Althaus keinen Helm getragen habe. Beim Radfahren hat sich das Tragen eines Helms durchgesetzt, auf der Piste noch nicht. Der Helm hat offensichtlich dazu beigetragen, daß Althaus überlebt hat, aber auch der Helm hat das schwere Schädelhirn-Trauma mit Hirnblutung nicht verhindern können. Macht Sport eigentlich noch Vergnügen, wenn man ihn wie beim Eishockey nur noch in moderner Ritterrüstung ausüben kann?
Noch ein Seitenblick auf den Zugspitzlauf. Die Tatsache, daß die Staatsanwaltschaft gegen den Veranstalter ermittelt, ist von Ahnungslosen als ein Indiz für angebliche Verantwortungslosigkeit des Veranstalters genommen worden. Auch im Falle des tödlichen Zusammenstoßes ermittelt die Staatsanwaltschaft, und zwar, da kein Verstoß der Pistenbetreiber gegen die Verkehrssicherungspflicht vorliegt, gegen den überlebenden Unfallbeteiligten. Sie muß es tun, so wie sie es nach dem Zugspitzlauf tun mußte.
Die schwerwiegenden Folgen der Kollision zwischen dem thüringischen Ministerpräsidenten und der slowakischen Skiläuferin führen uns den Wandel des Skilaufs von der einfachen Fortbewegung im Schnee bis zum hoch anspruchsvollen Sport vor Augen. Die Präparierung der Pisten, die Optimierung der Abfahrten, die Härte der gewalzten Pisten, die Verfestigung der Schneeauflage aus Schneekanonen, die Entwicklung des Geräts, die immer höhere Geschwindigkeiten erlaubt, vielleicht auch die Verbesserung der Technik – all das erhöht im Falle eines Sturzes oder eines Zusammenpralls die Folgen.
 |
Als Kind und Jugendlicher habe ich im Riesengebirge erlebt, wie einst Ski gelaufen wurde. Mein Onkel Hans, ein Turner, stapfte mit Fellen an den schweren Eschenski bergan. Im Telemark bewegte er sich, gebremst durch Tiefschnee, zu Tale. Die Zahl der Skifahrer war überschaubar. Damals wollte ich gern Skilaufen lernen und holte mir aus der Stadtbücherei Anleitungsbücher, deren beschriebene Technik aus Skandinavien kam. Ich habe gestern Wilhelm Paulckes frühe Darstellung „Der Skilauf“ aus dem Jahr 1902 wieder gelesen. Offenbar gab es damals schon im Zuge beginnender sportlicher Differenzierung eine Auseinandersetzung zwischen dem nordischen Skilauf und den Anhängern eines spezifisch alpinen Skilaufs, der Lilienfeld-Methode. |
|
| Skilauf vor 125 Jahren, eine nostalgische Demonstration aus dem Jahr 1984 |
Mir ist heute, nach Jahrzehnten, klar, daß die Lektüre meiner Jugend meine Vorstellungen vom Skilaufen geprägt hat. Damals blieben Telemark und Christiania leere Begriffe für mich. Meine Eltern konnten mir keine Ski und keine Skischuhe kaufen, das wäre Luxus gewesen. In den Jahren nach dem Krieg mußten andere Anschaffungen den Vorrang haben. So kam es, daß ich erst, als ich auf die Vierzig zuging, im Winterurlaub in Österreich Skilaufen lernte. Doch meine vom nordischen Skilauf geprägten Vorstellungen aus der Jugend wurden enttäuscht. Schon in den sechziger Jahren hatte sich ein regelrechter Wintersportbetrieb mit Aufstiegshilfen und glattgewalzten Pisten herausgebildet. Ich machte zwar mit, aber mit den Jahren wuchs das Unbehagen.
| Mit Naturerlebnis hatte das Ganze nichts mehr zu tun; in der Schlange Anstehen zum Lift, in und an den Bergrestaurants Massen von Menschen. Ich gewann den Eindruck, daß sich alpine Skiläufer vergleichsweise rüde benehmen. Da ich ein mäßiger und obendrein vorsichtiger Skiläufer war, irritierten mich die anderen, die in einem Mordstempo an mir vorbei schossen. Die Skiorte hatten sich aus verwunschenen Dörfern in mondäne Laufstege verwandelt. Ich paßte irgendwie nicht dazu. Anzusehen war mir das schon an meiner von Jahr zu Jahr mehr veraltenden Ausrüstung. Mein Wintererlebnis änderte sich erst, als ich den Skilanglauf entdeckte. Zunächst teilte ich den Tag: vormittags Abfahrten, nachmittags auf die Loipe. Schließlich stellte ich die Abfahrtsski gänzlich in die Ecke. Ich hatte auch im Wintersport meine Identität gefunden. |  |
|
| Wintersportliche Identität gefunden: Beim Engadiner Skimarathon 1981 |
Es ist nicht so, als gehe es mir wie dem Fuchs, der die Trauben, die er nicht erreichen kann, zu sauer findet. Ich bewundere die Eleganz, mit der viele über die Buckelpisten gleiten, ja, schweben; manche von ihnen hätte ich im Alltagsleben niemals als so sportlich eingeschätzt. Ich kann ermessen, welches Vergnügen es bereitet, den Hang hinunter zu gleiten, sich dem Terrain anzupassen, sich seiner Flexibilität und seines Koordinationsvermögens bewußt zu werden, die Geschwindigkeit zu erleben, unten dann geradezu die Wirkungen der Adrenalin-Ausschüttungen zu spüren. Doch das Ambiente des alpinen Wintersportbetriebs sagt mir nicht zu.
| Als Wanderer sehe ich im Hochgebirge die durch die Liftanlagen und die Vernichtung der Vegetation verwüsteten Hänge. Wo freiliegende Wanderwege den Hang queren und eine beglückende Fernsicht gestatten, stehen Schneekanonen. Und ein ganzes Hochtal wird durch die an eine Raumstation erinnernde Liftstation, womöglich noch mit der Reklame vom letzten Winter, verschandelt. Da frage ich mich, ob der Preis für das winterliche Skivergnügen nicht zu hoch ist, ganz abgesehen von der volkswirtschaftlichen Belastung durch die Folgen der Pistenunfälle. |
 |
|
| Meine Skischuhe aus den sechziger Jahren. Darin konnte man sich auch ohne Ski bewegen |
Ich frage mich das auch jetzt wieder, wenn mir ein solcher Unfall wie in der Steiermark, der nur durch die Persönlichkeit eines der Beteiligten Aufsehen erregt hat, das persönliche Risiko vor Augen führt. Anders als im Straßenverkehr, wo die aktive und die passive Sicherheit der Fahrzeuge zu einem Rückgang der Zahl der Todesopfer beigetragen hat, läßt sich die Sicherheit auf der Piste nur sehr eingeschränkt verbessern. Das Schild „Langsam - slow“ genügt offenbar nicht. Der Helm läßt einen vielleicht überleben; doch nach wie vor ist der Körper die Crashzone.
Sollte der gern und in falschem Zusammenhang zitierte zynische Ausspruch eines Politikers, der in jungen Jahren ein erfahrener Sportsmann war, doch stimmen? Nämlich Churchills Antwort auf die Frage, wie man ein hohes Lebensalter erreiche: „No sports!“ Gewiß, es ist wie jede Zuspitzung nur die halbe Wahrheit. Aber wie im Straßenverkehr mit dem hochmotorisierten und sicherheitsoptimierten Auto sollte man auch als erfahrener Wintersportler nicht alle vorhandenen Möglichkeiten ausnützen wollen, wenn man überleben will.
| Zu weiteren Tagebuch-Eintragungen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | |
| 2016 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2015 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2014 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2013 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2012 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2011 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2010 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2009 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2008 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2007 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2006 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2005 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2004 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2003 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2002 | Alle Eintragungen HIER | |||
| Zurück zur den aktuellen Eintragungen HIER | ||||
| Zu weiteren aktuellen Inhalten bei LaufReport.de | ||||