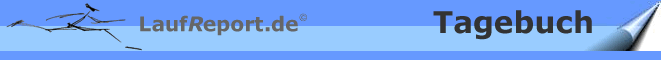

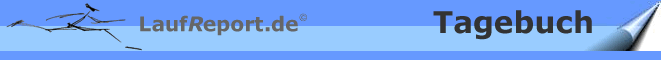  |
|
Laufen, Schauen, Denken Sonntags Tagebuch |
 |
Ich kann in einem Tagebuch nicht so tun, als ob ich nicht gelesen hätte, was in diesen Tagen zu meinem Geburtstag über mich geschrieben worden ist. Jeder Mensch, wenn er sich nicht gerade als tibetanischer Mönch ins Nirwana versenkt, braucht soziale Anerkennung. Ein Teil der Probleme im Arbeitsleben – Mobbing, innere Kündigung, Sozialneid – rührt sicherlich von fehlender Anerkennung her. Was ist die Siegerehrung nach dem Wettkampf denn anderes als die soziale Prämiierung des Strebens nach Anerkennung. Der Narzißmus, der allen Menschen eigen ist, kann sich steigern, ins Lächerliche oder ins Pathologische; man nennt das dann umgangssprachlich Eitelkeit. Einige Berufsgruppen sind besonders empfänglich für narzißtische Übersteigerungen. Bühnenkünstler und Showtalente, versteht sich, Politiker, ja und dann Journalisten und Schriftsteller. Wir sind eitel. Doppelt schlimm, daß ich eine Zeitlang Amateur-Schauspieler („Bühne der Jugend“ in Görlitz) und Schreiber war. Bei denjenigen Schriftstellern, die sich zurückgezogen haben und nicht mehr publizieren, weiß man nicht so recht, ob es nicht eine besondere Form von Eitelkeit ist, sich schweigend über andere zu erheben: Seht her, ich habe es nicht nötig, mich weiterhin mit dem Leserpack abzugeben! Ein Autor mag für sich selber schreiben, aber wenn er publiziert, will er gelesen werden. Anderenfalls könnte er das, was er geschrieben hat, verbrennen (Kafka gehörte zu dieser Sorte). Wir wissen, wie sehr deutschsprachige Emigranten in den USA gelitten haben, weil sie keine Leser hatten. Ich bekenne mich also dazu, daß mir all die wohlgemeinten, selbst die übertreibenden Äußerungen über mich wohltun. Allenfalls, daß ich auch diese Äußerungen hinterfrage: Was ist zu dick aufgetragen? Oder: Bleibe ich nicht hinter den Ansprüchen, die an mich gestellt werden, zurück? Wobei auch dabei wieder eine Gefahr auftaucht: Ist es nicht eine besondere Form der Eitelkeit, wenn man sich ziert, Anerkennung entgegenzunehmen? Fishing for compliments nennt man das, wenn jemand sich kleiner macht, um damit Widerspruch, nämlich vermehrtes Lob zu provozieren. Wer schreibend den Dialog mit der Öffentlichkeit sucht, bewegt sich auf einem schwierigen Feld.
Was hat das mit mir zu tun? Niemals hatte ich, der Unsportliche, der seine Bewegungsaktivität gar nicht als Sport ansah, mir vorstellen können, daß ich auf sportlichem Gebiet dermaleinst Profil erwerben würde. Vielleicht hat mir gerade das zu einer kritischen Distanz auch zu meiner eigenen Aktivität verholfen. Lange Zeit wollte ich gar nicht wahrhaben, daß ich mich ungewollt im Laufsport zwar profiliert hatte. Vielleicht auch wieder eine besondere Form der Eitelkeit: Ich bin doch nicht darauf angewiesen, daß ihr mich beklatscht, weil ich die und die Leistung vollbracht habe. Inzwischen versuche ich, gerecht zu sein, sogar gegen mich selbst. Ja, ich habe mich nach Kräften bemüht, den Laufsport publizistisch und, soweit mir das möglich war, durch die eigene, im Alter beispielhafte Leistung zu fördern, weil ich Laufen nicht als beliebige Sportart, sondern als Mittel der Lebensbewältigung angesehen habe. Ja, ich habe immer versucht, auch in der sachlichen Laufreportage, von der 1:0-Berichterstattung wegzukommen. Deshalb bin ich Behauptungen, ich sei Sportjournalist, immer entgegengetreten. Ich wollte kein Sportjournalist sein, weil mir die Sportteile, die allein um Leserinteresse und Leser-Emotionen buhlen, nicht gefallen. Ich wollte auch kein „Fachidiot“ sein; es gibt bei weitem Kompetentere, die über das Laufen schreiben. Meine Absicht war, Bezüge herzustellen – Laufen als philosophisches und psychologisches Thema. Daß ich dafür nicht die formelle Ausbildung vorweisen konnte, muß man mir nicht vorwerfen. Das hat nicht an mir gelegen, dem Jahrgang 1926, der in den Krieg geschickt wurde, zu jung, um wirklich einen Bildungsabschluß nach heutigem Maßstab zu haben, und innerhalb kurzer Zeit zu alt, um Bildungsabschlüsse ausreichend nachzuholen. Wir gehören nicht zur „Flakhelfer-Generation“, die einfach mal Pause hatte und sich wieder auf die Schulbank setzen konnte. Wir „älteren“ Abbrecher sind Autodidakten geblieben. Das hat uns zwar den Berufsweg erschwert, aber auch vor Erstarrung bewahrt. Wir konnten uns nicht hinter einem Titel verstecken, sondern mußten uns täglich bewähren und vorführen, daß wir auch ohne Examina den Ansprüchen genügen. Wieder ein Trost für Schüler mit Problemen, aber auch ein Ansporn.
Ja, ich bin ein Mensch, der für die damalige Zeit relativ früh zum Laufen gefunden hat – nicht mein Verdienst –, und darüber nachdenkt. Ja, ich habe Gedanken geäußert, die zuweilen der Zeit voraus waren. Aber sie entsprachen nicht dem wissenschaftlichen Komment. Bei jedem Lob, jeder Würdigung, jeder Anerkennung weiß ich, daß ich sie irgendwo verdient habe, und frage mich gleichzeitig, ob ich nicht weit hinter den Voraussetzungen einer Anerkennung zurückgeblieben sei. Aber gilt das nicht für viele? Ich komme zu der Erkenntnis, daß Laufen uns zu realen Einsichten über uns selbst verhilft. Laufen als – zumindest hier von schlechtem Geschmack, zitiere ich mich selber – narzißtische Homöostase. Wir werden auf den Boden der Realität zurückgeführt, aber am Ziel gleichzeitig aus dem Staub, in den es uns geworfen hat, erhoben.
| Diese Einstellung hat es mir erleichtert, eine Ehrung der besonderen Art zu empfangen, ohne weder verschämt noch eitel zu sein – so hoffe ich wenigstens –, die Ehrung durch eine Festschrift. Ein Fest hat zwar zu meinem Geburtstag nicht stattgefunden, aber vielleicht ist die Festschrift auch keine, sondern nur der geburtstägliche Anlaß einer Reflexion über die 100 Kilometer von Biel. Ich war auf jeden Fall überrascht und erfreut. Dr. Stefan Hinze und Herbert Hausmann, Präsident und Vizepräsident der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung, haben mich besucht und mir eine Anthologie von Biel-Reflexionen überreicht: „Irgendwann warst du in Biel“. Eine Anzahl von Läuferinnen und Läufern, vornehmlich solchen, denen ich etwas bedeutet habe, haben niedergeschrieben, wie sie die 100 Kilometer von Biel erfahren haben. Den Ansatz finde ich originell. Vielleicht haben die Freunde von der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung ebenso empfunden. Sie wollen den individuell gemeinten Band in einer kleinen Auflage jedermann zugänglich machen. Es sollte mich freuen. |
 |
Und nun Schluß mit der Nabelschau! Ich will gleich niederschreiben, was sich mir in diesen Tagen aufdrängt.
Vernünftig ist es nicht, 380 Kilometer weit zu fahren, um 1700 Läufer starten zu sehen, nachts etlichen Dutzend zu begegnen und sie anderntags am Ziel eintröpfeln zu sehen. Keine Große Oper im Amphitheater, kein Stierkampf, 380 Kilometer nur zu einem 100-km-Lauf, an dem man nicht teilnimmt... Was ist am Laufen vernünftig? Gesundheitssport selbstredend, aber Marathon oder 100 Kilometer? Ich war zum Zuschauen verdammt. Gewiss, es ist schmerzlich, passiv zu sein, während doch alle Fasern nach Teilhabe drängen; aber nun bot sich auch die Chance, den Bieler Hunderter, den ich 31 Mal gelaufen und gegangen bin, erstmals von außen zu betrachten. In den achtziger Jahren hatte ich das Bedürfnis, den Hunderter auf der anderen Seite zu erleben. Ich setzte mit der Anmeldung ein Jahr aus, fuhr hin und schaute mich um. Und da kamen sie alle, holten sich ihre Startnummer oder meldeten sich an. Und ich gehörte nicht dazu? Das ertrug ich nicht. Laufsachen hatte ich ohnehin im Auto – welcher Zufall! Ich meldete nach.
| Diesmal war ich gezwungenermaßen Zaungast. Ich hätte fernbleiben können. Andererseits war das Zuschauen eine Kompensation für die Versagung. Allerdings, so wie ich es getan habe, werde ich es nicht wieder tun. Ich stellte es mir nach der Streckenerfahrung zu einfach vor, mit dem Auto punktuell die Strecke anzusteuern. Doch ich hatte trotz Navigationssystem mehr mit der Orientierung zu tun als mit dem Lauf. Als Fahrradbegleiter ist man der Strecke näher. Das bleibt mir bis auf weiteres ebenfalls versagt. Außerdem steht es einem schlecht zu Gesicht, der die überhandnehmende Fahrradbegleitung kritisiert hat. |
 |
Am Startplatz, wo die Coaches coachten, hatte ich den Eindruck, gleich werde ein Radrennen ausgetragen. Immerhin, die Radfahrer werden an den kritischen Stellen kanalisiert, so am Start, bis Aarberg und am Emmedamm. Erstmals habe ich einen Hunderter-Start beobachtet – von dem erhöhten Standpunkt eines Armee-Anhängers aus. Es war für mich beeindruckend, über 1700 Läuferinnen und Läufer strömten vorbei. Im Gegensatz zu einem Stadtmarathon vollzog sich der Start verhalten, nicht nur unter dem Aspekt der Geschwindigkeit, sondern auch der Emotion. Ultraläufer brüllen nicht herum, sie haben Bescheidenheit gelernt. Das Ende der drei Startfelder ziemlich ausgefranst – dort ließ man sich Zeit. Ultraläufer behalten auch hinten die Nerven.
 |
Schon in Biel an der Strecke zu stehen, darauf verzichtete ich. Lieber fuhr ich gleich nach Aarberg. Doch da ich noch den Marathonstart abgewartet hatte, erreichte ich die Spitze nicht mehr. Aber ich erlebte die unvergleichliche Atmosphäre bei der Brückenpassage und auf dem nächtlichen Marktplatz. Hier offenbart sich am deutlichsten der Volksfestcharakter eines solchen Ultralaufs. Ich habe das Erlebnis wie in früheren Laufjahren gehabt, denn in den letzten Jahren waren die Brücke und der Marktplatz, wenn ich kam, ziemlich leer. |
In Oberramsern wollte ich am Ziel des Marathons stehen. Doch ich wurde durch eine weiträumige Absperrung abgeblockt. Und von der gesperrten Straßeneinmündung, auf die mich das Navigationssystem mit ziemlichen Schlenkern gelotst hatte, eine unbekannte Distanz nach Oberramsern zu gehen, mußte ich mir ersparen. Dafür hielt ich mich lange in Kirchberg auf, nachdem ich zunächst orientierungslos umhergeirrt war. Denn das System beschrieb mir zwar den Weg in den Ort, wußte aber nicht, daß ich zum Sportgelände wollte. Als ich mich in den siebziger Jahren in der Station Kirchberg umgesehen hatte, glaubte ich, nach einer mittelschweren Katastrophe in ein Lazarett gelangt zu sein. Jetzt erblickte ich eine normale Verpflegungsstation, und niemand wankte zu den Liegen. Diejenigen, die jetzt hier eintrafen, sahen nicht im entferntesten so aus, als hätten sie 56 Kilometer in den Beinen. Zwar wechselten etliche das Trikot, andere aber zog es sehr rasch weiter. Manche sah ich gar im Laufen einen Becher ergreifen wie bei einem Stadtmarathon und davoneilen. Eine Stunde später – wieviel doch eine Stunde ausmacht! – ein anderes Bild. Niemand konnte davoneilen. Wer erstmals die Strecke lief, dem war die Orientierung verstellt. Obwohl genügend Platz ist, blieben die Läufer stehen, wo sie gerade waren; Coaches gesellten sich dazu und bildeten Barrieren. Die Stafettenläufer, die ja allesamt nahezu in Halbmarathon-Geschwindigkeit liefen, wußten nicht weiter. Manche, die offenbar den Kurs kannten, zogen es vor, sich durch parkende Fahrzeuge, die sich wenigstens nicht bewegten, den Weiterweg zu suchen. Erst als Außenstehender erkannte ich den Mangel. Mein Vorschlag wäre zu kanalisieren: eine breite Gasse am Verpflegungsstand vorbei, und Coaches wie diejenigen Läufer, die sich mit ihren Coaches austauschen wollen, in eine Fläche außerhalb des Laufkanals zu verweisen. Der den Unterlagen beigefügte Umwelt-Hinweis könnte um einen Satz erweitert werden. Schlimmstenfalls sollte ein Ordner – der Verpflegungsstand muß ja nicht ständig besetzt sein – dafür sorgen, daß ein Kanal zum Laufen freigehalten wird. Es ist ja grotesk, wenn sich ein Läufer, der die Strecke offenbar nicht kannte, angesichts der Knäuel vor dem Verpflegungstisch nach dem Weiterweg erkundigt.
In Biel hat man bisher immer sehr rasch auf Anregungen reagiert. Die hervorragende Organisation habe ich auch als Beobachter wahrgenommen. Am Ziel, welcher Unterschied zu den Dampfplauderern, die keine Ahnung, dafür ein flüssiges Mundwerk haben, zu den Bieler Sprechern, die nach Möglichkeit jeden Läufer, jede Läuferin namentlich begrüßen! Eine großartige Leistung, bei der jeder späte Ankömmling noch geadelt wird.
| In Kirchberg trug ich vier Kleidungsschichten übereinander. Die sommerliche Temperatur war nachts auf 9 bis 10 Grad Celsius abgesunken. Am Tage stieg sie wieder auf sommerliche Hitze. Es gehört schon starkes Selbstvertrauen dazu, die Nacht durch im ärmellosen Trikot zu laufen. Diesmal stellte sich wieder das idealtypische Bild des Bieler Hunderters ein, dazu noch beinahe Vollmond. Jemand fand, in Biel sei immer so schönes Wetter. Bei anderer Gelegenheit habe ich das genaue Gegenteil gehört: Beim Bieler Hunderter sei immer schlechtes Wetter. So können sich die eigenen Erfahrungen in der Charakteristik niederschlagen. |
 |
In Büren an der Aare hätte ich gern gefrühstückt. Das eine Restaurant hatte noch nicht geöffnet, beim anderen gab es zum Kaffee nur ein Croissant. Mittags war ich wieder hier, genau um 14 Uhr, eher konnte ich wegen einer Verabredung am Ziel nicht. Da wollte ich einen Salat essen. Bei dem einen Restaurant wurde mir bedeutet, die Küche sei nun geschlossen, das andere war ein thailändisches. Flexibilität scheint sich in der Gastronomie erst dann einzustellen, wenn es schlecht geht. Das ist in der Schweiz nicht anders als in Deutschland. Da ich in Büren während des Essens Läufer beobachten wollte, setzte ich mich ohne Essen auf eine öffentliche Bank. Mir schwebte vor, aus der Beobachtung eine Typologie der späten Läufer zu entwickeln, zum Beispiel zügige Marschierer, die sich von vornherein auf das Wesentliche beschränken, die Bewältigung der Strecke, dies aber von Anfang an mit strenger Konsequenz. Dann die Dickbäuchigen, die keine andere Möglichkeit haben, als sich im hinteren Feld durchzuschlagen. Die Gruppenmitglieder, die inneren Halt in der Gemeinschaft suchen; wenn sie den Anschluß verlieren, sind sie verloren.
|
Die Angeschlagenen vor allem; ihr Leiden steht ihnen ins Gesicht geschrieben, ihre Körperhaltung verlautbart Schmerz. Viele hier haben innerlich aufgegeben, sie erfüllen nur noch das Pflichtpensum. Andererseits, so sagte ich mir bei dem Versuch einer Typologie, sind es die Charakterstarken, die trotz sportlicher Aussichtslosigkeit durchhalten. Hier hinten sind kaum noch Radbegleiter zu finden, Pacemaking mit dem Rad – dies nicht zu knapp – findet anderwärts statt. Auch ohne vereinzelte Läufer wäre es schön gewesen, an der Aare zu sitzen, was man auch ohne Angel tun kann. |
 |
Im Ziel hingegen widmete ich mich, versteht sich, den Einlaufenden. Da war eh noch Bildkapazität auf dem Film. Ein Bild habe ich versäumt. Während ich 100 Meter vor dem Zieleinlauf an dem Laufkanal stand, näherte sich Helmut Urbach samt Begleiter. Er hielt auf diesen letzten Metern inne, um mich zu begrüßen. Es machte mich verlegen. Jemanden vom Laufen abzuhalten, ist schließlich das letzte, was ich tun wollte.
An der Bushaltestelle, erzählte mir Marianne, habe sich eine Gruppe von Fahrgästen über die Fußball-Weltmeisterschaft unterhalten. Tenor: Gibt es denn nichts anderes als Fußball! Marianne wußte, daß sie mir mit dieser Mitteilung eine Freude machte. Die WM ist allgegenwärtig. Die Kommunen, auch die, in der ich wohne, heften sich an den Fußball. Sie sind nicht in der Lage, ihre Straßen zu reparieren, aber für Spektakel im Zusammenhang mit der WM wird Geld lockergemacht. Bei uns hat man eigens einen Fachmann bestellt und mit einem Werksvertrag bestallt, der die Spektakel organisieren soll – Fachmann vermutlich deshalb, weil er als Vereinsmanager seinen Turnverein in die Miesen geführt hat. All das, was an Arbeitsplätzen und Arbeitsverträgen geschaffen worden ist, kann nicht von Dauer sein; die vielzitierte Nachhaltigkeit, hier wird sie ad absurdum geführt. Für all die Investitionen, vom Fan-Festzelt auf dem Lande bis zum Fußballstadion in München, muß jemand zahlen. Die FIFA tut es bestimmt nicht. Erst die Mittel für den Traum von Olympischen Spielen im Land, nun die reale Fußball-Weltmeisterschaft... Brot und Spiele, sprich: Sozialhilfe und Weltkickerschaft. Das Volk will es so. Das Volk? Ich habe irgendwo gelesen, 25 Prozent hätten mit der Weltmeisterschaft nichts am Hut, die Immigranten ohnehin nicht. Früher hat Mut dazu gehört, sich zum Fußball zu bekennen. Der feine Sport der dreißiger Jahre war Tennis, Fußball war eine Sache der Proleten, und die Intellektuellen rümpften die Nase. Heute gehört Mut dazu, sich als Verächter des Fußballs zu bekennen, selbst unter Intellektuellen.
Weshalb bin ich ein Verächter? Es ist nicht nur das kindliche Trauma, als mein Vater Schiedsrichter war. Seit der Nazizeit verabscheue ich die Massen. Das heisere Gegröle in den Stadien wie aus einem Munde erinnert mich zu stark an die von Goebbels und seinen Helfern organisierten Kundgebungen. Ich mag selbst beim Stadtmarathon keine Sprechchöre. Es heißt, Hitler, der ja alles nur übernommen hat, Positives wie die Autobahnen und Negatives , die Konzentrationslager der Engländer im Burenkrieg, und Goebbels hätten sich bei den Inszenierungen von Kundgebungen am Fußball der zwanziger Jahre orientiert. Die Kommerzialisierung des Fußballs tut ein übriges. Millionen von Euro werden hin und her geschoben, allein um einen einzigen Spieler. Vereine verschulden sich, um in dem Kapitalismusspiel mitspielen zu können. Die Prämie für den Sieger des Gutenberg-Marathons in Mainz, den das dort ansässige ZDF favorisiert, betrug 2600 Euro. Dies bei einem Lauf , der dazu beiträgt, daß die Deutschen sich von ihren faulen Ärschen erheben. Niemand schämt sich. Es sind ja bloß farbige Afrikaner und Spargelstech-Europäer, die sich das bieten lassen müssen. Ich bin weit von einer Kommerzialisierung des Laufsports entfernt, aber wenn schon Kommerzialisierung, dann muß mit gleichem Maß gemessen werden. Fußball ist wie der Automobil-Rennsport schlicht überbewertet. Die Nation scheint fixiert zu sein auf Ballacks Wade – ist’s die linke oder die rechte? Man wird ja so mangelhaft informiert –, niemanden schert es, ob Martin Walser erkältet oder Günter Grass gestürzt ist. Die Nation der Dichter und Denker ist zu einer Nation der Kicker verkommen. Ich toleriere jeden Sport, jeden; aber in mir sträubt sich alles, wenn sich einige Sportarten zu Lasten der anderen im öffentlichen Bewußtsein profilieren.
Am Freitag fahre ich nach Biel, erstmals als Zuschauer. Ob sich die Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft auf die Zahl der Teilnehmer auswirkt?
Auf dem immer zugemüllten Schreibtisch fährt noch der Ausdruck einer Meldung aus Focus online herum – eine grausige Meldung. In meiner Zeitung habe ich sie nicht gefunden. In Sunrise, einem Vorort von Fort Lauderdale in Florida, trabte eine junge Frau auf einem Radweg entlang eines Kanals. Sie muß sehr dicht am Wasser gelaufen sein; ein Alligator griff sie an und fügte ihr fürchterliche Bißwunden zu. Infolge starken Blutverlustes und des Schocks sei die Läuferin sofort gestorben, bevor der Alligator sie ins Wasser gezogen habe, konstatierte ein Arzt. Aus dem Wasser wurde die Leiche durch Bauarbeiter geborgen. Die Meldung endet unfreiwillig zynisch: Alligator-Angriffe seien verhältnismäßig selten. Die Frau sei seit den vierziger Jahren, als mit den Aufzeichnungen solcher Alligator-Angriffe begonnen worden sei, das 18. derartige Todesopfer in Florida.
Spätestens jetzt sind auch Alligatoren in die Liste der für Läufer gefährlichen Tiere aufzunehmen. Hunde ohnehin – auch diese Angriffe sind verhältnismäßig selten, und doch geben sie regelmäßig Stoff für Laufzeitschriften und Läuferforen ab. Angriffe des Mäusebussards galten am Anfang der Laufbewegung als eher kurios; im Gegensatz zu Hunden haben sich die Bussarde nicht an Läufer gewöhnt. In der friedlichen Schweiz beabsichtigte eine Kuh auf der Weide, mich hinterrücks umzurennen. Wahrscheinlich hatten ein Wanderer und ich sie beim Weiden gestört. Obwohl ich ohne Rückspiegel gelaufen und gewandert bin, bemerkte ich den Angriff, weil die heftig bimmelnde Schelle die angriffslustige Kuh verriet. Ich wandte mich um und schwang meinen Stock (Merke: Man geht nicht mehr ohne Stock). Seither weiß ich, wie eine Vollbremsung bei Kühen aussieht. Für Unruhe in den Alpen sorgt ein pathologischer Bär. In Kanada, wo in den Rocky Mountains Begegnungen mit Bären nicht selten sind, bin ich mit äußerster Vorsicht und möglichst geräuschvoll gelaufen.
Furcht also ist in unbekannten und gefährlichen Situationen angebracht, Angst nicht. Dennoch hat auch Angst, die im Gegensatz zur Furcht ein unbestimmtes, bedrückendes Gefühl ist, ihre Funktion. Ohne Angst hätte ich vielleicht im Krieg nicht überlebt. Es ist ein Glück, daß die Menschheit nicht aus Helden besteht.
Auf meiner Laufstrecke, die ich nun gehe, entdecke ich immer wieder etwas, das mich zum Grübeln veranlaßt. In einem Aussiedlerhof – in den fünfziger und sechziger Jahren wurde Bauern nahegelegt, die enggewordenen Dörfer zu verlassen und sich inmitten ihrer Felder anzusiedeln, was zu einem betonierten Wegenetz führte und die Autos anzieht – in einem Aussiedlerhof also war ein Hofladen eingerichtet worden, richtig mit Schaufenster und Ladentür. In das hölzerne Wirtschaftsgebäude war eigens ein Stück Fachwerk eingebaut worden. Als ob man aus einem Aussiedlerhof einen alten Bauernhof machen könnte! Vom Feld wurde ein Streifen als Parkplatz abgezwackt. Seit einiger Zeit sind .Ladentür und Schaufenster mit hellem Papier abgedeckt; der Hofladen ist geschlossen. Als ich neulich meine Runde auf die Schlechtwetterstrecke verkürzte, kam ich an einem Gebäude der Raiffeisen-Genossenschaft vorbei; dort hatten wir unseren Gartenbedarf eingekauft und konnten uns, im Gegensatz zu den großen Gartenmärkten in lockerem Gespräch auch beraten lassen. An der zugeklebten Eingangstür dankt die Belegschaft der Genossenschaftsfiliale den Kunden für ihre Treue und wünscht ein glückliches Jahr 2006. Es gibt niemanden mehr, der das Plakat aktualisieren würde. Auch von der Nußschale aus kann man das Weltmeer betrachten, und die Eindrücke werden nicht falsch sein.
Eine faule Woche – nicht nur im Tagebuch. Vier Tage privat verreist und nicht im Freien gewesen. Es traf sich gut, daß die Tage von Unwetter und mehr noch von Unwetter-Drohungen beherrscht waren. Als ich am Montag wieder auf der Laufstrecke gehend unterwegs war, wurde ich prompt von Regenschauern ereilt. Beim Laufen hat man das Gefühl, dem Regen davonlaufen zu können, was zwar nicht geht, aber wenigstens den Eindruck hervorruft, etwas tun zu können. Wenn man geht und zu dünn angezogen ist, kommt man sich hilflos vor. Ich kürzte dort, wo es möglich ist, meine Gehrunde ab. Doch ich sehnte das Ende der Trainingsrunde herbei, wie sonst allenfalls einmal beim Marathon die Ziellinie. Das Unwetter war keine Ausflucht; darin wurde ich durch die Nachricht bestätigt: Marathon abgesagt, dies nicht am Nordkap, sondern in Mannheim, gelegen in der milden Rhein-Neckar-Region.
Trotz gekürztem Programm am Montag unternahm ich am Dienstag nur ein einstündiges Training, das mehr ein Spaziergang denn ein Gehtraining war. Ich hatte das Gefühl, es tun zu müssen. Mir war nicht gut. Richtig übel war mir auch nicht, ich hatte vom Vormittag an das Gefühl, mein Magen sei gereizt. Das wirkte sich auf das Gesamtbefinden aus. Ich vermute, nein, ich bin davon überzeugt, daß diese Reizung von den drei Medikamenten herrührt, die ich täglich nehmen muß. In meiner Situation halte ich mich daran. Vor einigen Jahren setzte ich mich über die Verordnung eines Betablockers hinweg, weil er mich beim Laufen empfindlich behinderte. Jetzt will ich mich um den erhofften Erfolg der Bypaß-Operation nicht betrügen. Es müssen die Medikamente sein, die mir zu schaffen machen. Ich nehme sie nach dem Frühstück ein. Gegen Abend verschwand das Unwohlsein. Ich habe den Eindruck, als würden die iatrogenen Wirkungen – so der Fachausdruck – unterschätzt. Von einer Spitzenläuferin weiß ich, daß sie sich mit Diclophenac, einem beliebten Symptomunterdrückungsmittel bei orthopädischen Beschwerden, den Magen ruiniert hat. Ob eine solche Bemerkung wohl als Geschäftsschädigung ausgelegt werden kann?
Jetzt mache ich mich auf den Weg zu der wieder zweieinhalbstündigen Gehrunde. Dazu ziehe ich Laufsachen an, obwohl ich die Runde auch in Straßenschuhen zurücklegen könnte. Marianne war froh, als sie mich, obwohl ich nicht laufen kann, zum erstenmal wieder in Laufsachen sah.
Die dpa-Meldung hatte ich auch gelesen. Daran, daß sie mir auch noch zugeschickt worden ist, erkenne ich, daß ihr Inhalt so manche Läuferin, manchen Läufer umtreibt. Ein vierjähriger Inder läuft Marathon, ja Ultramarathon. 65 Kilometer habe er in etwa 7 Stunden zurückgelegt.
Gutheißen kann das niemand. Aber die Machart der Meldung ist wieder einmal typisch. Ärzte hätten bei dem Kind nach dem 65-Kilometer-Lauf Unterernährung, Blutarmut, Bluthochdruck und Herzprobleme diagnostiziert; außerdem drohe ihm Nierenversagen.
 |
Aha, wer Marathon oder Ultramarathon läuft, spielt mit seiner Gesundheit. Unterernährung? Wieso eigentlich? Unterernährung hat nun wirklich nichts mit dem Laufen zu tun, sondern mit dem Essen. Da in Deutschland jedes fünfte Kind und jeder dritte Jugendliche übergewichtig sind, könnten diese doch nichts besseres tun, als Marathon zu laufen, und das Problem wäre behoben. Blutarmut mag zutreffen, das kennen wir insbesondere von Läuferinnen. Doch die Blutarmut rührt nicht vom Laufen her, sondern vom Mangel von Vitalstoffen. Bluthochdruck, der stellt sich nicht von selbst ein, erst recht nicht bei einem Kinde, da muß es eine Ursache geben. Es wäre eine sensationelle Erkenntnis, wenn man herausfände, daß exzessives Laufen zu Bluthochdruck führe; bisher weiß man nur vom Gegenteil. Was sind Herzprobleme bei einem Kinde? Rhythmusstörungen? So rasch stellen die sich bei Kindern nicht ein, es sei denn, es liege ein Geburtsfehler vor. | |
|
Auf der Lokomotive posieren vietnamesische Kinder. Sie
sind keinen Marathon gelaufen, aber für viele mögen sie „unterernährt“
wirken - so wie auf Photos aus den dreißiger Jahren auch die Kinder in
Deutschland.
|
Auch mir ist, erinnere ich mich, als Vierjährigem eine beträchtliche Leistung abgefordert worden; in diesem Alter mußte ich an einer Wanderung von Schmiedeberg im Riesengebirge, dem Wohnsitz meiner Großeltern, auf die Schneekoppe (1605 m) teilnehmen; auf der 1:50000-Karte komme ich auf ungefähr 15 Kilometer und grob gerechnet mindestens 1000 Höhenmeter; die 15 Kilometer waren auch wieder zurück zu wandern. An die Strapaze habe ich mich zwar manchmal erinnert; aber ich war auch stolz. Gewiss, man hätte bis Krummhübel auch mit dem Postautobus fahren können, doch man mußte sparen. Meine Eltern und meine Großeltern, die mich auf diese Wanderung mitnahmen, wollten mich weder quälen noch hatten sie irgend einen Ehrgeiz. Sie wußten einfach nichts anderes, was macht man mit einem Vierjährigen? Er wird es schon schaffen, er ist ja gesund und hat bisher alle Sonntagsausflüge klaglos mitgemacht.
Bei dieser Mentalität mußte ich auch auf den Fußballplatz an der Görlitzer Schenkendorffstraße, wo mein Vater wieder ein Spiel zu pfeifen hatte. Es war windig und kalt. Das Spiel verstand ich nicht; es war für mich langweilig, und ich fror. Möglicherweise rührt daher meine Abneigung gegen das Fußballspiel und den Kult, der damit getrieben wird. Die Kritik an Fußball-Kult und –Kommerz ist möglicherweise die Folge eines kindlichen Traumas.
65 Kilometer in 7 Stunden – auf die Schneekoppe und zurück war ich mit Sicherheit zeitlich länger unterwegs. Und zum Blick auf die Folgen von Strapazen: Wie viele Vierjährige mögen unter den 12 Millionen Deutschen gewesen sein, die aus den deutschen Ostgebieten flohen oder in der Mehrzahl vertrieben wurden? Gewiss wurden viele Vertriebene in Güterzüge verfrachtet, aber ein Teil – ich habe ihn in Görlitz ankommen sehen –war tagelang zu Fuß unterwegs; ein Zyniker könnte sagen: Das, was sie dabei mitschleppten, wurde ja ohnehin immer weniger. Unterernährung? Gewiss doch, aber nicht wegen der körperlichen Anstrengung, sondern weil es zu wenig zu essen gab. Blutarmut, Bluthochdruck, Herzprobleme, Nierenerkrankung? Die Generation der Flüchtlingskinder hat es offenbar überlebt.
Ernst van Aaken hat vor Jahrzehnten die täglichen Bewegungsstrecken von Kindern gemessen; er kam darauf, daß zu seiner Zeit gesunde Kinder im Spiel täglich 8 bis 15 Kilometer gelaufen sind. Heute würde er auf wenige hundert Meter kommen. Wer fragt da nach Übergewicht, Bluthochdruck und Herzproblemen? Dabei handelt es sich nicht um ein einziges Kind, sondern um eine Massenerkrankung, die Folgen von Fehlernährung, die noch zunehmen werden.
Die Meldung von dem kleinen Inder ist ein typisches Produkt des Journalismus heute. An einem von seinem Adoptivvater offensichtlich fehlgeleiteten Kind werden diffuse Schäden durch extreme Leistungen festgemacht. Ob man im Gegenzug in Indien die Horrormeldung zu lesen bekommt, daß in Europa die Kinder gemästet und damit krankgemacht würden? Dort, wo Kinder stundenlang zur Schule und zurück traben, relativieren sich Marathon- und Ultramarathonstrecken. 1985 berichtete die FAZ kommentarlos von einer fünf Jahre alten Inderin, die 20 Kilometer in 2:15 Stunden lief. Da steckt in der Tat auch eine Marathonleistung drin.
Es versteht sich, daß man sich fragen muß, wie pädagogisch es ist, Kinder dieses Alters zu solchen Leistungen anzuleiten, ja, auch nur, sie nicht davon abzuhalten. Doch wer redet davon, daß ehrgeizige Eltern in anderen Sportarten ihre Kinder, all die Eisprinzessinnen und Turnküken, zumindest psychisch überfordern? Nur wird das nicht als spektakulär wahrgenommen, sondern alle Welt preist die Leistung, ja, fordert sie sogar als Voraussetzung künftiger Karrieren.
Kinderlauf war bereits in den siebziger Jahren ein Thema. Allerdings war die jüngste Marathonläuferin – in den USA – „schon“ elf Jahre alt; sie lief 3:01 Stunden. Ernst van Aaken äußerte: „Diese Höchstleistungen sind nicht Ziel einer neuen Kinder– und Jugendsportbewegung, aber sie sind Marksteine und Hinweise, wie schwächlich durch unsere Bestimmungen der Gesundheitssport gehandhabt wird.“ Denn über Zwölfjährige entbrannte bei uns ein Streit. Die Eltern solcher „Frühstarter“ haben immer behauptet, daß sie ihre Kinder nicht zur Marathonleistung zwingen würden. Von Birgit Lennartz wissen wir, daß sie ihren Vater geradezu bitten mußte, auf die Marathonstrecke gelassen zu werden.
Marathon ist nur zu einem Teil eine physische Leistung. Die Langstrecke setzt eine einigermaßen gefestigte psychische Struktur voraus. Kinder und Jugendliche müssen sich erst dazu hin entwickeln. Die Teilnahme am Marathon setzt einen autonomen Entscheidungsprozeß voraus. Von Kindern ist dies etwa vom zwölften Lebensjahr an zu erwarten; bei der einen früher, bei dem anderen später. Erst von diesem Alter an „will“ man, wenn man denn will, aus eigenem Antrieb Marathon laufen und nicht, weil man dem Vorbild eines Elternteils folgen oder sich das Wohlwollen der laufenden Mutter, des laufenden Vaters erkämpfen will. Mit vier Jahren Marathon zu laufen, mag zwar physisch möglich sein, aber es ist wie in der Wissenschaft: Man muß nicht alles machen, was physisch oder technisch möglich ist. Unser Kernproblem ist allemal ein psychisches Defizit. Und das muß man nicht fördern.
Sechsmal bin ich meine Hausrunde von 11 Kilometern zügig – jedenfalls nach meinem Gefühl – gegangen. Erstaunliche Beobachtung: Beim zweitenmal ist es am schwersten. Erstaunlich deshalb, weil ich es von Mehrtage-Läufen her kenne; der zweite Tag ist immer die schwerste Etappe. Dann also ist auch nur das Gehen unter den gegebenen Umständen eine Herausforderung, und es hat einen Trainingseffekt. Gestern kam ich auf die Idee, auf dem Weg hinunter ins Körschtal 50 Meter zu traben. Ich wollte einfach das Gefühl fürs Laufen zurückbekommen und daher ganz ohne Anstrengung laufen. Ich hatte auf dem Gefälle das Gefühl, vornüber zu fallen. Für heute hatte ich mir vorgenommen, gezielt einige 50-Meter-Abschnitte zu laufen – ein Intervalltraining der besonderen Art. Fünfmal habe ich das gemacht. Jedesmal hatte ich gewartet, bis niemand in meiner Nähe war. Ich wollte mich nicht blamieren. Jedesmal war ich froh, als die etwa 50 Meter vorbei waren; einmal war der Laufabschnitt etwas länger. Nach dem Bewegungstraining heute hatte ich weiche Knie, etwa so wie früher nach einem Halbmarathon. Doch das Wohlgefühl hinterher war intensiver als nach dem Walking. Ob sich Walker um etwas bringen, obwohl viele genauso schnell sind wie langsame Läufer?
 |
Ich habe nicht nur gedacht, ich habe immer wieder geschaut. Meine Runde führt an Obstbaumwiesen entlang, „Gütle“ werden solche Grundstücke mit Streuobstbau genannt, obwohl der Unterschied zum „Gut“ etwa so groß ist wie der zwischen Hundehütte und Rittergut. Die Obstbäume auf den „Gütle“ stehen in voller Blüte. Wie bin ich froh, daß ich nicht jetzt ins Krankenhaus muß, sondern es hinter mir habe und den Frühling erleben darf, jedenfalls dort, wo er stattfindet. |
Dichter müssen früher viel mehr von Naturerleben erfüllt gewesen sein; wie sie den Frühling besungen haben – auf manchmal ganz naive Weise –, ist längst zu unvergänglichen Zitaten geworden. Vielleicht, weil der Frühling heute so selten besungen wird. Zeitgenössische Lyriker bewegen sich in Welten, die nur sie selbst so erleben und verstehen. Oder vielleicht das nicht einmal?
Ich kann mich nicht erinnern, einen Frühlingslauf so intensiv empfunden zu haben wie heute, als ich wieder, wenn auch nur auf Mini-Abschnitten, zum Laufen gefunden habe.
Der zweite Ansatz einer Eintragung. Den ersten vom 19. April habe ich abgebrochen, da habe ich nur Informationen notiert: Beim Gehtraining während der Anschlußheilbehandlung 60 Schläge Ruhepuls, nach 450 Metern in 5 Minuten 84 Schläge, höchste gemessene Pulszahl 108. Auf dem Ergometer 50 Watt, 11 Minuten, Trainingspuls maximal 83 Schläge. Wenn ich's überdenke, ist die Ausgangslage nicht so schlecht, auch wenn ich bei Spaziergängen das Gefühl habe, daß mir jede auch nur winzige Steigung Probleme macht. Es wird Zeit, daß ich nach Hause komme und auf der Standardstrecke die Ausdauer trainiere. Doch wenn ich eine Treppe steige, wird mir klar, daß ich für eine Laufstrecke längst nicht gerüstet bin.
Seit einer Woche bin ich nun wieder zu Hause. Eine Anschlußheilbehandlung ist kein Zweit- oder Dritturlaub, für den die Kur früher häufig mißbraucht worden ist. Wem eine Anschlußheilbehandlung verordnet worden ist, hat einen ernstlichen Krankenhausaufenthalt hinter sich. Das Verlangen nach Wiedererlangung der Autonomie ist groß. Auch mich hat es gedrängt, wieder nach Hause zu kommen. Mit Marianne habe ich Spaziergänge gemacht. Einer der Nachbarn drückte sein Erstaunen aus, daß ich mich Mariannens Gehstrecke angepaßt hätte. Dabei war es genau umgekehrt, sie hat sich meinem zunächst langsamen Gehrhythmus angepaßt. Gestern die erste „schnelle Einheit“, rasches Gehen über 5 bis 6 Kilometer. Heute bin ich erstmals auf die verkürzte Variante meiner Trainingsrunde gegangen. Zwei Stunden bin ich unterwegs gewesen.
Am Anfang Brustschmerz – das Herz? Aus dem Hineinhören in den Körper, das wir beim Laufen empfehlen, kann in solcher Situation offenbar Hypochondrie werden. Der Brustschmerz kam eindeutig von den durch die Operation mitgenommenen Muskeln. Nach einigen Kilometern verschwand er, dafür stellten sich an dem Bein, dem Venen entnommen worden sind, Narbenschmerzen ein. Auch nicht beängstigend. Die Steigungen auch nur zu gehen, fiel mir noch schwer. Alles in allem aber ein erfreulicher Tag, Grund zu Optimismus.
Dadurch, daß ich gehe, haben sich die Begegnungen verschoben – weniger Walker, mehr Läufer. Dabei hat sich an dem Zahlenverhältnis mit Sicherheit nichts geändert. Nur bin ich nun von allen Läufern der Strecke überholt worden, während ich vorher kaum Läufer, sondern die Walker überholt hatte. Jetzt habe ich gesehen, wer da alles läuft – Menschen, die offensichtlich keine leichtathletische Vergangenheit haben. Nicht daß ich auf sie herabblickte, sie sind mir Trost – so wie die laufen, müßte ich doch auch wieder laufen können... .
Es war geradezu peinlich. Ich habe am ersten Geh- und Lauftraining teilgenommen, von Laufen war allerdings nicht die Rede. In unserer kleinen Gruppe hatte ich die Aufgabe, viermal hintereinander 90 Meter in flottem Gehschritt zurückzulegen, 90 Meter in einer Minute. Abgesteckt und beschriftet waren zwischen 25 und 85 Meter. Doch mir mutete man mehr zu, man hatte ja einen Musterschüler, einen veritablen Marathonläufer, da sollten es schon 90 Meter sein. Irgendwie war das mit dem Marathon in die Krankenakte gelangt – natürlich, das war der Professor gewesen, der die Herzkatheteruntersuchung vorgenommen hatte, und selbst den Halbmarathon in 1:19 Stunden lief. Und nun wußte die junge Therapeutin, da ist einer dabei, der ist Marathon gelaufen. Reden wir nicht von der Zahl und erst recht nicht vom Ultramarathon! Marathon genügt, glücklicherweise ersparte sie mir die Peinlichkeit, mich den anderen als Musterschüler vorzustellen; aber sie selbst wußte Bescheid. Die Strecke war nicht das Problem, die Pulsmessung war es. In den siebziger Jahren hatte ich selbst in meinem Lauftreff bei anderen den Puls gemessen und Lauftrainern kluge Ratschläge gegeben. Später maß ich mir den Puls nur dann, wenn ein Anlaß bestand – nämlich nach einer besonderen Herausforderung. Und da war er unübersehbar. Um den Ruhepuls hatte ich mich nie gekümmert. Jetzt, in der kleinen Herzsportgruppe, war der Ruhepuls gefordert. Alle hatten ihn, nur der Musterschüler nicht. Ich rettete mich zunächst mit einem Scherz: Ich hätte keinen. Die Therapeutin maß ihn mir, 60 Schläge. Im Krankenhaus wurde der Puls täglich gemessen, auf Angaben der Kranken verließ man sich nicht. Insgeheim bewunderte ich die Schwestern, daß sie Zimmer auf, Zimmer ab bei jedem im Handumdrehen den Puls fanden. Einmal machte die Schwester ein bedenkliches Gesicht, mein Ruhepuls war auf etwa 50 gefallen. Von einem Marathonläufer wußte sie nichts. Nun, in der Kurklinik beim Gehtraining sollte ich nach der Gehstrecke abermals messen. Verdammt, ich fand meinen Pulsschlag noch immer nicht, weder am Handgelenk noch an der Carotis am Hals. Ihn zusammenzulügen, verbot mir mein Stolz. Und so spielte ich die Rolle des Musterschülers, der seinem Lehrer gestehen muß, er habe die Hausarbeit vergessen (was tatsächlich biographisch vorgekommen war). Die Therapeutin zählte in 10 Sekunden 14 Schläge, 84 also. Das schien mir wahrscheinlich.
Doch wie geht's weiter? Wenn ich meinen Puls weiterhin nicht finde? Ich werde versuchen, mich auf der Gehstrecke heimlich intensiver zu belasten. 110 Schläge, die müßten doch meßbar sein!
Auf den Tag genau sind es acht Wochen, daß ein Team mir das Brustbein der Länge nach aufsägte, mein Herz zum Stillstand brachte und zwei Arterienstücke, die ein anderes Operationsteam aus meinem rechten Bein gezogen hatte, am Herz aufnähte. Bypaßoperation nennt man das. Auf diese Weise ist bei mir eine etwa 50prozentige Verengung der Aorta, eine sogenannte Hauptstammstenose, unschädlich gemacht worden. Gleichzeitig ist dabei durch einen sogenannten Maze-Eingriff eine Abweichung des Herzrhythmus, das Vorhofflimmern, hoffentlich beseitigt worden (was sich noch herausstellen muß).
Ich will mich nicht interessanter machen, als ich medizinisch tatsächlich bin. Bypaßoperationen gehören zur Routine der Herzchirurgie; allein im Stuttgarter Herzklinikum, in dem ich am 6. Februar operiert worden bin, wird das 1000mal im Jahr gemacht. Es gibt aber auch keinen Grund, das Risiko zu verharmlosen. Wenn ich die Letalitätsrate der Herzchirurgie mit 1,8 Prozent auf den Marathon übertrüge, würde das bedeuten, daß von je hundert Marathonläufern fast zwei an ihrem Sport stürben. Wahrscheinlich würde dann die Teilnahme mit Sanktionen belegt. Grund genug also zu einiger Bänglichkeit. Weshalb unterzieht man sich dann einem solchen Eingriff?
Der Mensch ist eine Spielernatur. Vor die Wahl gestellt, nach einer bedrohlichen Diagnose ein, zwei Jahre mehr oder weniger fröhlich dahinzuleben und danach von einem Waldlauf nicht mehr heimzukehren, oder aber das Ende bis zu einem unbekannten Zeitpunkt hinauszuschieben, jedoch um den Preis eines Operationsrisikos, entscheiden sich fast alle für das medizinische Risiko, gewissermaßen für die Taube auf dem Dach statt für den Spatzen in der Hand. Präzise Diagnostik ist zugleich Segen und Fluch. Mein Großvater sank eines Morgens beim Aufstehen ins Bett zurück – tödlicher Schlaganfall. Er war 75 Jahre alt und galt als gesund, zumal da er auch noch dem Prießnitz-Verein (Prießnitz war ein Vorläufer Kneipps) angehörte. Niemand hatte ihn warnen können; die Diagnostik war noch nicht soweit, der Tod war schicksalhaft. Meine Nachbarin, die im vorigen Jahr aus einer Ruhepause während der Gartenarbeit nicht mehr erwachte, hatte eine bewußte Entscheidung getroffen. Sie hatte abgelehnt, sich den empfohlenen Herzschrittmacher einsetzen zu lassen. Sie wurde 85 Jahre alt. Wir anderen haben insofern Glück gehabt, als sie nicht am Lenkrad auf der Autobahn starb.
Mir ist klar, weshalb wir unser Gesundheitswesen nicht mehr finanzieren können. Die verbesserte Diagnostik produziert hohe medizinische Ausgaben. In meiner Gymnastikgruppe brüstete sich ein Herr, er habe einen Defibrillator eingepflanzt bekommen – Kostenpunkt etwa 20000 Euro. Mein Gesundheitslehrer Max-Otto Bruker (60jährige medizinische Praxis, keine Kassenzulassung) vertrat das Alternativkonzept: In eigener Verantwortung gesund zu leben, insbesondere dank Vermeidung schädlicher Industrieprodukte in der Ernährung, und nur dann einen Arzt zu konsultieren, wenn etwas weh tue! Das klingt ziemlich brutal, ist aber nur konsequent. Bruker starb im 92. Lebensjahr. Wenn ich überschlägig rechne, so habe ich in den über fünfzig Jahren, in denen ich ein Kraftfahrzeug besitze, für meine Motorisierung weit mehr Geld ausgegeben als für die Finanzierung meiner Gesundheit. Und dabei habe ich die Gesundheitssicherung immerhin selbst bezahlt, statt andere dafür aufkommen zu lassen.
Rational war alles geplant: Drei Wochen Krankenhausaufenthalt zur Operation, drei weitere Wochen zur Rehabilitation in einer Kurklinik. Ich schien alles im Griff zu haben. Anfang März konnte ich eine halbe Stunde spazierengehen. Doch aus den 25 Tagen Krankenhaus wurden 48 Tage, fast sieben Wochen Bettlägerigkeit. Zwei Tage vor Antritt der "Anschlußheilbehandlung", wie der Terminus der Krankenkassen heißt, hatte ich wegen stundenlanger Magenbeschwerden ärztliche Hilfe suchen müssen. Der ärztliche Wochenenddienst wußte auch nicht weiter, er wies mich ins Krankenhaus ein.
So ein Krankenhaus ist wie ein riesiger Öltanker, jedes Steuermanöver wirkt sich erst nach Stunden aus –, was sage ich, im Krankenhaus dauert es Tage. Eine Woche plagte ich mich vor den Augen des Personals, bettelte um Schmerzbeseitigung. Dann erst wirkten sich die Krankenhausmanöver aus, der Rundum-Check und eine knappe Woche künstlicher Ernährung. Aus einem kardiologischen Routine-Fall war ich ein internistisches Problem geworden. Magenspiegelung bis zum Zwölffingerdarm, Gallenstein, Gallenwegentzündung, Darmspiegelung, Einblutung einer bekannten Leberzyste – der Chef hätte sie gern operiert –, Operation einer Blasenhalssklerose. Schon machte auf der Station der Scherz die Runde, ich hätte nun bald jedes medizinische Angebot wahrgenommen, Kernspinto, von Röntgen und EKG nicht zu reden, versuchte Blasenspiegelung, drohende Legung eines neuen Blasenkatheters, Perspektive einer Prostataoperation ein Vierteljahr später. Eine Abteilung lernte ich – außer der Geburtshilfe – noch nicht kennen, die Psychiatrie. Es ist verdammt schwer, merkte ich, ein mündiger Patient zu sein. Den wichtigsten Rat erhielt ich von außen: Es sei sehr, sehr häufig, daß der Operationsstreß auf den Magen schlage. Niemand hatte mir das vorher gesagt. Immer wenn ich den Pyjama gegen ein kommunales Flügelhemd austauschen mußte – denn nacktärschige Patienten sind bei Bewußtseinsverlust offenbar leichter zu händeln –, wußte ich, daß mir wieder Schlimmes bevorstand. Das Krankenhaus hat den Rang eines akademischen Lehrkrankenhauses der Universität Tübingen. Als mich jemand lobte, bei der neuerlichen Öffnung der Halsschlagader (parenterale Ernährung) zum Zwecke der Nahrungszufuhr hätte ich mich tapfer verhalten, wußte ich, da hatte ein junger Doktor wieder an mir gelernt. Inzwischen weiß ich, daß es nicht genügt, den Schlauch eines postoperativen Blasenkatheters einfach durch die Bauchdecke zu stecken, ohne ihn dort zu befestigen; ich weiß, daß es unterschiedliche Ventile gibt, das eine verliert man am unpassenden Ort, das andere kriegt selbst die Schwester nicht auf. Wer redet von Apparate-Medizin, wir haben eine sehr menschliche Medizin!
Da nach vier Wochen schließlich alles untersucht war, die Magenschmerzen endlich doch aufhörten, die Urologie mit einem zugedrückten Auge grünes Licht gab, fiel niemandem etwas besseres ein, als mich am Montag, dem 27. März, nachdem ich das Wochenende noch auf Kassenkosten im Krankenhaus herumgegammelt hatte, zu entlassen.
Nun schreibe ich aus der Anschlußheilbehandlung, die ich, wie konnte es anders sein, mit einem aus dem Krankenhaus mitgebrachten Bronchialinfekt sowie mit völliger Appetitlosigkeit begann. Dabei las sich der Wochenspeiseplan der Kurklinik wie die Karte eines Gourmet-Restaurants. Im Widerspruch dazu stehen wie im Krankenhaus die Verwendung unter anderem von Glukamat und anderen chemischen Stoffen (Näheres bei Horst Grimm: "Die Ernährungslüge").
Heute habe ich Niedergeschlagenheit und Triumph erlebt. Ich unternahm die erste kleine Wanderung, dreieinhalb Stunden mit einem Höhenunterschied von etwa 250 Metern. Schritt für Schritt trippelte ich den Höhenweg zum Galgenberg hinauf, an fast jeder Serpentine verharrte ich einige Sekunden. Ein Läufer zog zügig an mir vorbei, nach hundert Metern war er entschwunden. Beim Abstieg merkte ich, daß ich mir einen Sonnenbrand zugezogen hatte. War die Frühlingssonne, bevor die Schwäbische Alb zweimal völlig einschneite, zu stark gewesen? Auf Sonnenbrand war man in der Klinik nicht eingerichtet. Zu Recht. Der Sonnenbrand war die Nebenwirkung eines Herzmedikaments. Dem Beipackzettel war zu entnehmen, man möge sich vor Sonneneinstrahlung hüten. Wer denkt auch an so etwas? Oder an den Grapefruitsaft. Jeden Morgen habe ich mir am Frühstücksbüfett ein Glas genommen, bis ich dem Beipackzettel entnahm, Grapefruitsaft mindere die Wirkung des Herzmedikaments. Versteht sich, daß ein Betablocker unter die Dopingbestimmungen fallen würde. Bis auf weiteres eine rein theoretische Überlegung. Wieso eigentlich wird mir, wenn ich nach dem Essen abrupt aufstehe oder eine Treppe hinaufgegangen bin, schwindlig? Nebenwirkungen von Medikamenten. So eigentlich hatte ich mir die Mobilisation nach siebenwöchigem Krankenlager nicht vorgestellt. Obwohl ich in der Reha-Klinik sicher zu den Ältesten zähle, komme ich mir unter lauter Krückengängern und rollenden Gehhilfen wie in einem Altenheim mit angeschlossenem Pflegeheim vor. Nein, verlängern werde ich den Aufenthalt hier nicht. Mich packt die Sehnsucht nach frischen Kreuzbandrissen statt seniler Arthrosen, Achillessehnenrupturen von Zwanzigjährigen statt Keramikhüften, und selbst die Meniskusoperationen von Fußballspielern – und das will bei mir etwas heißen – würde ich liebend gern in Kauf nehmen, wenn sich dadurch das Patientengut ändern ließe. Es scheint schwierig zu sein, bei Reha-Maßnahmen für herzoperierte Marathonläufer das passende Umfeld zu finden.
| Zu weiteren Tagebuch-Eintragungen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | |
| 2016 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2015 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2014 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2013 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2012 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2011 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2010 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2009 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2008 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2007 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2006 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2005 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2004 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2003 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2002 | Alle Eintragungen HIER | |||
| Zurück zur den aktuellen Eintragungen HIER | ||||
| Zu weiteren aktuellen Inhalten bei LaufReport.de | ||||