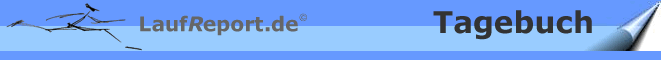

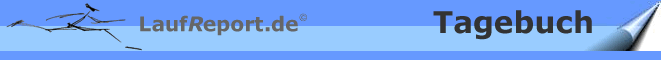  |
|
Laufen, Schauen, Denken Sonntags Tagebuch |
 |
Während des ganzen Winters habe ich mich keinem derartigen Schneefall auszusetzen brauchen wie am Mittwoch, dem Tag des Frühlingsanfangs. Doch lang dauerte die Beeinträchtigung nicht. Allerdings spürte ich körperlich den Wintereinbruch, ich fühlte mich auf den Trainingszustand vor etwa acht Monaten zurückgeworfen. Die 11 Kilometer bin ich überwiegend gegangen.
Am Anfang, als die Sonne noch schien, näherte ich mich einer älteren Dame, die sich mit Walkingstöcken ausstaffiert hatte. Ganz sanft setzte sie die Stöcke auf, geradeso, daß man nicht sagen konnte, sie zöge sie schleifend nach. Wer mag ihr gesagt haben, daß sie zu ihrem Spaziergang Stöcke brauche? Obwohl auch ich ging, überholte ich sie bald. Wenig später holte ich einen weiteren Spazierwalker ein. Wo sind jetzt die Besserwisser, die uns Läufern auf langsamen Trainingsrunden mehr oder weniger hämisch „Schneller!“ herriefen? Bei den Spazierwalkern wäre nun wirklich ein Zuruf „Fester!“ angebracht. Die Verdummung durch die Werbung scheint auch vor dem Nordic Walking nicht Halt gemacht zu haben – Hauptsache, die Stöcke werden verkauft. Marianne hat mich auf einen Satz in einer Biographie über Stendal aufmerksam gemacht. Stendal habe sich im Alter von 28 Jahren einen Spazierstock gekauft; der Stock mache ihn um vier Jahre jünger, behauptete er. Wahrscheinlich kann man Walking-Stock-Käufern weismachen, zwei Stöcke machten sie um acht Jahre jünger.
Nach den Schneeschauern waren die Felder weiß – in den Gärten Blütentupfer im Schnee. Ich habe noch einmal das Vogelhäuschen aus dem Keller geholt.
Für Tagebuch-Eintragungen brauchte ich mir im Grunde keine eigenen Gedanken zu machen. Die Fakten, die mir zufällig vor Augen kommen, sprechen für sich. Ich lese: „Alkoholmißbrauch kostet 20 Milliarden Euro“. In Deutschland gibt es laut Fachzeitschrift „Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie“ etwa 1,6 Millionen Alkoholabhängige, weitere 2,7 Millionen betrieben schädlichen Alkoholgebrauch, und bei 5 Millionen Menschen sei der Alkoholkonsum riskant. Die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten durch alkoholbezogene Störungen werden in dem Aufsatz mit jährlich 20 Milliarden Euro in der Bundesrepublik Deutschland angegeben.
Die Ministerpräsidenten der deutschen Länder haben sich nicht auf einheitliche Kriterien für den Nichtraucherschutz einigen können. Es lebe der Föderalismus! Ob sich das die Väter des Grundgesetzes so vorgestellt haben? Nun haben die rauchenden Läuferfrauen doch noch eine Chance, während des Frühstücks zu rauchen, auch wenn ringsherum sauerstoffhungrige Läufer vor dem Marathonstart frühstücken – beobachtet vor wenigen Jahren, als ich vor dem Monschau-Marathon ausgerechnet im Hotel in Zigarettenqualm frühstücken mußte.
Eine Familienrichterin in Frankfurt am Main hat in einem Scheidungsverfahren das Begehren einer Marokkanerin deutscher Staatsangehörigkeit mit der Begründung abgewiesen, im marokkanischen Kulturkreis sei die Frau laut Koran zum Gehorsam gegenüber dem Mann verpflichtet; geprügelt zu werden, sei kein Scheidungsgrund. Die Richterin wurde für befangen erklärt; es ist die Rede von Disziplinarmaßnahmen. Wieso? Die Dame steht doch offensichtlich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, sie ist nicht nur als Richterin, sondern auch als Beamtin untragbar. Wenn das nicht Wasser auf die Mühlen von Rechtsextremisten ist! In der Weimarer Republik war der Staat blind im Blick auf die Rechten; heute scheint er auf dem anderen Auge blind zu sein.
Wir, das heißt, die politische Kaste, feiern 50 Jahre Europäische Union. Die Mehrzahl der Bürger feiert wohl eher den Verlust nationalstaatlicher Souveränität. Was tut’s, wir haben ja die Bundesländer, wo sich politische Macht auf der föderalen Spielwiese austoben kann. Warum eigentlich hat man sich die Beitrittskandidaten zur EU nicht vorher angesehen? Polen und Tschechien sind, wie ich vorher schon angenommen hatte – ein „Vor-Urteil“ infolge eigener Lebenserfahrung –, nicht wirklich integrationsbereit.
Welches Wehgeschrei, daß nach internationalem Urteil in der Kulturnation Deutschland der Erfolg des Schulbesuchs von der sozialen Herkunft bestimmt wird! Das war in meiner Jugend nicht anders. Da mein Vater schwerkriegsbeschädigt sowie sechs Jahre arbeitslos war und ich mir den weiterführenden Schulbesuch durch gute Zeugnisnoten verdienen mußte – sonst hätte es Schulgeld gekostet, das mein Vater nicht aufbringen konnte –, kenne ich das Problem besser als unsere Bildungspolitiker. Über Kinder im Alter von zehn Jahren zu befinden, für welche Schichtzugehörigkeit sie auszubilden seien, entspringt der Arroganz unserer höheren Bildungsschichten, die wiederum in der Regel aus höheren Bildungsschichten kommen. Nicht einmal der Zusammenbruch des Deutschen Reiches hat daran in Westdeutschland etwas ändern können.
Am Sonntag nur noch versteckte Schneeklumpen an schattigen Stellen. Während ein Läufer bereits wieder mit nackten Waden unterwegs war, trug ich noch die winterlichen Tights – das Wort kommt mir schwer in die Tastatur –, die warme, enge Hose war mir lästig.
Ein Tagebuch-Leser hat sich den Spaß gemacht, Mörikes Frühlingsgedicht „Er ist’s“, das ich auf Denglisch zu verbalhornen versucht hatte, in einen automatischen Übersetzer einzugeben. Das Ergebnis, meint er, sei nicht so schlecht wie erwartet. Vom Deutschen ins Englische, das funktioniert offenbar.
Spring lets blue volume
be again to flutter by air.
Sweet well-known smells
touch notionful the country.
Violets dream already
want soon to come.
(Horch), from a distance a quiet harp tone!
Spring, you is it,
you I heard.
Danke, Jörg.
Am Samstag erstmals blühende Obstbäume und Forsythien wahrgenommen. Kaum habe ich den Frühling besungen, retardiert die Jahreszeit. Der Himmel verhangen, prompt fast nur Läufer unterwegs. Am Sonntag wegen schlechten Wetters – Regen und Wind – nicht auf die Strecke gegangen. Drei Minuten aufs Zimmerfahrrad, aber das ist mir zu langweilig. Ich sehe ja ein, daß die Geräte nützlich sind, weil wir einen großen Teil der Muskulatur nicht mehr im Alltag beanspruchen. Selbst die Dachdecker transportieren heute ihre Dachziegel mit einem Förderband aufs Dach. Im Herbst werden keine Apfelkisten mehr auf das Fahrzeug gewuchtet, auch hier nimmt ein Förderband die Muskelbeanspruchung ab. Als ich vor einigen Jahren orthopädische Probleme hatte, empfahl mir der Orthopäde den Besuch eines Studios. Die Krankenkasse hat’s gezahlt. Ich habe auch brav die Stunden absolviert und mich an die Vorgaben des Trainers gehalten. Doch gefreut haben mich diese Besuche nicht. Schon das Publikum behagte mir nicht, alles sichtbar angeschlagene Menschen, viele übergewichtig. Zwar könnte ich in ein anderes Studio gehen, mit jüngerem, sportlicherem Publikum. Aber nun bin ich angeschlagen. Obwohl – ich kann wieder eine volle Bierkiste in den Keller tragen.
Heute, am Montagvormittag Schneeregen. Wir waren unterwegs, einen neuen Rasenmäher zu kaufen. Beim alten ist nur der Schalter entzwei; doch es gibt keinen Ersatz dafür, das Gerät wird seit Jahren nicht mehr hergestellt, das Übliche. Ich werde wohl heute wieder zu Hause bleiben, es ist zu ungemütlich draußen. Runner’s deep.
Ich lese gerade, wie der Psychiater Gregory Berns Runner’s High sieht. Ich habe mir sein Buch „Satisfaction“ wegen des interessanten Ansatzes gekauft. Der Untertitel sagt’s: „Warum nur Neues uns glücklich macht.“ Seinen Denkansatz belegt Berns mit hirnphysiologischen Forschungsergebnissen. Herausforderungen und neue Erfahrungen sind danach der Schlüssel zu unserer Befriedigung. Leider plaudert mir der Psychiater zuviel. Ich will ja gar nicht wissen, unter welchen Umständen er zu seinen Erkenntnissen gekommen ist, auch nicht, was er gerade gegessen hat, als er sich mit Kollegen austauschte. Dabei hat er ja viel zu sagen; er haut uns die Termini endokriner Vorgänge nur so um die Ohren. Was mich aufhorchen ließ, ist seine kritische Haltung zu der bis zum Überdruß kolportierten Hypothese, Runner’s High werde durch die körpereigenen Opiate bewirkt. Andererseits wird ihnen zugeschrieben, daß wir infolge der Betha-Endorphin-Ausschüttungen Warnzeichen des Körpers nicht wahrnehmen. Logisch ist das nicht. Entweder wir laufen in Runner’s High oder wir laufen gegen Schmerzen an – doch beides zugleich, Euphorie und Schmerz, geht nicht. Runner’s High stellt sich beim Marathon ungefähr zwischen dem 10. bis 15. Kilometer ein. Mögen noch so viele Endorphine ausgeschüttet werden, – wenn wir nicht aufpassen, sind wir bei Kilometer 35 in der Krise, Opiate hin oder her. Auch die Knieschmerzen beim Ultra werden durch Runner’s High nicht überdeckt. Selbst angesehene Mediziner sind dem Kurzschluß erlegen, das Hochgefühl beim Laufen werde durch die Opiate hervorgerufen. In der deutschsprachigen sportwissenschaftlichen Literatur habe ich allein bei Oliver Storz entschiedene Kritik an der Endorphin-Hypothese gefunden. Und jetzt bei Gregory Berns, der nicht einmal Läufer ist, sondern sich nur einmal intensiv mit dem Western States Endurance Run oder vielmehr seinen Teilnehmern befaßt hat. Ich lese: „Egal, wie man den Geisteszustand beschreiben mag, in den man während des Laufens eintritt – er ähnelt nicht im Geringsten den Auswirkungen eines Opiats. Opiate wie Codein, Morphin und Heroin führen zu einer Geistestrübung, das Bewußtsein löst sich von allem, was innerlich und äußerlich als unangenehm empfunden wird. Ich habe nie einen Läufer getroffen, der ein Erlebnis beschrieben hätte, das dieser entrückten Opiat-Euphorie irgendwie nahe käme.“ Berns schließt seine Beobachtungen beim Western States mit dem Resumee: „Ich war tief berührt von der schieren Willenskraft der Athleten, die das Äußerste aus ihrem Körper herausholten. Sie waren äußerlich gezeichnet von den unglaublichen Strapazen und der Erschöpfung, und diese äußeren Zeichen ließen auf die Veränderung in ihrem Gehirn schließen. Der Körper erholt sich wieder, doch ich glaube, die Veränderungen im Gehirn sind dauerhafter. Zwar wissen wir nicht genau, wie diese Veränderungen zustande kommen, doch Dopamin und Colesterol erscheinen mir die wahrscheinlichsten Triebfedern. Alles, was diese beiden im Tandem freisetzt, führt zu Erfahrungen, die uns in unserem Innersten verwandeln.“
Meine Eintragung habe ich vor dem Blick in das Buch von Gerns unterbrochen, ich bin doch auf die Strecke gegangen. Das Wetter war danach. Sogar die Sonne drang gegen 18 Uhr durch die Wolken, bevor sie unterging.
Wir haben tatsächlich Frühling. Mörikes Gedicht fiel mir ein: „Frühling läßt sein blaues Band...“ Ein Lyriker heute würde damit wegen allzu großer Schlichtheit bei Verlagslektoren und erst recht bei Feuilletonredakteuren durchfallen. Das hat man heute nicht mehr. Wieso nicht? Keinen Leser würde man mehr mit „Er ist’s“ aus dem Jahr 1829 – Mörike war damals 25 Jahre alt – erreichen. Die ganze Zeit auf der Lauf- und Gehrunde verbrachte ich damit, mir vorzustellen, wie sich Eduard Mörike heute artikulieren müßte, um überhaupt in irgend einer Form wahrgenommen zu werden. Die Babelfish-Translation, im Grunde eine Internet-Satire, die nur von Usern ernst genommen wird, könnte helfen.
Ed Murike also würde wahrscheinlich ins Notebook stammeln, so wie dies alltäglich Werbetexter tun: Lenz is coming, blue-tec-Breitband mit Sinusrhythmus und air condition. Sweet wellknown smells dominieren die Region, keine Ahnung, weil dass wir wissen. Genau, violets are dreaming, coming soon. Listen to me, there is a soft sound of playing the harp, hi, genau, we have springtime, I’m watching you. Happy spring nun in jeder Karstadt-Filiale.
Der Ministerpräsident des Landes, in dem Mörike lebte, hat sich ja vorgestellt, daß Deutsch zu einer Privatsprache werde.
Unser Schuhregal steht oben an der Kellertreppe, da wo es ziemlich duster ist. Dort ziehe ich mir die Laufschuhe an. Erst als ich bereits ein paar hundert Meter zurückgelegt hatte, bemerkte ich meinen Irrtum, zunächst einmal am Fußgefühl, erst dann visuell: Ich trug zwei verschiedene Schuhe. Von dem einen Paar hatte ich den linken, von dem anderen Paar den rechten Schuh ergriffen. Der rechte Schuh war der um eine Nummer zu große, doch da mein rechter Fuß etwas größer ist als der linke, paßte die Schuhverteilung. Umkehren mochte ich nicht mehr. Es war ein seltsames Fußgefühl, der linke Schuh war im Auftritt härter, der rechte gedämpfter. Daß ich nicht früher drauf gekommen bin: So sollte man Schuhe testen. Ich gewöhnte mich an die ungleichen Schuhe, empfehlen kann ich diese Praktik jedoch nicht. Sollte mich jemand so traben gesehen haben, links einen hellen, rechts einen dunklen Schuh – die Marke wird nicht genannt, weil ich noch immer keinen Beratervertrag habe –, würde der Kommentar lauten: Jetzt wird er alt, der Sonntag.
Die Rente mit 67 Jahren ist beschlossen. So berechtigt der Grundgedanke ist – länger leben, länger arbeiten –, so paradox sind die Umstände. Es zeigt sich: Die Politik ist immer widersprüchlicher geworden. Da führt ein Arbeitsminister, später als Kleindarsteller bekannt, den Vorruhestand ein, reißt vorsätzlich die Rentengrenzen nieder und veranlaßt Arbeitgeber wie Arbeitnehmer zur Frühverrentung, so daß gerade noch ein Drittel der Beschäftigten bis zum 65. Geburtstag arbeitet. Ein paar Jahre nach der Einführung des Vorruhestandes entdecken Politiker derselben Partei, die den Vorruhestand durchgesetzt hat, daß die Menschen länger leben. Der demographische Faktor wird in die Rentenpolitik eingeführt. Politiker der SPD lehnen die Berücksichtigung des demographischen Faktors ab, stimmen aber wenige Jahre später zu. Erst also wird verrentet auf Teufel komm raus, keine 25 Jahre später entdeckt man, daß diese Rentenpolitik nicht bezahlbar sei. Von jedem privaten Häuslebauer verlangt man, daß er sich überlegt, ob er seine Hypothek auch in 25 Jahren noch abtragen kann. Wäre der Vorruhestand nicht für viele Arbeitnehmer eine Fiktion geblieben, weil insbesondere kleine und mittlere Betriebe nicht mitmachten, wäre die Rentenlast durch den Vorruhestand noch größer geworden.
Statt nun angesichts der scheinbar neuen Erkenntnisse strikt durchzusetzen, daß die alten Rentengrenzen wieder beachtet werden, verlängert man kurzerhand die gesetzliche Lebensarbeitszeit um zwei Jahre, wohl wissend, daß dies eine Fiktion bleibt, die Arbeitszeitverlängerung de facto also eine Rentenkürzung zur Folge hat. Wenn die Gewerkschaften gegen die Rente mit 67 protestieren, ist dies jedoch genauso verlogen. Nichts spricht dagegen, bis ins 67. Lebensjahr zu arbeiten – manche wünschen sich das sogar, Hochschulprofessoren zum Beispiel. Die wenigsten Dachdecker klettern mit über 60 Jahren noch auf den Dächern herum; zum Dachdecken gehört eine Menge Arbeit, die zu ebener Erde getan werden muß. Die Rente erst mit 67 würde sozial und gerontologisch Sinn machen, wenn Konsequenz dahinter stünde, also nicht Fünfundfünfzigjährige oder Jüngere für immer nach Hause geschickt würden.
Der Staat, der das Rentenalter erhöht, läßt zu, daß seine eigenen Bediensteten und die von Ländern und Kommunen in reichem Maße von der Frühpensionierung Gebrauch machen. Vor wenigen Jahren hat der Oberbürgermeister meiner Stadt sich nicht mehr zur Wahl gestellt, weil seine zweite Amtsperiode über das 65. Lebensjahr hinausgereicht hätte. Er ließ sich pensionieren und ist jetzt Präsident des Württembergischen Fußballverbandes. Sein Fachbereichsleiter für Kultur tat es ihm mit der Frühpensionierung gleich nach. Dieser Tage habe ich gelesen, daß ein Bürgermeister in der Nähe sein Amt mit 57 Jahren quittiert. Und dies, da die öffentliche Hand über die hohen Pensionslasten stöhnt, wenn auch in eigenem Interesse nur hinter der vorgehaltenen Hand. Ich kann sehr wohl verstehen, daß Lehrer, zermürbt vom Migrationshintergrund, wie die Bezeichnung der Schulmisere politisch korrekt lautet, ihren Arbeitsplatz lieber heute als morgen verlassen. Das „Burn-out-Syndrom“ ist durchaus ernst zu nehmen. Doch was hindert ihre Arbeitgeber daran, solche Lehrer, die sich den – nicht zuletzt durch die Politik geschaffenen – Belastungen nicht mehr gewachsen fühlen, umzuschulen? Immer mehr Rentner und Pensionäre nehmen ein Studium auf. Weshalb also sollten Lehrer, die krankheitshalber den Schuldienst quittieren, nicht nach einer Umschulung oder einem verkürzten Studiengang weiterarbeiten, künftig bis 67, als Bibliothekare oder Archivare, als kommunale Pressesprecher oder Kulturreferenten, als Jugendleiter oder Vereinstrainer zum Beispiel? Die wenigsten öffentlich Bediensteten, die in ihrer beruflichen Position dienstunfähig werden, sind deshalb auch arbeitsunfähig. Es wird wieder Jahrzehnte dauern, bis auch diese schlichte Erkenntnis in die Politik gedrungen sein wird.
Spiridons Bild mit dem unbeholfenen, zerhackten Namenszug, das ich für etwa 50 Euro ersteigern wollte, hat 520,67 Euro gebracht. Auch die Autogrammkarte von Uta Pippig habe ich nicht bekommen; sie wäre mir maximal 3 Euro wert gewesen, mein Konkurrent erwarb sie für 3,50 Euro.
Die Unterschrift, die anscheinend dem Analphabetismus abgerungen ist, kommt von einem Läufer, der die damals 40 Marathon-Kilometer in 2:58:50 Stunden zurückgelegt hat. Spiridons Leistung wird heute von jedem ehrgeizigen Volksläufer, sofern er ausreichend trainiert hat, erbracht und selbst von den besten Sechzigjährigen unterboten. Ich versuche nicht, Spiridons Leistung kleinzureden. Seine Bedeutung besteht darin, daß er es gewesen ist, der diese Leistung zum erstenmal vollbracht hat. Ähnliches gilt für Emil Zatopek. Es macht nachdenklich, daß im Sport – nicht nur in diesem – der Ruhm von Höchstleistungen sehr rasch verblaßt, selbst wenn er sich heute in Wohlstand einwechseln läßt. Der Ruhm erstmaliger sportlicher Taten dagegen überlebt die Leistungsträger. Zu Lebzeiten allerdings hat Spiridon Louis nicht viel davon gehabt. Der erste Sieg in einem Marathon hat ihn nicht davor bewahrt, ein ganzes Jahr für nichts und wieder nichts im Gefängnis verbringen zu müssen. Zwar bekam er 1936 einen Part bei den Olympischen Spiele, aber richtig berühmt ist er erst lange Zeit nach seinem Tode geworden, im Grunde erst, als Marathon zum Volkssport geworden ist. Sein Autogramm für 520 Euro bei einer eBay-Auktion erinnert an den Kunstmarkt, auf dem Meisterwerke den Besitzer zu Preisen wechseln, die deren Schöpfern ein sorgloses Leben hätten ermöglichen können.
Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist auch in einem Tagebuch nur ein Schritt. Ich habe mich über den Reißverschluß an meiner Laufjacke geärgert. Als der erste Bundespräsident, Theodor Heuss, das Deutsche Museum in München besuchte, in dem alle möglichen technischen Vorgänge und Errungenschaften ausgestellt sind oder demonstriert werden, vermißte er die Antwort auf die Frage, wie eigentlich ein Reißverschluß funktioniere. Flugs wurde das nachgeholt; seither wird das Reißverschluß-Prinzip in etwa Zwei-Meter-Größe dargestellt. Geändert hat sich in dem halben Jahrhundert nichts – leider. Noch immer verhindern die Hersteller nicht, daß sich beim Schließen oder Öffnen des Reißverschlusses Stoff einklemmt. Immer wieder einmal passiert mir das. Ich habe jetzt durchgezählt, was ich an Reißverschlüssen beim Laufen herumtrage: an den Beinen der langen Laufhose zwei, am Hemd einen, an der Jacke einen vorn und einen an der Tasche. Und sollte ich zur Anfahrt in die Sportstunde darüber einen Trainingsanzug tragen, kommen nochmals drei Reißverschlüsse hinzu. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß einer der Reißverschlüsse klemmt. Langes Nesteln, damit man den eingeklemmten Stoff aus den Zacken herausbekommt. Wenn man Pech hat, reißt der Stoff. Und auch die Reißverschlüsse sind nicht strapazierfähig. An meinem Laufhemd ist neulich das winzige Stück Metall, mit dem man den Reißverschluß schließt oder öffnet, durchgebrochen. Man bekommt beileibe keinen neuen Griffel zum Einhängen in die Öse; der gesamte Reißverschluß muß erneuert werden. Also fährt man ins Kaufhaus, sucht nach einem einigermaßen farblich passenden und gibt Hemd und Reißverschluß der Änderungsschneiderin. Als mir das bei hochgeschlossenen Winterschuhen passierte, nämlich ebenfalls das Metallplättchen an der dünnen Stelle durchriß, mußte der ganze Schuh in die Fabrik eingeschickt werden. Mich regt das auf – da wird hochtrabende Reklame gemacht, und wenn ein zu schwach ausgelegtes Teil beim Gebrauch entzwei geht, ist die Reparatur nur mit hohem Aufwand möglich. Bei meiner Trainingsjacke muß ich lange fipseln, bis ich die beiden Reißverschlußteile ineinandergehängt habe. Ich habe manchmal den Eindruck, daß die Sportbekleidungshersteller ihre eigenen Sachen nicht tragen oder vielleicht nach ein paar Wochen wegwerfen. Als einst bei den Hosen der Hosenladen altväterisch zugeknöpft wurde, konnte nichts weiter passieren, als daß vielleicht einmal ein Knopf abriß. Das fiel gar nicht weiter auf. Wenn heute der Reißverschluß der Hose klemmt und sich nicht schließen läßt, kann sich das – in der Theaterpause zum Beispiel – zu einer mittleren Katastrophe entwickeln. Der Abend ist futsch. So machen wir uns im Streben nach Komfort die Alltagswelt immer komplizierter.
Tränen rannen mir über die Wangen. Nein, es war nicht alles so furchtbar traurig – im Gegenteil. Doch der frühe Frühling hat seine allergene Seite. Die Augen jucken. Sie tränen früher als sonst im Jahr.
Die Bäume, die in den Streuobstwiesen gefällt werden sollten, sind gefällt. Auf der Strecke, die sonst keine Duftnote hat, jedenfalls keine angenehme, war der Duft frisch geschlagenen Holzes zu schnuppern. Die Gärtner öffentlicher Anlagen sind fleißig gewesen; weit vor dem kalendarischen Frühling haben sie Frühlingsblumen gesetzt. Werden die Krokusse die Kälte überstehen, wenn es noch einmal schneien sollte?
Vor den Häusern sind verdeckelte Plastic-Gefäße aufgestellt worden; eine Firma sammelt gebrauchte Schuhe. Ob sich das rentiert, ist nicht meine Sorge. Ich habe zwei Paar Laufschuhe drauf gestellt, denn ich konnte den Deckel nicht öffnen. Ich nehme an, die Abholer können es. Kurz entschlossen habe ich die Schuhe weggegeben; das bewahrt mich davor, sie doch noch einmal zu tragen und mir dann womöglich die Knie zu ruinieren. Als ob mir das nicht schon mehrfach passiert wäre! Einen Moment lang war ich versucht, die Schnürsenkel herauszuziehen, die könnte man ja noch gebrauchen. Das Erbe meiner Mutter, die den größten Teil ihres Lebens in Notzeiten verbracht hat. Dann fand ich es lächerlich, was soll ich mit gebrauchten Schnürsenkeln? Eher sind die Sohlen schiefgelaufen, als daß die Schnürsenkel reißen.
 |
Bei eBay hineingeschaut. Das tue ich ja ohnehin, da ich alte Ansichtspostkarten anbiete. Doch manchmal gebe ich in der Suchrubrik „Marathon“ ein, denn da sammle ich noch – und sei es für die Erben. Häufig finde ich nur den Ort Marathon, nicht mal den echten, sondern den in Florida. Diesmal war ich wie elektrisiert. Angeboten wurde das Porträt Spiridons mit dem Original-Autogramm. Die Schreibweise „Spyridon“ und der niedrige Ausrufepreis ließen mich hoffen, daß sich der Anbieter vielleicht der Kostbarkeit nicht bewußt war, wenn er auch hinzugefügt hatte „Äußerst selten“. Das Gebot lag nur wenig über 20 Euro. Da beschloß ich einzusteigen; nur warte ich bei solchen Gelegenheiten bis zuletzt. Als Maximalgebot wollte ich 50 Euro eingeben, genauer 50,50 Euro, denn erfahrene eBayer wissen, daß, wer eine runde Summe eingibt, sich womöglich einer Chance begibt, Konkurrenten abzuschütteln. |
Beim nächsten Anklicken war das Gebot auf über 40 Euro gestiegen. Da sah ich mich noch im Rennen. Doch am Sonntag gab ich auf. Es waren nur drei Bieter, genaugenommen nur zwei, die den Preis hinaufgetrieben hatten. Von 41 Euro war ein steff auf 140,99 Euro gesprungen und hatte sein Gebot noch erhöht, doch ein Newcomer mit nur 10 Bewertungen, ein noch unerfahrener eBayer also, bot 212 Euro. Natürlich rechne ich Euro in D-Mark um, wie ganz offiziell die Franzosen in francs. Deutsche, die in D-Mark umrechnen, gelten in der veröffentlichten Meinung als ganz schlimme Feinde der Europäischen Gemeinschaft. Doch meine Rente muß ich ja auch in D-Mark umrechnen, sonst komme ich mir als Rentner noch mehr betrogen vor als ohnehin. Natürlich multiplizierte ich glatt mit zwei, was die Sache noch schlimmer macht. Etwa 420 Mark für die – hoffentlich echte – Signatur des Spiridon Louis, der nur mit Spiridon gezeichnet hat, und dies ziemlich unbeholfen, nein, das mag ich mir denn doch nicht leisten. Nicht einmal ein Sportmuseum hat ein solches Budget, daß es sich diese Ausgabe leisten würde.
Zwar habe ich für die Nachrüstung meines Diesel mit einem Rußfilter fast das Vierfache gezahlt – bloß deshalb, weil der angebliche premium-class-Hersteller vor fünf Jahren noch nicht imstande war, ein nach dem Stand der Technik umweltverträgliches Auto auf den Markt zu bringen. Aber von dem Filter habe nicht nur ich etwas, nämlich ein besseres Gewissen, sondern auch die Umwelt. Die Signatur „Spyridon“ dagegen würde im Schuhkarton schlummern – ein bloß ideeller Wert, und man weiß ja, ideelle Werte gelten nichts.
Am Dienstagabend werde ich erfahren, was der künftige Besitzer des Autogramms von Spiridon Louis tatsächlich gezahlt haben wird. Ich werde mir wahrscheinlich Uta Pippig gönnnen; es besteht Aussicht, daß ich das Autogramm für 1,99 Euro bekomme, zuzüglich Porto. Doch über eBay ist es wahrscheinlich billiger, als wenn ich ihr selbst nach Colorado schriebe und sie, mit beigefügtem Rückporto, um ein Autogramm bäte.
Den 14. Februar muß ich mir notieren, da habe ich erstmals in diesem Jahr einen Läufer in kurzen Hosen gesehen. Es war nicht auf meiner Laufstrecke, sondern im Neckartal. Da ist es um ein bis zwei Grad wärmer als bei uns oben. Im Garten primeln schon die Primeln, und auch die Walker sind erwacht, beziehungsweise upgewakt.. Und dräut der Frühling noch so sehr, es wird schon noch mal Winter werden. Oder?
Die Überschrift in meiner Zeitung war alarmierend: Arme sterben in Deutschland zehn Jahre früher. Aha, denkt der Leser, Zweiklassenmedizin! Wenn es so wäre, müßten sich die Städte mit Demonstrationszügen füllen. Doch schon die Unterzeile muß nachdenklich machen: Doppelt so hohe Quote von Herzinfarkt und Zuckerkrankheit. Diabetes ist eindeutig eine Stoffwechselkrankheit, und sie wird verursacht durch Fehlernährung. Die bedeutet nicht etwa fehlende Ernährung wie in der Nachkriegszeit, in der es keine Übergewichtigen gab, sondern fehlerhafte Ernährung. Wer über die ersten Sätze der AP-Meldung hinaus gelesen hat, wonach Männer mit niedrigem Einkommen zehn Jahre weniger Lebenserwartung haben als gut verdienende Männer und Frauen fünf Jahre weniger, der erfährt dann, daß das Gesundheitsverhalten „offenbar mit Bildung und sozialem Status“ zusammenhängt. „Während 60 Prozent der Männer mit Hauptschulabschluß rauchen, sind es bei Abiturienten 35 Prozent, bei Frauen beträgt das Verhältnis 50 zu 30 Prozent.“ Was mir bereits in den siebziger Jahren auffiel, daß man im Lauftreff eher einem Universitätsprofessor als einem angelernten Arbeiter begegnete, hat sich noch verstärkt. Kinder aus Migranten-Familien und mit niedrigem Sozialstatus treiben zwei bis drei Mal weniger Sport als andere Kinder.
Doch all das hat nichts mit dem Einkommen zu tun, sondern mit dem Wissen. Der Gesundheitslehrer Max-Otto Bruker hat schon vor dreißig, wenn nicht vierzig Jahren gesagt: Gesundheit ist ein Informationsproblem. Ehe nun aus der linken Ecke der Arm gestreckt wird, – Gesundheitswissen wird nicht durch Bildungsabschlüsse vermittelt, es ist wohlfeil für jeden. In den Krankenkassen und -versicherungen, in Krankenhäusern und Arztpraxen liegen Schriften aus, in Apotheken und Reformhäuser bekommt man kostenlose Zeitschriften mit Hinweisen zu gesunder Lebensführung. Es gibt in fast jeder Woche seriöse medizinische Fernsehsendungen. Auch wenn man Ernährungsinformationen in populären Medien hinterfragen muß, so steht doch nichts durch und durch Falsches drin. Allerweltsweisheiten wie „Bewegung ist die beste Therapie“ liegen auf der Straße.
Man kann die Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen. Wo es wie im Sozialismus versucht worden ist, mußte dies mit dem Freiheitsverlust auf allen Gebieten bezahlt werden, abgesehen davon, daß der Slogan der DDR „Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Politik“ eine hohle Phrase war – die Erfüllung von Planzielen stand allemal höher. Für die eigene Gesundheit ist jeder selbst verantwortlich. Das bedeutet nicht, daß man untätig die Leute in ihren eigenen Untergang stolpern läßt. Die Europäische Gemeinschaft hat ein Projekt abgeschlossen, das etwas langatmig lautet: „Clothing the Gap: Strategies for Action to Tackle Health Inequalities in Europe“, nämlich gesundheitliche Ungleichheit zu beseitigen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat das Projekt zwischen 21 Ländern über drei Jahre lang koordiniert. Am 13. Februar fand die nationale Abschlußkonferenz statt. Darauf bezog sich die AP-Meldung, in der jedoch die gesundheitliche Ungleichheit und nicht die Strategie zu ihrer Bewältigung im Vordergrund stand. Die Europäische Kommission will Mitte des Jahres ein Anschlußprojekt zur Reduzierung gesundheitlicher Ungleichheiten fördern.
Nur muß man den Menschen klarmachen, daß man zwar Informationen bereitstellen kann, aber sie anzuwenden, Sache des Einzelnen ist. Wer selbst gegen einfache Gesundheitsregeln verstößt, hat keinen Anspruch auf soziales Mitgefühl, wenn er seine Gesundheit ruiniert hat. Das Leben ist unbarmherzig. Wer im Auto oder auf dem Motorrad sein Verkehrsverhalten nicht physikalischen Gesetzen und seinem Können anpaßt, muß damit rechnen, daß er eines Tages von der Straße fliegt. Die Gesellschaft ist dafür nicht verantwortlich. Nicht anders ist es mit dem Gesundheitsverhalten, sozialer Status hin oder her.
Den Nutzen einer Kreditkarte erfuhr ich 1979 nach meinem zweiten New York-Marathon. Da hatte ich nämlich noch keine. Flug und Hotel – ein gutes am Central Park, das ich mir heute nicht mehr leisten würde – hatte ich bei einem Reisebüro gebucht. Doch als ich auschecken wollte – Beispiel für das heutige Kauderwelsch, ich meine aus-checken –, legte man mir die Rechnung vor. Wieso eigentlich? Da konnte ich lange erklären und auf den Voucher deuten, – das Reisebüro hatte den von mir fürs Hotel gezahlten Betrag einfach nicht weitergeleitet. Ich sah ein, das war nicht das Problem des Hotels, sondern meines. Eine Kreditkarte hätte mich im Handumdrehen gerettet. So aber.... Glücklicherweise hatte ich noch Zeit bis zum Abflug. Und so lieh ich mir das Geld im nicht allzu weit entfernten Redaktionsbüro von „Geo“, mit dem ich vor diesem Marathon Kontakt gehabt hatte. War mir zwar peinlich, aber darauf konnte ich keine Rücksicht nehmen. Inzwischen war auch Manfred Steffny, den ich zufällig im Hotel traf, erbötig, mir das Geld zu leihen. Das muß auch einmal festgehalten werden. Als Läufer hat man wenigstens bei Läufern Kredit.
Zu Hause beantragte ich schleunigst eine Kreditkarte. Fortan kam es mir leichtfertig vor, Europa zu verlassen, ohne das Plastic-Geld in der Brieftasche zu haben, das selbst in drittklassigen Hotels Perus akzeptiert wird. Seit jener Zeit hat sich meine Brieftasche mit immer mehr Plastic-Karten gefüllt, mit so vielen, daß sie in den Fächern gar nicht Platz haben und ich die meisten Karten zu Hause aufbewahre, was dazu führt, daß mir dann im Bedarfsfall just die passende Karte fehlt. Am wichtigsten scheint mir die Karte der Krankenkasse zu sein. Ohne sie – ich habe das im vorigen Jahr erlebt – bewahrt einen gerade so nur der Paragraph der unterlassenen Hilfeleistung davor, im Krankenhaus abgewiesen zu werden. Die ADAC-Karte als Rettungsanker – erworben erst 1994, nachdem ich in meinem Audi Diesel ein paar Wochen nach dem letzten Werkstattbesuch mit Motor-Totalschaden in Österreich auf der Autobahn liegengeblieben war. Auf die Postcard – nicht zu verwechseln mit der simplen, noch nicht anglifizierten Postkarte – kann ich bargeldlos bis zu 50 Euro Briefmarken kaufen. Wenn die ein Wirt in Zahlung nähme, könnte ich mir auch bei Verlust der Bank- und der Kreditkarte ein warmes Essen leisten. Die Metro-Karte gibt mir das Gefühl, als Kleinunternehmer am Wirtschaftsleben teilhaftig zu sein. Der Presseausweis dagegen, inzwischen ebenfalls als Plastic-Karte, und zwar als die sündhaft teuerste, ist am überflüssigsten; vielleicht sollte ich mal wieder in ein staatliches Museum gehen, da darf ich mit dem Presseausweis umsonst rein. Bei Laufveranstaltungen habe ich den Presseausweis kaum jemals gebraucht, eher mal bei einem Kongreß. Und Absperrungen bei Staatsbesuchen wie die von Bush würde ich ohnehin sehr weiträumig umgehen, statt den Presseausweis zu zücken. Auf den Presseausweis erhält unsereiner Prozente beim Autokauf. Da dies einigermaßen Verhandlungsstarken auch ohne Presseausweis gelingt, ist unsere Unbestechlichkeit nicht weiter in Gefahr. Die Ausleihkarten der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart und der Uni-Bibliothek sind wirklich wichtig, vielleicht auch mal die des Deutschen Literaturarchivs in Marbach a. N.; sie sind, wenn ein Referat geboren werden soll, die Nabelschnur zur Bildung. Die Karte einer Hotelkette dagegen beschert mir an der Rezeption nur einen vielleicht freundlicheren Empfang, meine Übernachtungszahl ist viel zu gering, als daß ich jemals eine freie Übernachtung hätte erwerben können. Die Lufthansa-Miles&More-Card, ach, mit Sicherheit bin ich mehr Meilen gelaufen als geflogen. Die BahnCard ist längst abgelaufen, aber ich habe sie aufbewahrt, falls sich im Bedarfsfall die Bahn digital meiner nicht mehr erinnern kann.
Längst werden einem die Plastic-Karten nachgeworfen. Ich habe eine Microsoft-Card – als ob ich jemals die Hotline benützen könnte, da ich des Fach-Chinesischen doch nicht mächtig bin und mich daher nicht verständigen kann – sowie die Karte eines Finanz-Software-Herstellers. Im vorigen Jahr haben wir in einem Baumarkt eingekauft, außer Gartenbedarf auch eine nette Leseleuchte; flugs avancierte ich zum Großkunden und habe eine Karte, die mir künftig Prozente einräumt, obwohl ich wahrscheinlich nie mehr eine teure Leseleuchte kaufen werde. Die Telekom gewährt mir seit geraumer Zeit „Happy Digits“; glücklich bin ich damit nicht geworden – zumal in Anbetracht des Aktienkurses, auch ich also ein Opfer des Schauspielers Manfred Krug, der sich für seine Werbeauftritte öffentlich entschuldigt hat –, aber wenigstens konnte ich die Digits-Punkte zum Telefonieren einlösen. Nun weist mein Konto 721 Digits aus, aber ich kann sie nicht mehr zum Telefonieren benützen. Ehe ich etwas anderes Nützliches ansparen könnte, sind sie schon wieder verfallen. Die Karte einer anderen Firma hat die Firma überlebt. Ob ich die grüne Karte des International Club von Bloomingdale’s in New York noch aufhebe? Sie weist mich immerhin als Charter Member aus und berechtigt mich dazu, jederzeit am International Service Desk einzuchecken, mehr Respekt also bitte – Himmel, womit Werbemanager die Leute besoffen machen! Jüngst hat der Stromerzeuger EnBW eine Kundenkarte namens SüdBest eingeführt, die man in Baden-Württemberg zum Einkaufen bei verschiedenen Geschäften benützen kann. Wollte ich beispielsweise die Tankstelle der Marke anfahren, die mir Punkte bringt, würde ich damit die erhoffte Ersparnis verfahren, vom Zeitverlust nicht zu reden. Die Punkte wollen verwaltet werden – klick hier, klick da –, das Seitenblättern auf der Suche nach den Prämien... Vor allem aber: Ob es nicht gescheiter ist, sich die Geschäfte nach Kompetenz und nicht nach Bonuspunkten auszusuchen?
Selbst meine Freie Tankstelle hat mir eine Karte gegeben, wenn auch nicht aus Plastic; ich kann sie nach jeder Autowäsche stempeln lassen; die zehnte Autowäsche ist dann kostenlos. Dieses hehre Rabattziel habe ich nach anderthalb Jahren noch immer nicht erreicht. Im Grunde ist das Payback nichts anderes als die digital aufgemotzte Rückkehr zu Omas Rabattmarken, die von der Wirtschaft nicht zu Unrecht als Klimbim abgeschafft worden sind. Wehe, ich hätte als Kind beim Einkaufen vergessen, mir die Rabattmarken geben zu lassen! Damals jedoch bedeutete die Einlösung einer Rabattmarkenkarte tatsächlich eine Zubuße für den Haushalt. Digitalisiertes Payback macht auf jeden Fall mehr her, als Rabattmarken in eine Karte zu kleben. Rabattmarken aus der Hand eines akademisch gebildeten Verkäufers zu nehmen, das paßt irgendwie nicht zueinander; anders hingegen, wenn der Apotheker die Plastic-Kundenkarte einschiebt.
Vor einigen Jahren habe ich vom Marathon Hamburg eine Mitgliedskarte des Club Marathon Hamburg erhalten. Mitglied des Clubs wird man automatisch, wenn man am Hamburg-Marathon teilgenommen hat. Auf diese Weise zählt der Club über 65000 Mitglieder, wie ich gelesen habe, und ist der größte Marathon-Club in Deutschland. Die Plastic-Karte habe ich nie benötigt. Weder habe ich meine „persönlichen Daten online“ aktualisiert, „um unsere Mailings, z. B. nach einem Umzug, weiter zu erhalten“, noch habe ich eine Reise bei dem Reisevertragspartner des Hamburg-Marathons gebucht, und „viele weitere, tolle Angebote“, die in Vorbereitung seien, habe ich nicht mitgekriegt oder vielleicht sogar verschmäht.
Doch die Plastic-Karte des Hamburg-Marathons hat mich auf einen Gedanken gebracht. Da ja Marathon-Veranstaltungen längst kommerzialisiert sind, müßte sich doch aus einer solchen Plastic-Karte etwas Reales machen lassen, das nicht nur dem Veranstalter-Image vermeintlich nützt. Berlin belohnt die Kundentreue damit, daß man nach dem zehnten persönlichen Berlin-Marathon-Lauf in den Jubilee-Club aufgenommen wird und eine lebenslange Startnummer erhält. Ich schlage die Einführung einer Vielstarter-Karte vor, die, versteht sich, running card oder sonstwie englisch heißen müßte, um wahrgenommen zu werden. Jeder, der an derselben Marathon-Veranstaltung, sei es Köln oder München, Steinfurt oder Vollmond-Marathon, zehnmal teilgenommen hat, erhält diese Plastic-Karte. Ebenso sollten alle ordentlichen Mitglieder des 100 Marathon Clubs eine solche Karte bekommen. Im Gegensatz zu der Karte des Club Marathon Hamburg müßte sie statt der „weiteren, tollen Angebote“ mit einer realen Prämiierung ausgestattet sein, die Marathonsammler und Marathontreue belohnt. Wer zehnmal an demselben Marathon teilgenommen hat und erst recht, wer hundert Mal Marathon gelaufen ist, den kann man wohl unter die Vielstarter rechnen. Wie kann man Vielstarter spezifisch belohnen? Startgebühren-Ermäßigung? Entweder fällt sie so gering aus, daß sie im Budget nicht spürbar wird, oder aber der Veranstalter kommt mit der Kalkulation ins Trudeln. Finanzneutral könnte man Vielstartern entgegenkommen, indem man für sie die Anmeldungsfrist außer Kraft setzt. Mit anderen Worten, Inhaber der Karte könnten von einem Tag zum anderen beschließen, zu einem Marathon zu fahren, dessen Anmeldefrist längst abgelaufen ist. Vielleicht sogar räumt ihnen der Veranstalter die Anmeldegebühr der ersten Phase ein, belegt Karteninhaber also nicht mit dem Malus der späten Anmeldung. Ich denke, daß das zahlenmäßige Risiko kurzfristiger Anmeldungen durch Karteninhaber kalkulierbar ist. Da nicht alle Karten-Inhaber an derselben Veranstaltung quasi unangemeldet starten werden, sondern diese Zahl selbst bei den großen Läufen überschaubar sein dürfte, müßten die organisatorischen Probleme in den Griff zu bekommen sein. Notfalls läßt man die Karteninhaber am Schluß in einem eigenen Block starten.
Ich meine, daß diese Prämiierung fleißiger Marathonläufer attraktiv ist. Denn wenn Vielstarter ein Verletzungsproblem haben, dann geht meistens nicht nur eine einzige Marathonteilnahme in die Binsen. Und wer weiß schon immer, ob er nach einem Marathon am nächsten Wochenende wieder einen laufen kann. Der Einnahmeverlust durch Verzicht auf den Spätanmeldungs-Malus wäre zu vernachlässigen. Notfalls kann man ihn ja bei den Antrittsgeldern für Spitzenläufer einsparen. Eine um einige Sekunden schnellere Spitzenzeit bringt keinen Läufer zusätzlich auf die Strecke. Die Marathon-Prämien-Karte könnte sogar dazu führen, daß die Zahl der spontanen Starts zunimmt. Wer sich eine Woche nach einem Marathon gut fühlt, kann dann an einem weiteren Marathon teilnehmen, der ihm sonst wegen Überschreitung der Anmeldefrist verschlossen bliebe.
Wenn wir schon bei den Plastic-Karten sind, – die Übernahme dieses Vorschlags ist bonuspunktepflichtig zugunsten von laufreport.de.
Patsch! Ich spürte richtig die Bugwelle vor dem Laufschuh, und der Schwall, der auf den Oberschenkel gespritzt war, versickerte in der Laufhose. Patsch! Es war am Mittwoch voriger Woche, als der Schnee getaut war und sich das Wasser in den Straßenvertiefungen zu großen Lachen gesammelt hatte. In der Dämmerung hatte ich die Wasserlache nicht gesehen, vielleicht war ich auch dadurch abgelenkt, daß ich gerade einen Hundehalter und seinen Hund überholte. Patsch! Ehe mir noch ein „Himmelkruzitürken“ entfuhr, das ich sonst auf den Lippen führe – als bayerisches Zitat gewissermaßen, weil ich infolge meiner Erziehung nicht von tief innen fluche –, sagte der Hundehalter „Scheiße!“ Er nahm mir, während ich noch in derselben weilte, das Wort aus dem Munde. Da mußte ich lachen – der Mann war von dem ekelhaften Guß nicht im mindesten betroffen, aber er ahnte, wie mir zumute war – Scheiße, gefühlte Solidarität auf der Laufstrecke.
Wir wohnen im Schatten einer katholischen Kirche. Die Häuser hier sind vor über vierzig Jahren von einer katholischen Siedlungsgesellschaft erbaut worden. Infolge dessen habe ich, ob ich wollte oder nicht, ein katholisches Umfeld. Das ist in einem eher pietistischen Landstrich selten. Außer zu Kirchgangszeiten merke ich das katholische Umfeld in der Fasnachtszeit, die wir so schreiben und nicht „Fastnachtszeit“ wie in der Zeitung, weil in dieser Zeit nicht gefastet, sondern gefaselt wird. Die historisch ernsten Evangelischen – oder hat jemand schon lachende Revolutionen erlebt? – haben sich den rheinischen Karneval ausborgen müssen, und er hat daher hierzulande immer etwas Gequältes. Die Fasnacht in katholischen Gebieten wie Oberschwaben ist dagegen ursprünglich, nämlich heidnischer Brauch. Und wie alles, was die Kirche auf die Dauer nicht verbieten konnte, hat sie das Treiben als Folklore akzeptiert, die Hexen auf der Straße, die Unterwäsche auf der Leine.
 |
Die Lauftreffleiterin ein paar Häuser weiter – sie stammt aus Oberschwaben – hängt aus Überzeugung Wäsche vors Haus, denn der Gipfel katholischer Frivolität ist, Unterwäsche öffentlich zu zeigen, zwar nicht am eigenen Leibe, aber doch wenigstens auf der Leine. Jährlich bin ich versucht, den vermeintlichen Ausbruch aus der Sittenstrenge dadurch zu übertrumpfen, daß ich einen String der jüngsten, noch knapperen Generation dazuhänge. Dazu hätte ich ihn kaufen müssen – doch wer verkauft einem alten Herrn einen String, ohne nicht flugs die Polizei zu verständigen? |
Aber der Witz wäre in diesem Jahr ohnehin verfehlt, die gespielte Zügellosigkeit ist weiter fortgeschritten, als ich angenommen hatte. Auf Plakaten in meinem katholischen Umfeld und im Mitteilungsblatt wird die Weiberfasnet, am Schmotzigen Donnerstag, angekündigt. Sie wird organisiert von einem katholischen Frauenkreis. Im Mitteilungsblatt habe ich zweimal hinschauen müssen; die Überschrift lautet „Weiberfasnet diesmal im Rotlicht-Milieu“. Das Motto der Weiberfasnet ist: „Miss Marple ermittelt im Rotlicht-Milieu“. Alle leichten und schweren Mädchen seien an diesem schmotzigen Donnschtrig (schmutzigen Donnerstag, dem Donnerstag vor Fasnacht) in die „Domina-Taverne“ eingeladen – die katholische Kirchengemeinde heißt St. Dominikus, da liegt die weibliche Ableitung. Domina nahe. Außer einem Beitrag zum Kalten Büfett „ist zwielichtige Kleidung erwünscht“. Da wird man wohl erstmals im Gemeindehaus, ein paar Hausnummern weiter, bauchfrei zu sehen bekommen. Ob ich schon mal den Feldstecher bereitlege? Schließlich gehören zum Rotlichtmilieu auch Spanner.
Erst einmal hat mich die Ankündigung katholischer Frauen als Huren und Kriminelle amüsiert . Aber dann ist mir die vermeintliche Freizügigkeit bitter aufgestoßen. Ich habe als Kind, noch dazu in der Diaspora, eine andere Kirche kennengelernt, eine humorlose ohnehin. Alles, was mit Sex zu tun hatte, war als Todsünde pönalisiert. Von käuflicher Liebe ahnten wir nichts. Die kindlichen Beichten wären, gemessen an den Sünden der Erwachsenen, lächerlich gewesen, hätte es das sechste Gebot nicht gegeben. Wer die Drohungen ernst nahm – und ich nahm sie ernst –, mußte unweigerlich in eine ecclesiogene Neurose (den Ausdruck hat der Suizid-Forscher Dr. Klaus Thomas verwendet) geraten. Kein Kind konnte soviel sündigen, wie die Kirche sich hier an der Psyche versündigt hat. Ich habe, um mich in die damalige Mentalität zu versetzen, ein Erbauungsbüchlein von 1892 aufgeschlagen. Als „heilsamen Ratschlag“ gibt der Pater Cölestin Muff Erstkommunikanten auf den Weg: „Sobald du also unreine Gedanken, Vorstellungen und Regungen in dir merkest, da suche unverzüglich Sinnen und Denken auf etwas anderes zu richten, und sprich ein kurzes Gebetlein im Herzen, z. B . ,O Jesus Barmherzigkeit! Lieber sterben als sündigen!’ ... Aber das Notwendigste, das Erste und Letzte zur Bewahrung der Keuschheit ist und bleibt die Befolgung des Mahnwortes: fliehe die Gefahr, die Gelegenheit zur unkeuschen Sünde. Die nächste Gelegenheit besteht im vertrauten Umgang mit dem anderen Geschlechte; das ist die gefährliche Klippe, woran die Keuschheit Schiffbruch leidet.“ An die Klippe, durch Personen des eigenen Geschlechts, zum Beispiel in jenem Priesterseminar an der Donau, verführt zu werden, hat der fromme Pater wohl nicht zu denken gewagt.
Nun also, als ich von meiner Trainingsrunde kam, im Glaskasten der Kirche St. Dominikus die Einladung in die Domina-Taverne, dort am Schmutzigen Donnerstag in zwielichtiger Kleidung einzutauchen in das Rotlichtmilieu. Nichts anderes also als – nach dem Maßstab in meiner Jugend – die Aufforderung zu unkeuschen Gedanken und Vorstellungen. Nun kann man sagen, daß seit der Zeit, da ich im Beichtstuhl verzweifelt bekannte, ich hätte soundsoviel Mal Unkeuschheit getrieben – die Zahl war ohnehin geschönt –, siebzig Jahre verstrichen seien. Doch im Prinzip beharrt die katholische Kirche auf den einstigen Normen. Würde sich die Kirche so wie die Juristen auf den Wandel sittlicher Anschauungen berufen, müßte sie nicht nur die Weiberfasnacht im Rotlichtmilieu dulden, sondern vor allem erst einmal zurücknehmen, was sie in den vergangenen Jahrhunderten zu sittlichen Normen und theologischen Dogmen erhoben hat: die Unterdrückung der Frauen – die Protestanten haben die Gleichberechtigung im Kirchen- und im kirchlichen Lehramt durchgesetzt -, den Zölibat, das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariae, das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes. An der Basis hat man in den siebzig Jahren, die ich bewußt überblicken kann, offenbar zur Lebenswirklichkeit gefunden. Die Kirchenoberen verharren weiter in starren Normen und stoßen diejenigen aus, die sich dem widersetzen.
Vielleicht ist ja die Weiberfasnacht in der Domina-Taverne auch eine Form des Protestes an der Basis? Küng und Drewermann konnte man entfernen, die katholischen Frauen nicht. Schließlich hängt von ihnen, seien sie nun Huren oder Engel, das Weiterbestehen der römisch-katholischen Kirche ab.
Innerhalb von vierzehn Tagen: Schneeglöckchen und Finkenschlag im Garten, ein Sturm, der Dutzende Menschen das Leben gekostet und Milliarden-Schäden verursacht hat, dann Schnee, der sich zu Bergen türmte, und Minusgrade, schließlich Matsch. Aus dem Laufen ist nicht mehr viel geworden, ich bin die Trainingsrunde nahezu gegangen. Dort, wo ich hätte laufen können, war der festgetretene Schnee uneben, und ich fürchtete, mir den Fuß zu vertreten. Das fehlte mir noch, daß sich die unendlich lange Rehabilitationsphase infolge einer erzwungenen Verletzungspause noch weiter verlängerte. Stellenweise war es glatt. Gestern Matsch, nasse Füße geholt, heute fast durchgehend wieder Asphalt, zumindest Spurrinnen. Die Kälte hat meinen Operationsnarben nicht gut getan, selbst die am Herz vermeinte ich zu spüren. Im Krankenhaus bin ich darüber aufgeklärt worden, was bei all den Eingriffen und Organspiegelungen passieren könnte – und ich müsse mein Einverständnis erklären –, aber was auf das „gute postoperative Ergebnis“, wie der Kardiologe unlängst protokolliert hat, zwangsläufig folgen würde, darüber hat kein Mensch mit mir gesprochen. Wenn man krank ist, wird einem geholfen, gewiß, aber gesund werden muß man allein.
Mein Hausarzt hat beim Training einen Muskelfaserriß erlitten. Meine Ärzte haben es nie versäumt, mich über ihre Beschwerden zu unterrichten. Immer wenn laufende Ärzte mit mir über das Laufen reden, sprechen sie zunächst einmal von sich selbst. Ich kann’s verstehen, den ganzen Tag haben sie kranke Leute um sich oder um sich gehabt, die gar nicht ermessen können, was es bedeutet, nicht zu laufen. Viele von ihnen wären wahrscheinlich froh, wenn sie nur einen Muskelfaserriß hätten. Da kommt ein Läufer, selbst ein gewesener Marathonläufer, gerade recht, das Läufer-Herz auszuschütten. Im Grunde genommen ist’s ja auch gleich, ob der Doktor in der Sprechstunde von seinen eigenen Beschwerden oder von denen des Patienten redet. Der Patient hat auf jeden Fall das Gefühl, der Doktor nehme sich Zeit. Dieses Gefühl haben Patienten meist zu selten. Läufer müßte man sein.
Seit Jahr und Tag obliege ich der Unsitte, beim Frühstücken Zeitung zu lesen. Inzwischen habe ich mich an die ständigen Angriffe auf meine Gemütslage dermaßen gewöhnt, daß sich offenbar Schwielen gebildet haben. Ich erwarte gar nichts anderes mehr als diese Nachrichten. Nur meine Reaktionen haben an Schärfe zugenommen. Was sich in der CSU abspielt, hätte ich früher als demokratischen Willensprozeß in Kauf genommen. Im Grunde ist es den meisten Bayern doch völlig wurscht, wer an der Spitze der Regierungspartei stehen wird. Ob nun Huber oder Seehofer der Partei vorstehen, wirkt sich auf die Gesetzgebung und die Umsetzung von Gesetzen nicht im mindesten aus. Jetzt ist mir klar, worum es in Wahrheit geht: Es geht um die Macht, die ganz persönliche Macht.
Ich habe keinen Anlaß, Politiker zu verteidigen. Aber ich meine, daß die Medien leichtfertig den Außenminister belasten. Was sich um den Bremer Türken Murat Kurnaz abgespielt haben mag, hat sich in einem rechtsfreien Raum abgespielt – Geheimdienste kungelten miteinander. Und der damalige Kanzleramtsminister hat offenbar nichts anderes getan, als der Sicherheit Priorität einzuräumen. Wieder einmal wird aus heutiger Sicht über Vergangenes geurteilt. Wer einen Türken aus Sicherheitsgründen nicht nach Deutschland zurück haben will. will damit nicht, daß der Mann für fünf Jahre unschuldig in einem Konzentrationslager verschwindet und gefoltert wird. Wahrscheinlich könnten amerikanische Behörden den ehemaligen Kanzleramtsminister entlasten, sie werden wie schon in der Vergangenheit die Aufklärung verweigern oder behindern. Amerikanische Interessen könnten dadurch berührt werden. Das Konzentrationslager Guantánamo, in dem wohl weniger Verdächtiges untersucht, als vielmehr Verdächtige gefoltert werden, ist ein Skandal demokratisch organisierter Gesellschaften.
Das einzige deutsche Regierungsmitglied, das es gewagt hat, öffentlich, wenn auch nur in einer lokalen Versammlung, das amerikanische Rechtssystem in Zweifel zu ziehen, die Jura-Professorin Hertha Däubler-Gmelin, wurde von Bundeskanzler Schröder, dem der amerikanische Präsident die Gratulation zur Wiederwahl verweigert hatte, aus dem Amt gejagt. Ob nicht so manchem inzwischen klar geworden ist, daß die Juristin mit ihrer kritischen Bemerkung, die vielleicht auch bloß flapsig gemeint war, völlig recht gehabt hat! Vielleicht ist das sogar jenem Journalisten klar geworden, der die Bemerkung politisch thematisiert und die Politikerin ans Messer angeblicher Staatsraison geliefert hat. Wenn ich die Zeitung lese, habe ich den Eindruck, es geht nur noch darum, wie weit es dem Bundesaußenminister, Steinmeier, gelingt, sich als ehemaliger Kanzleramtsminister zu rechtfertigen. Und die Grünen entblöden sich nicht, nun auf Steinmeier einzudreschen – als ob seinerzeit nicht auch ihr grüner Außenminister involviert gewesen wäre oder gewesen sein müßte! Warum verwenden Medien nicht einen Teil der Energie, mit der sie Steinmeier an den Pranger stellen, darauf zu recherchieren, was es denn mit Kurnaz für eine Bewandtnis habe. Was kann einen Türken, der in Bremen lebt, veranlassen, ausgerechnet nach Pakistan zu fliegen? Warum haben die amerikanischen Schergen einen Türken, mit dem sie nichts mehr anzufangen wußten, nicht in die Türkei geschickt, wo seine Ehefrau und andere Familienangehörige leben? Als ehemaliger Tageszeitungsjournalist sehe ich die Funktion von Druckmedien nicht deshalb durch das Internet ausgehöhlt, weil die „Blogs“ kostenlos sind, sondern weil politische Redakteure zu angepaßt sind. Das Streben nach „Political correctness“ hat das Rückgrat verbogen. Wider den Stachel des main stream zu löcken, gehört nicht mehr zum Berufsbild. Nur Rentner wie ich, die man nicht ernst nehmen muß, dürfen schreiben, was sie denken.
Der Mehrzahl der Amerikaner ist inzwischen wohl auch klar geworden, was sie an ihrem Schorsch Dabbelju Bush haben. Vielleicht wird sich eines Tages auch noch herausstellen, was ich befürchtet habe: daß es sich im Grunde um einen psychiatrischen Fall handelt. Schließlich ist die Wahrheit über Nixon ja auch erst nach Beendigung der Amtszeit herausgekommen. Nach der Auslegung der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse hätte Bush als Kriegsverbrecher zu gelten. Die amerikanische Auffassung von Demokratie, die zuoberst der Stabilisierung der Weltmachtrolle zu dienen hat, verhindert seinen Rücktritt.
Ich denke in den zeitgeschichtlichen Dimensionen, die ich erlebt habe. Jeder denkt so. Ich habe sowjetische Gefangenschaft überlebt und die Unberechenbarkeit der Russen erfahren, drei Tage war ich wegen illegaler Einreise in die amerikanische Besatzungszone auch im Gewahrsam der Amerikaner, wo ich erst über Vorgänge in der Sowjetzone verhört worden war und dann noch eine Geldbuße zahlen mußte. Ich meine, wer Deutschland unter der Zuchtrute der Besatzungsmächte erlebt hat, mißtraut gründlich den Beteuerungen von der „Rückkehr in die Völkerfamilie“. Wir sind gebraucht worden, nichts weiter. Der Demokratisierungsprozeß war ein Amerikanisierungsprozeß, nicht anders wie die Sowjetisierung in der sowjetisch besetzten Zone. Wir müssen das den Siegern über den Nationalsozialismus nicht vorwerfen, aber wir sollten ihre Motive, sich für Deutschland zu interessieren, nüchtern sehen. Wir brauchen Selbstbewußtsein. Wer sich zu Bush zitieren läßt, hat es nicht.
Meine Ruhetage habe ich mir – außer nach Marathon- und Ultramarathonläufen – jeweils nach dem Wetter genommen. Wenn es wie aus Kübeln schüttete, habe ich die Laufrunde ausfallen lassen. Am Donnerstag voriger Woche war es das erstemal, daß ich nicht wegen Regens zu Hause blieb – im Gegenteil, es wäre das schönste Laufwetter gewesen – , sondern weil Sturmwarnung gegeben worden war. Vielleicht wäre es zu dieser Stunde dennoch gegangen, aber ich habe die Warnungen ernst genommen. Ich habe an Ödön von Horvath denken müssen, den sozialkritischen Dramatiker, den ich schätze wie aus einer anderen literaturgeschichtlichen Epoche Henrik Ibsen und den frühen Gerhart Hauptmann. Horvath ist, nachdem er nach Paris emigriert war, 1938 auf den Champs Élysées von einem herabstürzenden Ast erschlagen worden. Auf meiner Strecke hätte diese Gefahr wohl kaum bestanden, aber wer weiß, was einem statt dessen um die Ohren hätte fliegen können! Scharfkantige Verkehrsschilder, Dachziegel, umknickende Ampeln...
Dabei genügt schon eine unbedachte Bewegung, nämlich sich unter dem Fensterbrett beim Entlüften der Heizkörper zu bücken, um sich an der scharfen Ecke ein Wundmal zu holen. Es ziert mich wie ein indisches Kastenabzeichen, sagt Marianne. Da ich ein Medikament zur Verhütung von Blutgerinnseln nehmen muß – mein Kardiologe will darüber nicht mit mir diskutieren –, blutet die kleine Wunde auf der Stirn über Gebühr. Also, auch oder gerade zu Hause, weil man dort ja die meiste Zeit verbringt, kann man zu Schaden kommen.
Empört bin ich, daß man an solchen Tagen einen Bahnhof, den neuen Berliner Hauptbahnhof, sperren muß, weil da gerade mal ein Stahlträger herabgestürzt ist.
| Da hat man im Mittelalter gotische Dome errichtet, die Jahrhunderte gehalten haben und weiter halten würden, wenn die Steine und Skulpturen nicht von unseren Abgasen angegriffen würden. Man hat im 19. Jahrhundert Bahnhöfe gebaut, die selbst die Eisenbahn überleben können, zum Beispiel den 1900 eröffneten Gare d’Orsay in Paris, den man vor nun zehn Jahren ohne weiteres als Museum umwidmen konnte, oder den in Baden-Baden, den man 1998 in ein Festspielhaus umgewandelt hat. |  |
|
|
Nach dem Paris-Marathon fotografiert: das damals neueröffnete
Musée d’Orsay im vormaligen Bahnhof
|
In Berlin macht man, nachdem Anhalter, Potsdamer und Görlitzer Bahnhof im Krieg zerstört worden waren, an der Stelle des Lehrter Bahnhofs mit Milliarden-Aufwand einen Hauptbahnhof. Dort fällt acht Monate nach der Eröffnung bei einem Sturm ein Stahlträger herunter. Ich mag nicht einen ganzen Berufsstand verunglimpfen; aber was sind das für Architekten! Und die Baubehörde des Bezirks Mitte hatte keine Bedenken gegen die Fassadenriegel mit unverschweißten Stahlträgern. Ich habe den Eindruck, Architekten profilieren sich auf Kosten der Handwerklichkeit (vielleicht widerspricht mein gleichaltriger Sportfreund v. S.). Ich habe an meinem Wohnort ein Beispiel vor Augen. Das sogenannte Stadthaus hat, so wollte es der Architekt, einen „Wasservorhang“, eine Kaskade vom Dach. Der „Wasservorhang“ ist, nicht gar so lang nach der Einweihung des Hauses, stillgelegt worden. Das Bauwerk mit „Wasservorhang“ ist preisgekrönt. Merke: Architekturpreise werden nicht von den Nutzern oder von Architekturkritikern, sondern von Architekten vergeben.
Wir finden die technokratische Selbstüberschätzung überall. Da havariert ohne nennenswerte politische Konsequenzen ein Atomreaktor, da zerplatzt, längst vergessen, eine Raumfähre, und die Auslieferung des Airbusses 380 verzögert sich, weil man sich überschätzt hat, genau wie während meiner Redakteurstätigkeit bei der Einführung der digitalen Satztechnik im Zeitungsbetrieb oder, noch in Erinnerung, bei der Einführung des Zählsystems auf der Autobahn.
Wer sich beim Marathonlauf überschätzt, merkt es, und zwar dermaßen, daß er es nie mehr vergißt. Wir brauchen offenbar die körperliche Erfahrung. Realität muß körperlich erfahren werden, das kann vor Selbstüberschätzung bewahren.
Es ist ja nicht so, daß ich abschreiben müßte, um Stoff fürs Tagebuch zu finden. Doch worauf mich der Hinweis von Dr. Stefan Hinze auf der DUV-Webseite gestoßen hat, treibt mich schon um, sollte jeden von uns hellhörig machen. Ja, wenn die Aussage so stimmte, müßten wir aufhören, Marathon zu laufen. Und wieso nicht auch aufhören, Halbmarathon zu laufen? Vielleicht sind auch schnelle 10 Kilometer schädlich? Hinze gibt am 3. Januar einen Bericht aus dem „Deutschen Ärzteblatt“ vom 7. Dezember 2006 wieder (aerzteblatt.de). Da steht nicht mehr und nicht weniger als „Marathonlauf schädigt Herzmuskel“. Kein Fragezeichen, sondern eine Feststellung. Da müssen zumindest wir mit dem Fragen beginnen. Wenn man es bei der Feststellung beließe, würde das nichts anderes bedeuten, als zu akzeptieren, daß wir allesamt mit dem Leben spielten. Sport ist Mord?
Das „Deutsche Ärzteblatt“, herausgegeben von der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, bezieht sich in seinen Nachrichten auf eine Untersuchung amerikanischer Kardiologen, die im letzten Sommer in „Circulation: Journal of the American Heart Association“ veröffentlicht worden ist. Danach hat eine Arbeitsgruppe von Tomas G. Neilan in den Jahren 2004 und 2005 vor und nach dem Boston-Marathon je 30 Teilnehmer, die nicht zur Elite zählen, kardiologisch untersucht. Die Experten fanden Bio-Marker (biochemical markers) für Streßbelastungen des Herzens durch den Marathon. Die biochemischen Marker schlossen eine Form von Troponin (cTnT) ein. Troponin ist ein Protein, das in den Muskeln enthalten ist. Die amerikanischen Kardiologen fanden nach dem Rennen erhöhte Troponin-Werte, und zwar auf einem Niveau, bei dem zu prüfen ist, ob eine akute Herzschädigung vorliegt. Zudem korrelierte dieser Befund mit diastolischen Fehlfunktionen. Die höchsten Troponin-Werte wurden bei solchen Läufern gefunden, die in den vier Monaten vor dem Rennen weniger als 56 Kilometer in der Woche trainiert hatten. Das eher dürre Untersuchungsergebnis ist sachlich überschrieben mit „Myocardial Injury and Ventricular Dysfunction Related to Trainings Levels Among Nonelite Participants in the Boston Marathon“.
Aus der quantitativen Bestimmung der Marker für kardiale Risiken macht das Ärzteblatt in seinem Bericht über die amerikanische Untersuchung und die einer deutschen Arbeitsgruppe schlicht: „Marathonlauf schädigt Herzmuskel“ und beginnt: „Nach einem Marathonlauf kommt es, vor allem bei weniger trainierten Sportlern, häufig zu Funktionsstörungen des Herzens. Ein Anstieg der kardialen Enzyme deutet darauf hin, daß Herzmuskelzellen irreversibel geschädigt wurden.... Eine deutsche Arbeitsgruppe fand sogar häufigere koronare Verkalkungen unter älteren Marathonläufern, deren klinische Bedeutung aber noch unklar ist.“ Um der Vereinfachung noch einen drohenden Unterton zu geben, weist das Ärzteblatt im nächsten Satz auf den Tod des Läufers von Marathon hin, bekanntermaßen eine Legende. Die Doktoren vom Ärzteblatt diagnostizieren: „Wahrscheinlich ein kardialer Todesfall und kein Einzelfall, glaubt man den Berichten aus Lokalzeitungen, in denen immer wieder über vereinzelte Todesfälle bei Marathonläufen gemeldet wird.“
Ich habe immer sehnsüchtig in den Garten der Wissenschaft geblickt, deren Zaun für mich in den ersten Nachkriegsjahren einfach zu hoch war, so daß aus mir bloß ein Journalist geworden ist, der nach einem Bonmot über alles nichts weiß – im Gegensatz zu Wissenschaftlern, die über nichts alles wissen. Doch solcher Umgang mit Erkenntnis wie hier im Ärzteblatt läßt mich an der Wissenschaft zweifeln. Den Läufer von Marathon als kardiologischen Beleg einzuführen, hat soviel Wert wie für einen Historiker der Versuch, die Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft an einem Wilhelm Tell aufzuhängen. Die Bastelei des Ärzteblattes wird komplettiert durch den Hinweis auf die Endorphine, den Rettungsanker für alle Laufpublizisten, die nicht weiter wissen. Das Ärzteblatt konstatiert: „Keiner (der untersuchten Teilnehmer des Boston-Marathons) hatte während des Laufs über kardiale Beschwerden wie Brustschmerzen oder Luftnot geklagt. Eine mögliche Erklärung könnte die Freisetzung von Endorphinen während des Marathonlaufs sein.“ Welche Logik – weil die untersuchten Läufer keine kardialen Beschwerden hatte, obwohl sie diese nach den krankhaften Befunden hätten haben müssen, haben die Endorphine die Symptome verdeckt. Versteht sich fast, daß in der amerikanischen Untersuchung kein Wort von Endorphinen steht. Und warum nur haben mich meine Endorphine beim Magdeburg-Marathon nicht vor dem Brustschmerz bewahrt! Und gleich noch eines drauf, ein weiteres Reizwort, damit es auch der doofe Patient im Wartezimmer begreift und weiterhin Bewegungsarmut für sicherer hält als Leistungssport: „Endorphine sind mit den Morphinen verwandt, die in der Klinik bei Herzinfarktpatienten eingesetzt werden.“ Na, haben wir doch immer gewußt, die laufen sich um Kopf und Kragen.
In dem Bericht „Marathonlauf schädigt Herzmuskel“ wird auf eine Marathonstudie des Westdeutschen Herzzentrums in Essen hingewiesen, diesmal jedoch relativ vorsichtig. In der Studie sind bei etwas über einem Drittel (36 Prozent) erfahrener Marathonläufer über 50 Jahre (108 Probanden) erhöhte Koronarkalkwerte gefunden worden, in der Vergleichsgruppe bei nichtlaufenden Männern jedoch nur bei 22 Prozent. Die Differenz von 14 Prozent veranlaßt zu der Aussage: „Die Bedeutung dieses Befundes ist noch unklar, scheint aber eine Gefährdung älterer Menschen durch Marathonläufe nicht auszuschließen. Durch die weitere Beobachtung der Gruppe über 5 Jahre wollen die Kardiologen aus Essen jetzt prüfen, bei welchen Menschen der Marathonlauf zu einem kardialen Risiko werden kann.“ Recht so, und bis dahin laufen wir, beziehungsweise meine Nachfolger, Marathon.
Es wäre ja schön, wenn der Deutsche Verband langlaufender Ärzte und Apotheker sich bei solchen Gelegenheiten zu Wort melden würde. Zumindest könnte er mir übers Maul fahren, schließlich haben Laien in der Wissenschaft nichts zu suchen, auch wenn sie herausfinden, daß die Axt, die das „Deutsche Ärzteblatt“ an unsere Wurzeln legt, ziemlich stumpf ist. Beispiel einer ähnlichen Simplifizierung gefällig? Bei Hitzeläufen kann die Körperkerntemperatur 41 Grad Celsius überschreiten. Das entspricht hohem Fieber, und dennoch ist es keines.
Am Dienstag die erste Runde im Neuen Jahr, vorbei an der Verkaufsfläche für Weihnachtsbäume. Dutzende stehen dort noch, insbesondere große, alle noch verpackt in dem Netzmaterial. Was geschieht mit ihnen? Eine ökologische Fehlinvestition, haben sie doch ihren emotionalen Zweck nicht erfüllt. Auf dem Weg Reste von Feuerwerkskörpern, im Gras und auf dem Acker weggeworfene Flaschen. Die Silvesternacht soll ruhig verlaufen sein. Im Kreisgebiet etwa vierzig Brände in der Nacht, habe ich in meiner Zeitung gelesen. Na dann geht’s ja. Wir sind aus der Zeitung stärkere und üblere Schadensmeldungen gewöhnt.
Über Neujahrsgrüße von Heinrich Gutbier aus seinem „Trainingslager“ auf Lanzarote habe ich mich überaus gefreut. Vor allem, weil ich ihn, als ich noch der alte Marathonläufer war, auf Veranstaltungen und in Listen vermißt hatte.
Heute sind offenbar die Schön-Wetter-Läufer unterwegs gewesen. Seit Wochen bin ich auf meiner Runde nicht mehr so vielen Läuferinnen und Läufern begegnet. Das milde Wetter lockt zum Laufen.
Die Zahl der Marathon-Teilnahmen ist rückläufig. Das ist zum Thema geworden. Ralf Klink hat sich am 24. November im LaufReport ausführlich damit befaßt, und Thomas Steffens hat den Rückgang der Marathon-Teilnahmen zum Thema seines Editorials im Januar-Heft von „Runner’s World“ gemacht. Die Website scc-events bringt eine Statistik der 25 teilnehmerstärksten Marathons in Deutschland; danach ist die Zahl der Finisher im Vergleich zum Jahr 2005 um 13,7 Prozent zurückgegangen. Die Moderatorin bei meinem Fernsehauftritt am 16. Oktober hatte den Beitrag mit den Worten eingeleitet: Der Marathonläufer werden immer mehr, und auch die Zahl der Marathon-Veranstaltungen steigt. Das macht sich in einem Beitrag über einen Marathonläufer gut. Sie hat ungeprüft übernommen, was jahrelang zu lesen war.
Zwar ist es schwierig, die Zahl der Marathonläufer zu präzisieren, aber der Rückgang der Zieleinläufe ist augenfällig. Zu Recht legt Ralf Klink nur die Zieleinläufe zugrunde und nicht die Zahl der Anmeldungen, die nicht selten erheblich über der Zahl der Starter liegt, aber im Grunde nicht nachprüfbar ist. Die Zahl der tatsächlichen Starter erfährt man meistens gar nicht. Man wäre gezwungen, sich jeweils die endgültige Ergebnisliste anzuschauen. Wer kann das schon für alle Veranstaltungen tun!. In der Moderation am Marathonstart wird häufig mit der Gesamtzahl der Teilnehmer eines Laufereignisses, also mit Halbmarathon und Kinderläufen, operiert. Die exakte Zahl der Zieleinläufe eines Hauptwettbewerbs hingegen erlaubt Vergleiche.
Die Fragestellung „Am Ende des Booms?“ halte ich für unangebracht. Laufen ist kein Boom. Auch der Marathon nicht. Wenn eine volkssportliche Aktivität seit etwa einem halben Jahrhundert betrieben wird, der Marathon für Volksläufer seit etwa vierzig Jahren – der erste Schwarzwaldmarathon hatte seinerzeit, 1968, Signalwirkung –, kann man schwerlich noch von einem Boom sprechen. Wer käme auf die Idee, Fußball als Boom zu bezeichnen! Anderenfalls müßte man Szenarien für das Ende des „Fußball-Booms“ entwerfen und nicht ein Stadion nach dem anderen in eine Fußball-Arena umwandeln. Ein elementarer Sport wie das Laufen, der sowohl Gesundheits- als auch Hochleistungssport sein kann, ist nicht mit Surfen, Inline-Skating oder anderen Trendsportarten zu vergleichen. Eine Kollegin hatte mir Ende der siebziger Jahre vorgehalten, der Zenit des Laufens sei ja wohl überschritten. Da stand die entscheidende Entwicklungsphase noch bevor! Ich bin Unkenrufe gewöhnt.
Ein Rückgang an Marathonteilnahmen bedeutet noch keinen Rückgang an Läufern. Weshalb aber mag es dazu gekommen sein, daß weniger Marathon gelaufen worden ist? Ich unterstelle, daß es sich nicht um einen vorübergehenden Knick in der Statistik handelt; denn 13,7 Prozent weniger sind schon signifikant und lassen sich nicht von einem Jahr aufs andere ausgleichen. Seit der Abwärtstrend erkennbar ist, habe ich mich auf meinen Lauf- und Gehrunden damit befaßt. Laufen eignet sich hervorragend zum Spekulieren. Am Schreibtisch will man mit gedanklichen Prozessen zu einem Ende kommen, beim Laufen setzt erst das Ziel das Ende der Spekulation, und man kann sie anderntags wieder aufnehmen, solange es einem gefällt.
Ich habe alle möglichen Gründe gefunden. Sie hängen mit Veränderungen in der Laufszene zusammen. Mit der quantitativen Ausdehnung finden wir immer mehr Menschen, die längst nicht mehr solche Anforderungen an sich selbst stellen, wie das in früheren Jahren, gar den Pionierjahren, der Fall war. Das zeigt sich seit Jahren schon in den sinkenden Durchschnittsleistungen beim Marathon.
Die Zahl der Läuferinnen hat mit Sicherheit erheblich zugenommen. Selbst auf meiner Laufrunde habe ich beobachtet, daß ich mehr Frauen begegne. Doch Frauen sind weniger wettbewerbsorientiert als Männer. Gewiss hat sich auch der Frauenanteil bei Laufveranstaltungen vergrößert, aber es scheint doch so zu sein, daß Frauen bis auf Ausnahmen weniger Marathons laufen als Männer. Man muß es nicht beklagen, es ist nur eine Erklärung.
Ich meine, daß auch demographische Veränderungen durchschlagen, zumindest durchschlagen werden. Für die Zukunft sollte man auch daran denken: Deutschland ist ein Auswanderungsland. Die Auswanderer sind in der Regel gut ausgebildet und aktiv in jeder Beziehung. Wenn man weiß, daß Läuferinnen und Läufer, gerade auch leistungsorientierte, eher aus der oberen Mittelschicht als der Unterschicht kommen (wieso ist ein solcher soziologischer Begriff auf einmal verpönt? Verdammte Heuchelei!), ist anzunehmen, daß unter denjenigen, die ins Ausland gehen, überproportional viele leistungsorientierte Läufer sind oder sein werden. Dieser jährliche Bevölkerungsverlust wird im Schnitt durch legale und illegale Zuwanderung wettgemacht, so daß die Einwohnerzahl der Bundesrepublik unter dem Strich gleich bleibt oder nur wenig sinkt. Die Einwanderer jedoch sind in der Mehrzahl beruflich minder qualifiziert; sie gehören einer Schicht an, die keinen Sport treibt, oder einer Kultur, in der Frauen keinen Sport treiben dürfen. Wer kennt schon Türken in seinem Sportverein? Wieviele Farbige sieht man nach der bezahlten Spitze in einem Marathon? Es wird allein infolge demographischer Veränderungen zu Rückgängen bei Lauf-Veranstaltungen kommen.
Gegenwärtig dürften jedoch mehr noch soziale und psychologische Faktoren ins Gewicht fallen. Der Marathon, vordem ein Wettbewerb derjenigen, die ihn ernst nahmen, ist zum Spektakulum geworden. Wir haben es mit dem City-Marathon so gewollt. Das bedeutet, daß von den Marathon-Veranstaltungen auch solche Menschen angezogen oder von den Medien dafür interessiert werden, die dies der sozialen Anerkennung oder der publizistischen Aufmerksamkeit wegen tun. Die hohe Zahl der Erstteilnehmer bei den großen City-Marathons zeigt, wie populär der Marathon geworden ist. Die Sogwirkung mag viele an den Start geführt haben, die nicht daran denken, damit eine Marathon-Karriere zu beginnen. Es ist anzunehmen, daß vielen der Erstteilnehmer die einmalige Teilnahme genügt. Sie wollen einmal das Erlebnis einer Herausforderung erfahren. Mein eigenes Beispiel: Ich habe an einigen wenigen Skimarathons teilgenommen. Das hat mir genügt, ich habe dann weiterhin Skilanglauf betrieben, aber eben überhaupt nicht leistungsorientiert. Warum soll es das beim Laufen nicht auch geben? Wenn es also bei der einmaligen Marathon-Teilnahme bleibt, – warum sollten wir das tadeln?
Der Rückgang der Marathon-Teilnahmen läßt mich vermuten, daß zahlreiche Teilnehmer fremdbestimmt zum Marathon gefunden haben. Sie sind Marathon gelaufen, weil so viele Marathon gelaufen sind. Doch die Herausforderung haben sie nicht verinnerlicht, die „Szene“ haben sie nicht entdeckt.
In die Spekulation ist auch die Beliebtheit von Halbmarathons einzubeziehen. Könnte es nicht sein, daß eine Anzahl von Läuferinnen und Läufern vom Marathon zum Halbmarathon abgewandert sind? Wenn man ihn nicht hochleistungsorientiert läuft, ist er halb so anstrengend wie ein Marathon. Darüber kann man ins Philosophieren kommen. Die meisten Menschen wollen sich nicht anstrengen.
Ich denke, das muß ich auf den nächsten Lauf- und Gehrunden vertiefen.
| Zu weiteren Tagebuch-Eintragungen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | |
| 2016 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2015 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2014 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2013 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2012 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2011 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2010 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2009 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2008 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2007 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2006 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2005 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2004 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2003 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2002 | Alle Eintragungen HIER | |||
| Zurück zur den aktuellen Eintragungen HIER | ||||
| Zu weiteren aktuellen Inhalten bei LaufReport.de | ||||