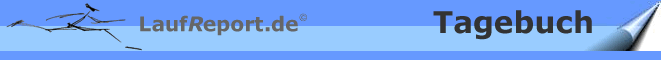

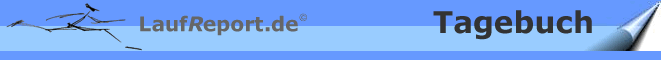  |
|
Laufen, Schauen, Denken Sonntags Tagebuch |
 |
Wenn ich auf das Jahr 2007 zurückblicke: Ich bin zufrieden. Nie hätte ich im Jahr zuvor gedacht, daß ich doch noch einen Marathon schaffen würde. Meine Absicht war es schon, aber als ich dann monatelang nur minutenlang traben konnte, war ich doch voll banger Zweifel. Es hat sich gelohnt, nicht aufgegeben zu haben. Es ist zwar auch jetzt nicht so, wie es vor der Bypaß-Operation gewesen war. Doch wer weiß, wie es ohne die Operation jetzt wäre? Der Damm war gebrochen, als ich den Rennsteig-Marathon beendet hatte. Im Juni die 100 Kilometer in Biel, gleich in welcher Zeit zurückgelegt zu haben, da war ich glücklich. Und schließlich in Berlin und in München einen Marathon, bis auf kurze Gehpausen an Verpflegungsständen, wieder laufend bewältigt zu haben, hat die Erfüllung meiner Wünsche bedeutet. Wer hätte gedacht, daß ich in diesem Jahr alles in allem doch noch 7 Marathons und einen Ultramarathon, dazu die Strecke Filisur – Davos zusammenbekommen würde!
Diese Aktivität im Bild dokumentiert zu bekommen, daran war mir gelegen. Ich darf das nun sogar zeigen; es ist mir bewilligt worden.
Ein Rückblick: Der erste, der individuelle Läuferleistungen photographierte, ist Günter Otte gewesen. Zwar gab es Sportphotographen, zum Beispiel den um den Laufsport verdienten Gustav Schröder; aber Günter Otte und seine Frau Brigitte waren in der Frühzeit des Volkslaufs offenbar die ersten und einzigen, die nicht primär Sieger, sondern Teilnehmer photographierten und die Bilder, Schwarzweiß-Abzüge, an jedermann verkauften. Günter Otte, inzwischen 80 Jahre alt – er hätte zum Geburtstag im vorigen Herbst eine Würdigung verdient gehabt –, war kein Profi, sondern ein Läufer, der sein photographisches Hobby in den Dienst der Läufer stellte. Als es dann die Laufzeitschriften „Condition“ und „Spiridon“ gab, waren die Hefte gespickt mit Otte-Photos. Auch in meinem Lauf-Ratgeber „Spaß am Laufen“ konnte ich auf Laufphotos von Günter Otte nicht verzichten. Otte ist vor allem durch seine Ergebnissammlung „Marathon im Spiegel der Aktiven“ bekanntgeworden. Seine Website heißt denn auch www.marathonspiegel.de. Seiner jährlich herausgegebenen Broschüre verdanken wir, daß die Schätzungen der Zahl der Marathonläufer in der Bundesrepublik Deutschland real waren.
Marathon zu laufen, vollzog sich anfangs in einer ziemlich familiären Atmosphäre; viele kannten einander. Der Vertrieb von Marathonphotos – und auch Photos von anderen Wettbewerben – war daher ziemlich unkompliziert. Man sah ja, ob Günter oder Brigitte Otte einen photographiert hatte, und wandte sich, wenn man ein Bild haben wollte, an die beiden Ottes. Amateurphotographen bei anderen Veranstaltungen handhabten es ähnlich.
Aus dem Steckenpferd hat sich ein Gewerbe entwickelt. Ursprünglich war auch das eine Manufaktur. Doch ein einzelner Photograph konnte die Aufgabe, möglichst jede Läuferin und jeden Läufer aufzunehmen, nicht mehr bewältigen. Ich erinnere mich zum Beispiel, daß sich in Biel die Photographen Gerber und Schild zusammentaten.
Wenn man ein Bild veröffentlichen, beispielsweise zu einem Erlebnisbericht stellen wollte, war es ganz einfach. Wenn man das Bild gekauft hatte, konnte man damit machen, was man wollte. Für die Veröffentlichung des eigenen Bildes bekam man ja auch kein Honorar. Nach dem Urheberrecht hätte man den Photographen um Genehmigung zur Veröffentlichung bitten müssen. Das habe ich, da ich das Urheberrecht verständlicherweise einigermaßen kenne, anfangs sogar getan. Die Photographen winkten ab: Selbstverständlich dürfe man das Bild veröffentlichen. Selbstverständlich war das nicht, aber diese Handhabung war praxisgerecht. Schließlich kauft man das Bild nicht so sehr, weil man es sich jahrelang betrachten will. Und ob die Enkel die Laufbilder ihres Großvaters so sehr schätzen, ist zu bezweifeln. Man kauft ein Teilnehmerphoto vor allem, weil man seine Teilnahme dokumentieren will – auch öffentlich. Man läuft vielleicht seinen 50. oder 100. Marathon oder man feiert einen runden Geburtstag, und dem Lokalblatt ist es einen Artikel wert. Wer mag dann einen Läufer im Anzug mit Krawatte abbilden?
Manche großen Marathon-Veranstalter, zum Beispiel der Berlin-Marathon, fordern ihre Teilnehmer ausdrücklich auf, über ihre Teilnahme einen Bericht für den Lokalteil ihrer Heimatzeitung zu schreiben. Mag auch die Redaktion aufgeschlossen sein, – ohne ein Bild geht es nicht. Doch die Situation ist heute anders als zu Günter Ottes Zeiten. Den Berlin-Marathon bedient neuerdings eine Photoagentur namens actionphoto. Die Zentrale sitzt in England. Selbst dieses Gebiet hat die Globalisierung nicht verschont. In den Nutzungsbedingungen steht ausdrücklich, jede Verwendung des Bildes sei honorarpflichtig, und das Honorar sei vorher zu vereinbaren. Das ist juristisch korrekt, aber völlig praxisfern.
 |
Nehmen wir einmal an, ich hätte mich an meine Tageszeitung mit dem Ansinnen gewandt, über meine Teilnahme am Berlin-Marathon zu berichten; ich war schließlich der älteste Teilnehmer dort. Etwa drei Tage nach dem Berlin-Marathon waren zwar meine Bilder im Netz; aber selbst wenn ich sie sofort gekauft hätte, wären sie mir noch nicht zur Verfügung gestanden. Mindestens vierzehn Tage hätte ich auf die Zusendung warten müssen. Ein Bericht drei Wochen nach dem Ereignis? Da ist das Thema längst gestorben. Es müßte also die Möglichkeit bestehen, sofort nach dem Kauf das ausgewählte Bild herunterzuladen. Die Photoagenturen sollten sich diese Notwendigkeit überlegen. Wenn ich aber das Bild tatsächlich nach drei Tagen der Redaktion hätte übermitteln können, hätte dies nach den Nutzungsbedingungen bedeutet, daß ich den Redakteur danach fragen müßte, ob er das Bild der Agentur honorieren könne und in welcher Höhe. | |
Auch die Auflagenhöhe müßte ich erfragen und der Photoagentur übermitteln. Wahrscheinlich hätte der Redakteur aus grundsätzlichen Erwägungen erst mit dem Chef vom Dienst sprechen müssen, und ich bin mir bei einer Provinz-Zeitung mit sparsamem Etat nicht sicher, ob nicht gar der Verleger bemüht worden wäre. Dann hätte mir die Agentur, wenn sie nicht sogar selbst eine Forderung gestellt hätte, ein „Einverstanden“ signalisiert, dies aber auch nicht in der ersten Stunde. Wenn dieses Procedere einem Redakteur klar geworden wäre, würde seine Reaktion todsicher lauten: Ach, dann lassen wir’s lieber. Und ich müßte ihm recht geben.
|
Um die Erlaubnis, ein während des München-Marathons entstandenes und von mir gekauftes Photo an dieser Stelle veröffentlichen zu dürfen, mußte ich erst einmal warten; Lauren von Global-Pix Customer Services entschuldigte sich mit Schwierigkeiten beim e-mail-System. Joanna von Customer Services schrieb mir dann, obwohl ich meinen Wunsch klar geäußert hatte: “Sind Sie wollen ein Bild zu veröffentlichen? Können Sie mir sagen, was die Veröffentlichung ist? ... Wir verkaufen können Bilder für die Veröffentlichung bestimmt, aber das ist beschlossen, auf eine von Fall zu Fall entschieden. Wir möchten auch wissen müssen, dass Sie die Erlaubnis der Person auf dem Bild zu veröffentlichen, das Bild.“ Abgesehen davon, daß ich mir selbstverständlich und unverzüglich die Erlaubnis zur Abbildung erteilt habe, war Joanna so freundlich, Ihre e-mail auch in ihrer englischen Muttersprache abzufassen. Daher konnte ich sie verstehen. |
 |
|
Im Hinblick auf die Verwendung eigener Bilder sehe ich Handlungsbedarf. Marathon-Veranstalter, die einen Vertrag mit einer Photoagentur abschließen, sollten auf eine praxisnahe Änderung der Nutzungsbedingungen für Käufer dringen. Es geht nicht darum, Photographen um ihren Verdienst zu bringen. Zweck eines Photoservice bei Laufveranstaltungen ist es, Läufer zu Kunden zu machen. Honorare von Medien lägen dagegen im Promille-Bereich, den man daher vernachlässigen kann. Allein der Marathon-Veranstalter entscheidet, wer den Photo-Service bestreitet. Er sollte im Interesse der Läufer einen Service wählen, der den Bedürfnissen der Läufer – dazu zählt die Verwendung des eigenen Bildes zur Publikation – gerecht wird. Selbstverständlich ist nicht gemeint, daß jemand ein Dutzend der schönsten Läuferbilder kauft und damit kostenlos seine Reportage über den Berlin-Marathon illustriert. Es muß sich um das eigene, gekaufte Bild handeln. Man soll mir nicht entgegenhalten, damit würde das Urheberrecht ausgehebelt. Auf der anderen Seite wird ja durch die Marathon-Teilnahme auch das Recht am eigenen Bild aufgegeben. Wenn mich jemand photographieren sollte, falls ich kläglich am Kurfürstendamm säße, weil ich nicht weiß, wie ich’s zum Brandenburger Tor schaffen soll, kann ich mich nicht wehren, auch dann nicht, wenn das Photo im „Stern“ erscheinen sollte. Als Marathon-Teilnehmer werde ich zur Person der Zeitgeschichte. Die meisten Veranstalter weisen auch darauf hin, daß man sich mit Photo- und Filmaufnahmen einverstanden erklären muß, ohne dafür ein Honorar beanspruchen zu wollen. Ich meine, die Juristen unter uns müßten zugeben, daß in dem Dreiecks-Verhältnis Marathon-Veranstalter, Teilnehmer und Photo-Service im Hinblick auf die Interessenwahrung die Gewichte ziemlich gleichmäßig verteilt sind. Das Urheberrecht konnte diese Verteilung nicht berücksichtigen.
 |
Und was, wenn Marathon-Veranstalter und Photo-Agentur mit den Schultern zucken? Wenn sich auf diesem Gebiet nichts rührt, dann werde ich kein Photo mehr kaufen. Vielleicht steht an Start oder Ziel ein Sportfreund mit Digitalkamera, der einen Schnappschuß macht, vielleicht sogar unterwegs. Apropos, in Biel hat uns, Ingeborg, Helmut Urbach und mich, genau ein solcher Sportfreund freundlicherweise am Start photographiert. Wir haben zwar das Bild, aber keiner von uns dreien weiß mehr, wer der Photograph gewesen ist. | |
Bitte, melden! Falls es innerhalb der nächsten hundertundpaar Jahre der „Stern“ veröffentlichen sollte, sollen der Photograph und seine Erben nicht leer ausgehen.
Gestern bei Vollmond gelaufen, es war nachmittags in der sechsten Stunde. Seltsame Stimmung. Ob wir in Biel zum fünfzigsten eine solche Stimmung erleben können? Heute ist Winteranfang, den Winter mit Kälte und Frost haben wir schon eine Weile. Wie einst die vorchristlichen Menschen freue ich mich auf die Wintersonnenwende. Dann verkürzt sich die Dunkelheit, die in mein Lauftraining einfällt, zunächst unmerklich von Tag zu Tag. Wie uns das Laufen doch zum Rhythmus der Natur zurückführt! Schon deshalb ist Laufen oder sagen wir es modern: Outdoor-Sport ein Gewinn.
Unchristliche Gedanken bewegen mich in diesen Tagen vor Weihnachten. Was Wunder! Das christliche Fest ist – zunächst über die Folklore, dann den Kommerz – längst zum Dekorationsartikel geworden. Erleuchtete Tannenbäume pünktlich seit dem ersten Advent, die Schokoladen-Weihnachtsmänner im Großhandel weit früher, die Nikolaus- oder Weihnachtsmann-Mützen als vorgezogene Karnevalskostümierung, unterwegs an meiner Laufstrecke Weihnachtsbeleuchtung, mit einem Klick an- oder abzuschalten. Automatische Springlichter sollen Lichterketten übertrumpfen.
Meine Bank, die mir mein Geld aufhebt und dafür Gebühren verlangt, während sie mein Geld verleiht, hat die sächsische Landesbank gekauft. Bank-Insolvenzen werden zumal heute gern durch Übernahmen verschleiert. Im Jahr 1974 die Herstatt-Bank in Köln und später auch eine Bank im schweizerischen Zug, berüchtigt ob seiner Domizilfirmen, gingen offen in Konkurs. Bei Herstatt hatten die „sechs Goldjungs“, knapp über 20 Jahre alte „Bankmanager“, das Geld der Bank verspekuliert. Banken, an denen Bundesländer beteiligt sind, wurden gestützt, die Westberliner Landesbank, die West-LB und nun auch die zwangsverkaufte Sachsen-Bank. Die Krise auf dem nordamerikanischen Immobilienmarkt hat zu immensen Verlusten deutscher Banken geführt. Zunächst war abgewiegelt worden, nun wird zugegeben, daß die Verluste höher als befürchtet sind. Der Fluch der gepriesenen Globalisierung und doch auch offensichtlich mangelnde Kompetenz von Bankmanagern und ihren politischen Aufsichtsorganen... Banken haben sich immer den Anstrich höchster Seriosität gegeben, von der Feierlichkeit der Architektur bis zur Krawatte der „Goldjungs“. Allein die Fachsprache, das Chinesisch der Aktienmanager, dient der Verschleierung des Nichtwissens, der puren Spekulation in Geldgeschäften.
Ich wundere mich, daß wir noch immer so vertrauensvoll sind. Wahrscheinlich, weil der nächste Währungszusammenbruch immer erst die nächste Generation, die den vorangegangenen nicht bewußt erlebt hat, voll trifft. Ich habe eine Stunde darauf verwendet, im Internet zu recherchieren – nur ganz oberflächlich und lückenhaft. Was ich zutage gefördert habe, ist erschreckend. Schon die älteste Notenbank der Welt, die 1656 gegründete Palmstruchska-Bank in Schweden ging fünf Jahre später in Konkurs; Palmstruch hat die Banknote als Zahlungsmittel eingeführt. Goethe, ohne jegliches Volkswirtschaftsstudium, hat die Luftnummer erkannt und im zweiten Teil des „Faust“, den eh keiner liest, glossiert. Lange Zeit war das Papiergeld wenigstens noch zum Teil durch Goldwährung gedeckt. Spätestens seit Hitler ist das nicht mehr der Fall; mit Gold kann man keinen Krieg führen. Die Milliarden, die jetzt bei den Banken verpufft sind, erweisen sich in Wahrheit als buchmäßige Verluste, so sinniere ich. Was keineswegs beruhigend ist. Denn wenn die Verluste nicht real sind, dann sind es auch die Bestände nicht.
1841 meldete die Second Bank Konkurs an. Die erste Weltwirtschaftskrise 1857 begann mit der Zahlungseinstellung durch die Ohio Life Insurence Company, habe ich gelesen. 1901 machte die Leipziger Bank Konkurs, 1904 wurde die in Schieflage befindliche Oberrheinische Bank übernommen, 1931 brach die Danat, eine Fusion von Darmstädter und Nationalbank, zusammen. In der Weltwirtschaftskrise Anfang der dreißiger Jahre hätte auch die Continental Illinois National Bank and Trust Company Konkurs anmelden müssen; aber nach der Banker-Regel „Too Big to Fall“, auch so einer Beschwichtigung, überlebte sie. In Italien standen 1933 vor dem Konkurs: Banca commerciale, Credito italiano, Banca di Roma. Günter Ogger, auch einem breiten Publikum durch seine „Nieten in Nadelstreifen“ bekannt, zählt in „Die EGO-AG“ (2003) an zahlungsunfähigen Banken auf: Allied Irish Banks (AIB), Bayerische Landesbank, Deutsche Pfandbriefbank, die Monaco-Niederlassung der Britischen Bank (HSBC), Paine Webber, Salomon Smith Barney, Schmidtbank, Sparkasse Tettenheim-Schindlar, Sparkasse Mannheim, Spectrum 7. Nach Krisen ging das Bankhaus Löbbecke 1983 zugrunde. Nur durch Verkauf konnte die Österreichische Bank für Arbeit und Wirtschaft (BAWAG) vor der Anmeldung der Insolvenz gerettet werden. 2002 wurde die Beogradska Bank geschlossen. Über einschlägige Vorfälle im Bankenwesen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion wissen wir nichts. Nicht zu reden ist von ernsten Schwierigkeiten, in denen auch heute deutsche Banken stecken oder in den letzten Jahren gesteckt haben. Ich werde mich hüten, Namen zu nennen, meine Rechtsabteilung ist unterbesetzt.
Im Internet und unter den Anlageberatern gibt es Spezialisten für die Furcht vor dem Crash. Sie wissen zwar auch nicht, wie es besser gehen könnte, aber sie bekommen im Falle des Falles recht. Eine Erkenntnis habe ich mir jedoch gemerkt: Ersparnisse sollte man nicht einer einzigen Bank anvertrauen. Weiß man denn, ob beim nächsten Absturz ein politisches Netz gespannt ist?
Für viele mag meine Betrachtung der reine Zynismus sein; sie haben im Sinne des Wortes nichts zu verlieren, sie leben von der Hand in den Mund. Meine Generation – daher wohl plaudere ich so gelassen dahin – hat einen Trost; wir messen das pekuniäre Schreckensscenario an unserer Vergangenheit. Wessen Existenz auf ein Überleben im Erdloch geschrumpft war, auf den glücklichen Zufall eines „Heimatschusses“, auf die geglückte Flucht aus den Flammenhöllen von Hamburg oder Dresden, aus dem Überleben hinter Stacheldraht, aus dem Überstehen einer Vertreibung, die sich nicht aufs Vertreiben beschränkte – alles politisch inkorrekt, ich weiß –, der sagt sich: Schlimmer als in jener Situation kann’s im Leben (wahrscheinlich) nicht kommen. Insofern verstehe ich die Weihnachtsbotschaft, die Reduzierung eines Menschenlebens auf die Liegestatt in einer Krippe von Ochs und Esel, und dennoch die Hoffnung nicht zu verlieren.
Wir werden die Krippe am Montag wieder aufstellen.
Immer wieder einmal wird Lauf-Thematik verdrängt durch aufwühlende Ereignisse. Wühlt es eigentlich noch auf, wenn ein toter Säugling gefunden wird? Doch wenn eine Mutter ihre fünf Kinder umbringt, wenn diese Nachricht die vorangegangenen Meldungen von verhungerten oder zu Tode mißhandelten Kindern als unbedeutend erscheinen läßt, dann ist der Punkt erreicht, bei dem nicht nur Politiker sich aufgerufen fühlen müssen.
Es ist nicht Zynismus, wenn ich daran erinnere, daß es Kindstötungen auch früher schon gegeben hat, die Ermordung von Neugeborenen. Das Gretchen-Drama in „Faust“ erster Teil zeigt uns doch, daß uneheliche Geburten Existenzen gesellschaftlich vernichtet haben. Selbst der christliche Bundeskanzler Adenauer noch benützte Willi Brandts uneheliche Herkunft als politische Waffe. Heute wird aus der unverheirateten Mutter eine „Alleinerziehende“. Na und? Insofern ist die Gesellschaft – es fällt mir angesichts der Kriege und der staatlichen Schurkereien schwer, dies so zu formulieren – humaner geworden. Andererseits: Daß eine Mutter mit eigener Hand ihre heranwachsenden Kinder umbringt, scheint mir selbst für das dunkle Mittelalter nicht denkbar zu sein. Beruhigen wir uns nicht mit dem Gedanken, es handle sich ja um eine psychisch gestörte Frau. Auch wenn sie juristisch nicht schuldfähig sein sollte, da ist doch etwas, das aus dem Lot geraten zu sein scheint. Vergessen wir nicht, die Psychiatrie ist erst im 19. Jahrhundert erfunden worden. Wer in der Zeit davor gemordet hat, war schuldig, es gab einfach keinen Psychiater, der dem Richter Stichworte fürs Urteil hätte geben können. Auch in der Düsternis psychischer Verwirrung gibt es Ahnungen, eine Scheu im Wahn. Goebbels hat seine Kinder – wen wundert’s – in ideologischer Verblendung umgebracht, die Ratio war keineswegs ausgeschaltet, im Gegenteil. Doch hier hat eine Mutter das, was von Zoologen Brutpflegetrieb genannt wird, als nicht mehr vorhanden offenbart. Wie kann es dazu kommen?
Erwarte keiner, daß ich eine Antwort gebe. Denn gesellschaftlich ist diese Frage nicht einmal gestellt worden. Kindstötungen beruhen, anders als die massenhafte Tötung von Menschen durch Politik-Versagen, nicht auf Kalkül. Im Dreck zurückgelassene, zu Tode gequälte, verdurstete und verhungerte Kinder sind ein grausames Überforderungssyndrom.
Es ist wichtig, zunächst einmal die Kinder zu schützen. Insofern ist die politische Forderung nach Vorsorgeuntersuchungen in regelmäßigen Abständen berechtigt. Doch dieses Netz ist viel zu weitmaschig. Man kann nicht alle Kleinkinder jede Woche beim Gesundheitsamt vorführen und auf blaue Flecken oder Unterernährung untersuchen. Man kann durch Kontrolle – haben die Liberalen eine andere Antwort? – und Berastungen nur versuchen, Unterlassung und Gewalt gegen Kinder zu minimieren. Präventiv muß man bei den Müttern und, versteht sich, auch bei den Vätern ansetzen. Offenbar sind uns auch Instinkte wie im Tierreich der Brutpflegetrieb verloren gegangen. Wir sind immer mehr durch die Ratio gesteuert, der Fluch der Ratio ist, daß wir in heillosen Situationen keine emotionale Hemmschwelle mehr haben. Gefühlsbindungen sind abhanden gekommen oder pervertiert. Die Natur hat aufgehört, uns zu lenken, uns auch im Katastrophenfall vor dem schlimmsten zu bewahren.
Ein Zurück gibt es nicht. Wir müssen als Kinder der Aufklärung mit der Herrschaft der Ratio leben. Das bedeutet, wir müssen dem tödlichen Überforderungssyndrom in der Familie rational begegnen. Liebe kann man nicht einimpfen. Der emotionale Appell versagt. Wenn Kinder nerven – und das, weiß Gott, können sie –, kann vor Fehlreaktionen eben nicht mehr allein die Liebe schützen, die Zuneigung, der Familiensinn oder wie immer man die hier aufgerufene Emotion nennen will. Die Konsequenz ist: Wir müssen Erziehung lernen.
Darüber müssen wir nachdenken. Es genügt nicht, dem Buchmarkt zu vertrauen. Überforderte oder gestörte Mütter und Väter lesen wahrscheinlich nicht. Abgesehen davon, daß auch das passieren kann: Noch in den sechziger Jahren war eines der verbreitetsten Erziehungsbücher eines aus der Nazi-Zeit, „Die Mutter und ihr erstes Kind“ von der Ärztin Dr. Harrer, die Härte anempfahl; Säuglinge solle man schreien lassen. Aus der Kehrtwende, der Abkehr von geradezu verbrecherischer Pädagogik, ist die 68er-Maxime des laisser faire erwachsen.
Man kann die Aufgabe, Erziehen zu lehren, auch nicht wie so vieles der Schule aufbürden. Schon deshalb nicht, weil selbst Lehrer, die gute Erzieher sind, Fehler machen und damit bei ihren Schülerinnen und Schülern an Kompetenz verlieren können. Man muß ein Klima schaffen, in dem Erziehung wieder einen höheren Stellenwert erhält. Daß dies möglich ist, zeigt die Verkehrserziehung. Die Rate der tödlichen Unfälle ist eben nicht nur durch die Erhöhung der inneren Sicherheit bei Kraftfahrzeugen erheblich vermindert worden. Ich meine, daß hier die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten einen gesellschaftlichen Auftrag haben. Sie erhalten von uns Gebühren, damit sie gesellschaftliche Aufträge wie Information unabhängig von Werbeeinnahmen erfüllen können. Von drei Sendern werden in je einer wöchentlichen Sendung Informationen über gesunde Lebensführung und die Therapie von Krankheiten vermittelt. Das hoffentlich nicht, um die Hypochonder unter den Fernzuschauern zu bedienen. Wir werden öffentlich-rechtlich und auch von privaten Sendern vor Abzockereien gewarnt und über unsere Rechte als Verbraucher belehrt. Warum sollte man nicht Erziehung zum Ratgeberthema machen können? Erziehungssituationen können so spannend sein wie die Gerichtssendungen im Fernsehen. Wir brauchten einen Oswalt Kolle für die Pädagogik. Ein Scherz.... Doch es müßte einem Arbeitskreis von Psychologen und Pädagogen, von Familienberatern und Jugendamts-Praktikern gelingen, sich anbahnende Erziehungskatastrophen darzustellen und Hilfe zu ihrer Verhütung anzubieten. Wie auf dem Gebiet der Gesundheit kommt es beim Schutz der Kinder, vor allem der Säuglinge und Kleinkinder, die sich nicht artikulieren können, auf Prävention an. Die gegenwärtige Familienministerin hat sich mehr als andere ins Gespräch gebracht. Wir wollen ihr das nicht übelnehmen; vielmehr gilt es, das Gewicht der Familienpolitik für die Prävention zu nutzen.
Vielleicht kann sogar das Laufen helfen. Gemeinsame Aktivität mit Kindern bedeutet Zuwendung, und sie ist das wichtigste. Es gibt doch spielerische Laufvarianten für Kinder, der 100-m-Wettlauf mit den Eltern, das Fahrtspiel, das Fangen. Vielleicht denken die in Bad Lippspringe ausgebildeten Lauftherapeuten weiter darüber nach.
Nun will ich doch wieder vom Laufen reden. Informationen haben mich erreicht. Der Monaco-Marathon, den ich im November 2005 gelaufen bin, läßt mich wissen, daß der Termin aufs Frühjahr verlegt worden sei. Warum nicht? Zwar herrscht im Frühjahr mehr Gedränge als im November, aber die Riviera ist sicher am 30. März, dem Marathon-Termin im nächsten Jahr, attraktiver als im November.
Der Stuttgarter-Zeitung-Lauf bekommt nun, wie sich abgezeichnet hat, eine neue Strecke, der Halbmarathon wird von der Schleyer-Halle beim Daimler-Stadion in die Innenstadt führen. Offenbar haben die Stadtmarathons und ihr Publikum den Württembergischen Leichtathletik-Verband nicht unbeeindruckt gelassen.
Der Adventsmarathon war ein Frühlingsmarathon. Manche liefen tatsächlich in kniefreien Hosen oder mit nackten Waden. Zum 8. Mal habe ich am Arolser Advents-Waldmarathon teilgenommen. Doch in den Waldungen um Arolsen bin ich weit öfter gelaufen. Heinrich Kuhaupt hat daran erinnert, an meine Probeläufe, auch an den Test der Strecken von „100 Kilometer in drei Tagen“.
Reminiszenzen an die Jahre, in denen sich der Stadtrat Karl Kuhaupt darum bemühte, Arolsen als das deutsche Ausdauersportzentrum aufzubauen, mit Ernst van Aaken als Galionsfigur; auch Professor Klaus Jung war hier angetreten. Nun ist Arolsen „Bad“, aber vom Ausdauersportzentrum sind im Grunde nur der Lauftreff, die Finnenbahn, der Marathon und eine Ausdauersportwoche, diese mehr als interne Traditionsveranstaltung, geblieben. Mögen die Pioniere resignierend auf ihren Griff nach den Sternen zurückblicken – mich eingeschlossen, wenn ich an das Projekt eines Laufmuseums denke –, so muß man doch mehrerlei berücksichtigen: Das Potential einer Kleinstadt ist einfach zu gering, wenn wir es beispielsweise mit den Aktivitäten des SCC in Berlin vergleichen, die sich ja keineswegs im Berlin-Marathon erschöpfen. Im Grunde gibt es heute Dutzende von Ausdauersportzentren, zumindest bei jedem Stadtmarathon ist ein Ausdauer-Umfeld aufgebaut worden, vom Kinderlauf bis zum Inline-Skate-Rennen, von der ganzjährigen Streckenmarkierung bis zur Rahmenveranstaltung. Kein Grund also, in Bad Arolsen zu resignieren. Ist es nicht auch schon etwas, wenn der Marathon im touristischen Prospekt aufscheint? Der Stuttgart-Lauf, auch wenn er der zweitgrößte deutsche Halbmarathon ist, hat es soweit nicht gebracht.
|
Erinnerungen verbinden mich mit Bad Arolsen, an die erste Begegnung mit Karl Kuhaupt 1976 oder 1977 beim Marathon auf der klassischen Strecke nach Athen, an die Projekte, in die ich eingebunden wurde, an den Verband langlaufender Ärzte und Apotheker, der sich hier für eine Ausdauersportwoche engagierte, an die IGÄL, die sich in Arolsen jährlich versammelt hat, und die Deutsche Ultramarathon-Vereinigung, die in Arolsen ihre Jahresversammlung abhielt. Am Samstag also bin ich wieder den Marathon in Bad Arolsen gelaufen. Doch bin ich ihn gelaufen? Ich fürchte, ich bin ihn zum großen Teil gegangen. Ich muß die Erinnerung bemühen, um meine 6:33:01 Stunden zu akzeptieren. 1988 bin ich ihn wirklich gelaufen, in 4:06:52. Kenner behaupten, bei dieser Strecke müsse man 20 bis 30 Minuten zu seiner üblichen Marathonzeit hinzuschlagen. |
 |
|
|
Adventsmarathon 1988 in Eis und Schnee. Foto: Dietrich
Rose
|
Inzwischen gibt es eine ganze Anzahl anderer Landschaftsmarathons, bei denen man das tun muß, ja, bei denen man noch ganz andere Zuschläge kalkulieren muß. Es sind nicht nur die langgezogenen Steigungen, die freilich im Vergleich zu den alpinen Strecken geringfügig sind, es ist auch die Wegbeschaffenheit. Ich habe die Strecke unter ganz unterschiedlichen Bedingungen erlebt, bei Eis, Schnee und Kälte und am 1. Dezember nun wie im Frühling, mit aufgeweichtem Boden, Pfützen, aber auch kilometerweit aufgebrachtem Schotter. Im Alter von 70 Jahren hier 4:46:41 zu laufen, war ja ganz in Ordnung, und 5:45:15 vor fünf Jahren ist auch nicht so schlecht, wenn ich berücksichtige, daß ich da 77 Jahre alt war. Nun also mehr als sechseinhalb Stunden, eine Stunde länger als bei Stadtmarathons. Ich meine, der Malus für die Arolser Strecke vergrößert sich mit dem Alter, aus der halben wird schließlich eine ganze Stunde. Eine andere Frage ist, ob man da noch Marathon laufen und gehen muß. Ich habe versucht, öffentlich eine Antwort zu finden: Die einzige Konsequenzen aus der demographischen Veränderung der Alterspyramide können doch nicht sein, daß das Renteneintrittsalter erhöht und die Zahl der Pflegeheimplätze vermehrt werden. Gegenwärtig erscheint in der Lokalzeitung noch ein Bericht, wenn man in der M 80 zum Marathon startet. Wir müssen soweit kommen, daß dies zu einer Selbstverständlichkeit wird, auch wenn sich dadurch die Zeiten nicht erheblich verbessern. Sicher, ich starte zum Marathon, um die Herausforderung weiterhin anzunehmen. Ich starte aber auch demonstrativ, um die M 80 mit Leben zu erfüllen. Der Marathon setzt Maßstäbe. Ich weiß, daß ich längst nicht an die Leistungen von Dr. Heinrich Gutbier und anderen heranreiche. Doch wo stehe ich? Dazu brauche ich den Wettbewerb in M 80, auch wenn er primär ein Kampf gegen die Strecke ist. Ich sehe eine Aufgabe darin, durch meine Teilnahme an Wettbewerben läuferische Perspektiven aufzuzeigen, auch wenn ich weiß, daß diese Aktivität endlich ist.
Immer im Blick habe ich die Interessen der Veranstalter. Ich will nicht, daß man wie bei der Deutschen Marathon-Meisterschaft 1967 in Stuttgart, die ich beobachtete, ohne selbst schon Marathon gelaufen zu sein, die Hände zusammenschlägt, weil der Letzte noch immer auf der Strecke ist. Ich will keine Extrawurst. Doch über die Tagebucheintragung, in der ich mir wünschte, noch einmal in Bad Arolsen laufen zu können, eröffnete mir Karl Kuhaupt eine Perspektive. Seit Jahren schon sei es möglich, eine Stunde früher zu starten. Zu der Zeit, als Walter Stille dies tat, hielt ich nichts davon. Nach meiner Ansicht wird dadurch das Bild des Wettkampfes für das Publikum verfälscht. Doch beim Advents-Waldmarathon gibt es kein Publikum, jedenfalls nicht für die Letzten. Ich meinte, den „Frühstart“ akzeptieren zu können, zumal da ich nicht der einzige sein würde. Am 1. Dezember standen wir zu neunt eine Stunde vor dem allgemeinen Start an der Startlinie am Twistesee. Es war eine neue Erfahrung für mich. Ich hoffe, sie war auch für die anderen nicht negativ. An unseren Startnummern waren wir eindeutig als diejenigen zu erkennen, die bereits eine Stunde länger unterwegs waren. Einen Vorteil haben wir daraus nicht gezogen; sollten andere als Pacemaker gedient haben, dann war dies allenfalls für einige hundert Meter. Für den Zeitnehmer wäre es gehupft wie gesprungen, ob er nun eine Stunde früher oder eine Stunde länger seines Amtes walten müßte. Doch Heinrich Kuhaupts Argument sticht: Am allgemeinen Start um 11 Uhr wolle man festhalten, weil die meisten erst vor dem Start anreisen; um 16.30 Uhr jedoch werde es dunkel. Nach meiner eigenen Erfahrung hat sich dieses Konzept des vorgezogenen Starts für die „Leistungsgeminderten“ bewährt. Ich bin dankbar, daß sich hier eine legitime Möglichkeit bot, einen in jeder Hinsicht klassischen Landschaftslauf zu absolvieren.
Nach fünf Jahren war es besonders schön, die Strecke wiederzuerkennen – bis auf wenige hundert Meter in Braunsen ein reiner Landschaftslauf, dessen Strecke mich ja vor Jahren schon begeistert hatte. Dann das Umfeld, das familiäre, auch im Sinne des Wortes, an den Schaltstellen jeweils ein Mitglied der Großfamilie Kuhaupt. Typisch, jedoch auch unverwechselbar die Atmosphäre in der Twisteseehalle oberhalb des Twistesees, dessen Anlegung all die läuferischen Aktivitäten angestoßen hat, auf den Tischen die Tannen- oder Fichtenbaumzweige und die Flämmchen, die zu meinem Mißvergnügen Hindenburglichter heißen. Mit Heinrich Kuhaupt teile ich das Bedauern, daß sehr viele Teilnehmer diese Zeit der in archaischen Vereinsberichten als „gemütliches Beisammensein“ bezeichneten Marathon-Nachbereitung nicht mehr auskosten können. Wer es freilich allzu sehr tut, bekommt die Stühle auf den Tisch gesetzt. Kann man auch verstehen. Solche Marathon-Veranstaltungen in der Provinz stoßen sich mehr als andere an den Realitäten. Die Szene wäre arm, wenn es sie nicht mehr gäbe, sondern nur noch unter Marketing-Gesichtspunkten organisierte.
Den Arolser Advents-Waldmarathon habe ich mir bei meinem heutigen Trainingslauf im Sinne des Wortes zu Gemüte geführt. Doch dann wurde ich abgelenkt. Ein Schwarm von Kindern, begleitet von Erwachsenen, die noch Zeit für sie hatten, bevölkerte die Laufstrecke; die Kinder trugen, aus welchem Anlaß auch immer, es war der Vorabend des Nikolaustages, Laternen. Ob nun St. Martin oder Nikolaus – Hauptsache, sie bewegen sich draußen. Da dürfen sie mir sogar die Laufstrecke versperren.
Die Gefahr bei einem Tagebuch liegt darin, daß man im Unterbewußtsein die Vorstellung hat, es sei ja kein Artikel, und schon vergißt man zu recherchieren. Ich recherchiere zwar immer wieder, was der Spontaneität nicht immer gut tut, habe es aber nicht bei der letzten Eintragung getan. Markus hat mir von der Begegnung mit Kathrine Switzer erzählt und dabei erwähnt, ihre Pioniertat als erste offiziell gemeldete Frau beim Boston-Marathon liege nun „über dreißig Jahre“ zurück. Er war der Meinung, das Ereignis habe 1976 stattgefunden. Ich wußte es zwar besser, nämlich 1966, aber ich habe die Angabe aus unserem Gespräch einfach übernommen. „Vor über dreißig Jahren“ ist zwar nicht gelogen, aber gemeint war: vor über vierzig Jahren, auch wenn ich dadurch Kathrine um zehn Jahre älter mache.
|
Noch eine Berichtigung Kathrine Switzers Buch „26,2 Marathon Stories“, von dem zum Toronto-Marathon eine Sonderausgabe erschienen ist – der Band ist im vorigen Jahr auf den Markt gekommen –, liegt schon eine Weile in deutscher Übersetzung vor. Allerdings, wenn man aufgegeben hat, jede Neuerscheinung auf dem Laufbuchmarkt zur Kenntnis zu nehmen, kommt man nicht drauf, daß die „26,2 Marathon Stories“ identisch sind mit : „Faszination Marathon“, wie der deutsche Titel lautet. Sicher ist der Titel des amerikanischen Originals bei uns nicht verwendbar, weil man mit der Zahl 26,2 nicht unbedingt die Marathonstrecke in Meilen assoziiert, aber manchmal habe ich den Eindruck, daß deutsche Lektoren und Verlagsmanager darin wetteifern, möglichst farblose Titel auf den Markt der Laufbücher zu bringen. Die „Faszination Marathon“ ist wahrscheinlich deshalb zustande gekommen, weil die „Herausforderung“ schon zweimal belegt gewesen ist, die Faszination im Zusammenhang mit dem Laufen jedoch erst einmal bei der „Faszination 100-km-Lauf“. |
 |
|
Von meinen Lesern hat mich niemand auf meine beiden Fehler aufmerksam gemacht. Sollte es pure Höflichkeit gewesen sein, so sei ihnen versichert, daß diese dort zu enden hat, wo der Autor irrt. Dagegen habe ich drei Hinweise zu meiner eher nebensächlichen Bemerkung über die Schwierigkeit, Gedankenstriche zu erzeugen, erhalten. Ich habe versprochen, mich mit den Hinweisen zu befassen; aber da müßte ich mich wohl zuerst einmal von dem Gedanken befreien, der Computer sei so etwas wie eine erweiterte Schreibmaschine. Völlig stimme ich der Bemerkung zu, auch früher schon, zu Zeiten des Bleisatzes, sei nicht immer zwischen Gedanken- und Bindestrich unterschieden worden.
Geirrt habe ich mich dagegen nicht, als ich mich im Juni mit dem Thema Doping im Radsport beschäftigt habe und zu einer entschiedenen Meinung gelangt bin. Ich habe in dem vier Wochen später erschienenen Beitrag im „Gesundheitsberater“ kritisiert, daß der Konzern Telekom an seinem Engagement im Radsport festgehalten hat. Die Überschrift lautete: „Wer Betrügern zuschaut, fördert den Betrug“. Nun endlich hat sich der Telekom-Konzern vom Radsport getrennt. Fünf Monate später sind die Manager wohl auch zu der Erkenntnis gekommen, daß das betrügerische Umfeld nicht gerade dem Ruf eines Supporters dienlich ist, zumal da ja auch sonst einiges nicht stimmt. Wenn man bedenkt, daß T-mobile munter am SMS-Betrug mit verdient, kommt man ins Grübeln. Was ist das für ein Konzern, der seine Kunden erst schröpft, nämlich durch zu hohe Gebühren, und es dann zweimal den Kunden überläßt, ob sie von dem inzwischen gesenkten Tarif Gebrauch machen oder nicht. Ein seriöser Dienstleister teilt eine Gebührenänderung, in diesem Fall eine Gebührensenkung, seinen Kunden mit und stellt die Verträge zugunsten seiner Kunden automatisch um. Die Telekom dagegen hat kassiert, solange man seinen alten Vertrag nicht gekündigt hat. Ich habe mich erst im Telekom-Laden informiert und dort den reduzierten Vertrag abgeschlossen. Niemand hat mir dort gesagt, daß ich einen Bonus von 20 Euro bekommen würde, wenn ich den Vertrag übers Internet schlösse. Jetzt gibt’s befristet wieder eine Gebührensenkung um angeblich 5 Euro, aber ich habe die Vertragsgestaltung nicht verstanden. Ich habe den Verdacht, man spekuliert auf Menschen wie mich, die ihre Zeit nicht über dem Kleingedruckten der Telekom verbringen möchten, und was ein „Rooter“ ist, den die Telekom anbietet, da habe ich meinen Sohn fragen müssen. Er sagte mir, ich hätte schon einen.
Ins schillernde Bild, in dem sich nach wie vor die Telekom präsentiert, passen die Vorgänge in Wolfsburg, im kapitalistischen VEB: bestochene Gewerkschafter – die IG Metall hat sich in Schweigen gehüllt –, gewissenlose Manager, ein vorbestrafter Arbeitsdirektor, dem zu Ehren die staatlichen Unterstützungsleistungen benannt sind, und der regierende Fürst weiß nicht, was auf seinem Auto-Territorium vorgeht. Widerlich.
Nur die Dimensionen unterscheiden uns noch von den durch Korruption bekannten Staaten. Doch wir werden aufholen. In Rußland zeigt der herrschende Geheimdienstmann immer mehr sein wahres Gesicht. Was ist eigentlich von einem Politiker zu halten, der Deutschland regiert hat, und dabei Putin als „lupenreinen Demokraten“ erkannt haben will? Entweder hat er gelogen oder er ist unfähig gewesen, Charaktere zu durchschauen. Welche Irrtümer werden Politikern noch unterlaufen?
Markus hat in Toronto Gelegenheit gehabt, mit Kathrine Switzer zu sprechen. Über dreißig Jahre ist es nun her, daß Kathrine als erste Frau offiziell bei einem Marathon gestartet ist, und noch immer wird hierzulande verbreitet, sie habe die Funktionäre des Boston-Marathons überlistet, zum einen, weil sie sich als „K. Switzer“, also geschlechtsneutral, angemeldet habe und zum anderen, daß sie „vermummt“ gestartet sei, um ihre Geschlechtszugehörigkeit zu verbergen. Doch Kathrine Switzer berichtet, alle hätten sich damals so angemeldet, nämlich nur mit einem Buchstaben für den Vornamen. Und natürlich stimmt es nicht, daß sie vermummt gewesen sei. Es war ziemlich kühl an jenem Apriltag in Boston, und alle trugen sie wärmere Sportkleidung. Der Bildsequenz, als Jock Semple sie aus dem Rennen nehmen wollte, ist ja auch zu entnehmen, daß sie einen Trainingsanzug trug – so liefen wir im Training auch später noch –, die Haare jedoch offen trug. Für jedermann war zu erkennen, daß hier eine Frau lief. Anders hätten ja auch die Journalisten nicht den Renndirektor darauf aufmerksam machen können, daß da ein Mädchen lief. Dagegen stimmt, daß Kathrines Freund und späterer Ehemann Jock Semple zu Boden warf.
Kathrine Switzer hat mit ihrem zweiten Mann, Roger Robinson, ein opulent ausgestattetes Buch exklusiv für den Toronto-Marathon geschrieben, „26,2 Marathon Stories“. Markus hat es mir gestern geschenkt und es obendrein noch von Kathrine Switzer ganz persönlich signieren lassen. Ein wertvolleres Geschenk hätte er mir nicht machen können. Ich habe am späten Abend noch zu lesen begonnen. Sicher komme ich noch einmal darauf zurück. Kathrine bereitet ihre Autobiographie vor, das wäre dann das Gegenstück zu Jock Semples „Just call me Jock“ (auch das ist signiert, ich habe ihn selbst noch sprechen können).
Eben sind mir die Unterlagen zum München-Marathon am 14. Oktober in die Hände gefallen, nicht nur die Urkunde, sondern auch der Beleg fürs Startgeld. Es ist wahr, ich habe als Nachmelder am Veranstaltungsort bezahlt. Vor dem Berlin-Marathon, der Nagelprobe auf den Trainingsstand des Rehabilitanden, konnte ich nicht wagen, mich schon für irgendeinen Marathon danach anzumelden. Auch nach Rückkehr vom Berlin-Marathon mußte ich erst einmal abwarten, wie er mir bekommen würde. Es blieb nichts anderes übrig, als am Vortag nachzumelden. Das machte 68 Euro, und da sich ja die Einkünfte rechnerisch halbiert haben, muß man zum Vergleich mit früher die Ausgaben verdoppeln: Das Startgeld betrug demnach 133 Deutsche Mark. Fürwahr, man muß es sich leisten können, Marathon zu laufen. 42 Kilometer im eigenen Auto sind billiger. Vielleicht braucht man gar nicht so viel zu spekulieren, weshalb die Teilnehmerzahl bei vielen Marathons zurückgegangen ist. Könnte es nicht sein, daß das Budget für Marathonausgaben geschmolzen ist?
Als Nachmelder habe ich in München einen richtigen Kassenbon wie im Kaufhaus bekommen; da steht auch schlicht hinter einer Nummer „Verkäufer“. Was mich überrascht und empört hat, ist, daß der Betrag 19 Prozent Mehrwertsteuer ausweist, nämlich 10,86 Euro. Der Veranstalter, die Runabout GmbH, hat also von mir real nur 57,14 Euro Startgebühr erhalten. Das restliche Fünftel, die Verdopplung des biblischen „Zehnten“, schluckt die Staatskasse. Verbal steht mir der Schaum vor dem Mund. Auf Startgebühren von Volkssportveranstaltungen Mehrwertsteuer zu erheben, ist ein Skandal. Politiker und Beamte dieses Staates – ich denke, er fällt damit eindeutig unter die „Schurkenstaaten“ – schämen sich nicht, von denjenigen, die durch ihr Marathon-Training den neben der Ernährung wichtigsten Beitrag zur Senkung der Krankheitskosten leisten, 19 Prozent Steuer aufs Startgeld zu erheben. Nicht einmal eine Ermäßigung auf 7 Prozent wie bei Büchern und Lebensmitteln stand zur Debatte. Mein Vorschlag – Achtung: Satire – wäre: Nach der Logik des Bundesfinanzministeriums könnten sich doch die Kommunen gleich dran hängen und von uns Vergnügungssteuer erheben. Wir wünschen uns ja doch immer gegenseitig „Viel Spaß!“
Nach den Nullrunden nun die Erhöhung der Bundestagsabgeordneten-Bezüge – innerhalb von vierzehn Tagen durchgewunken. Uns Rentnern mit ebensolchen Nullrunden macht man seit Monaten schon das Maul damit wäßrig, daß es im nächsten Juli eine Rentenerhöhung geben soll. Da werde ich dann wohl 15 Euro im Monat mehr bekommen; bis dahin werden die Verteuerung der Lebenshaltungskosten und auch altersspezifische Ausgaben – fürs Schneeschippen müssen wir uns einen Helfer leisten – ein Mehrfaches der Rentenerhöhung betragen. Unsere Enteignung schreitet weiter fort. Ich denke, die Politiker werden dem Wahljahr 2009 im Hinblick auf die Stimmen der Rentner mit gemischten Gefühlen entgegensehen.
So deutlich ich mich auch auszudrücken versuche, – meine letzte Eintragung muß zumindest auf den ersten Blick schwer verständlich wirken. Da fehlt offenbar etwas, denkt der Leser. Ja, es fehlt etwas, nämlich die Gedankenstriche. Nicht daß ich sie nicht gesetzt hätte, die boshafte Meinung mißachtend, daß Gedankenstriche dort gesetzt werden, wo Gedanken fehlen. Ich habe es besonders gut gemeint und seit einer Weile echte Gedankenstriche gesetzt. Wir unterscheiden nämlich in der Schwarzen Kunst Bindestriche und Gedankenstriche. Die Gedankenstriche sind etwas länger. Jede gepflegte Druckerei wird ihre Bücher mit Gedankenstrichen drucken. Jedoch, die Tastaturen unserer Computer haben keine Gedankenstriche, sondern nur Bindestriche und Striche zum Unterstreichen. Gedankenstriche sind Sonderzeichen, man muß sie durch den Klick auf „Einfügen“ einfügen, nämlich erst einmal die Sonderzeichen aufrufen, daraus den Gedankenstrich anklicken, auf Einfügen klicken, den Kasten schließen und die Leertaste tippen. Computer sind so. Gedankenstriche machen also Mühe. Die habe ich jahrelang im LaufReport gescheut, mich jedoch vor einigen Wochen eines anderen besonnen. Es sollten Gedankenstriche und nicht Bindestriche sein. Das Ergebnis: Offenbar konnten sie bei der digitalen Übermittlung vom Empfänger nicht in das Konvertierungsprogramm einbezogen werden. Also kehre ich nun zu den Bindestrichen zurück. Sensibel dafür geworden, gewahre ich auch in anderen Veröffentlichungen, daß der Gedankenstrich vom Bindestrich abgelöst worden ist. In den Rechtschreibkommissionen hat das wohl keinen bekümmert. Es war wichtiger, den Stengel zum Stängel zu machen. Da haut’s einen von demselben.
Ehe das Jahr zuende geht, sollte ich, wenn es sonst schon kaum jemand tut, ein Jubiläum würdigen: Vor 25 Jahren ist die AIMS gegründet worden. Sicher für manche eine unverständliche Abkürzung. Und sie stimmt nicht einmal mehr. Gegründet wurde die AIMS als Association of International Marathons. Inzwischen ist der Zusammenschluß von Marathon-Veranstaltern erweitert worden auf: ...and Distance Races. Also auch ein Halbmarathon wie der in Stuttgart zählt zu den Mitgliedern. Das Gründungsjahr 1982 fiel in die Zeit, als sich die Marathon-Veranstaltungen explosionsartig auszubreiten begannen. In der Bundesrepublik hatten im Jahr zuvor in Frankfurt am Main und Westberlin die ersten Stadtmarathons stattgefunden. Die größten Stadtmarathons zählten damals 15000 Teilnehmer. Auf einem Kongreß im Mai 1982 in London schlossen sich 28 Marathon-Veranstalter zusammen. Vorangegangen waren Treffen von Renndirektoren in Honolulu (1980) und New York (1981), die ihren Kreis International Marathon Race Directors (IMRD) nannten. Dabei schlug der Renndirektor des Montreal-Marathons vor, einen World Circuit of Marathons zu etablieren, bei dem Spitzenläufer in einem Zeitabschnitt von zwei Jahren auf je drei Marathons wetteifern sollten.
In der AIMS setzten sich die Mitglieder insbesondere unter der Federführung der Renndirektoren von London, New York und Boston zum Ziel, international ein bestimmtes Niveau ihrer Veranstaltungen zu gewährleisten. Vor allem sollten die Streckenlängen stimmen. 1973 war in den USA der Jones-Counter entwickelt worden, ein Meßrad, das in jedes Fahrrad montiert werden konnte. Auch über die Methode mußte man sich einig werden, nämlich realistischerweise Messen in der Ideallinie und in gewissem Abstand zur Bordkante. Auf den Jones-Counter drang in der Bundesrepublik insbesondere Harry Arndt, nachdem 1985 die Deutsche Ultramarathon-Vereinigung gegründet worden war. Gerade die Ultrastrecken differierten immer wieder zu den Streckenangaben. Dillingen war für seine zu kurze 100-Kilometer-Strecke berüchtigt.
So wie zunächst die Länge der Marathonstrecke vereinheitlicht worden ist, nämlich die Maße der Olympischen Spiele 1908 in London im Jahr 1921 zur Norm erklärt wurden, sollten in den achtziger Jahren die exakten Streckenlängen bei den international besetzten Marathons garantiert werden. Das Wettkampfprinzip, die Vergleichbarkeit der Leistungen, sollte auch auf den Marathon angewandt werden. Vermutlich spielte auch die Kommerzialisierung hinein. Es durfte nicht sein, daß Berufsläufer vornehmlich dort starten würden, wo sie eventuell infolge zu geringer Streckenlänge einen Zeit-Bonus erwerben konnten. Eine international anerkannte Zertifizierung sollte gleiche Bedingungen schaffen; diese Notwendigkeit stand Pate bei der Gründung der AIMS. Es ist ja immer so: Wenn ein Bedürfnis erkannt ist, bildet sich für gewöhnlich eine neue Organisationsstruktur. Sind die Bedürfnisse erfüllt und treten dann keine neuen Aufgaben an deren Stelle, verkümmert eine Organisation zu einem Traditionsverein oder geht wegen zu diffuser Zielsetzung gar unter wie der deutsche Road Runners Club. Der AIMS dürften auf lange Sicht die Aufgaben nicht ausgehen. Schon quantitativ nicht, denn die Zahl der AIMS-Mitglieder ist ständig gewachsen – auf nun 235 Laufveranstalter in 85 Ländern. Andere Strecken-Distanzen wurden hinzugenommen. Man kann dies in einer informativen Broschüre nachlesen, die zum 25-Jahr-Jubiläum erschienen ist und von der Website der AIMS heruntergeladen werden kann. An ihr hat auch Jörg Wenig in Berlin mitgewirkt.
Zum Erfahrungsaustausch der Renndirektoren kam die Kommunikation auch mit den Läufern hinzu. Im Grunde wurde damit nationalen Verbänden wie dem Deutschen Leichtathletik-Verband ein Armutszeugnis ausgestellt. Von so mancher internationalen Veranstaltung konnte man das dort verteilte Jahrbuch, später die mehrmals im Jahr erscheinende Publikation „Distance Running“ mitnehmen. Allein die Anzeigen darin waren eine Informationsquelle, wie denn die AIMS auch ein Ansprechpartner von Reiseveranstaltern geworden ist.
|
Manchem mochte an der Oberfläche die AIMS zunächst als exklusiver Club erschienen sein. Der erste Präsident war Will Cloney, der langjährige Renndirektor des Traditionsmarathons in Boston, Vizepräsident war Chris Brasher, der Organisator des London-Marathons. Generalsekretär war Andy Galloway. Es ist nicht ohne Reiz, daß Will Cloney, der 1966 die erste offiziell gemeldete Frau im Boston-Marathon von der Strecke verbannen wollte (durch Jock Semple), just mit dieser, nämlich mit Kathrine Switzer, in der AIMS zusammenarbeitete. So etwas bestärkt den Glauben an die Vernunft. Fred Lebow und Allan Steinfeld vom New York Marathon gehörten, versteht sich, zu den Gründern. Aber auch Horst Milde, Renndirektor des jungen Berlin-Marathons, und Wolfram Bleul, Initiator des Marathons von Frankfurt-Hoechst, nahmen an dem Gründungskongreß teil. Unter den Ideen, die in die AIMS eingebracht wurden – zum Beispiel die Verwendung des Transponders zur Messung der realen Zeit – , war auch eine von Horst Milde, nämlich die Anbindung des Berliner Sportmuseums an die AIMS. Sicherlich hat dies die Bedeutung des – räumlich vagabundierenden – Sportmuseums, des ersten deutschen Sportmuseums, gesteigert und dessen Ausstattung durch den Berliner Senat zumindest erleichtert. Der letzte Umzug innerhalb des Olympiageländes wird hoffentlich die Plattform verbreitert haben. Der nächste Schritt – darüber sind sich die Mitarbeiter des Sportmuseums seit langem einig – müßte sein, einen Teil der Bestände in einer Dauerausstellung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Entwicklung des Laufsports erfordert eine Dokumentation. |
 |
|
Das AIMS-Museum bietet die Basis dafür. Meine Idee, in Bad Arolsen, das sich als Ausdauersportzentrum profilieren wollte, ein Laufmuseum einzurichten, war reichlich blauäugig. So etwas ist nebenbei nicht zu schultern. Ein Laufmuseum sollte zudem nicht nur sammeln und horten, sondern auch wissenschaftlich publizieren. Auch das müßte zum Profil eines AIMS-Museums gehören.
Keine weiteren Details. Die Association of International Marathons and Distance Races hat ein volles Auftragsbuch. Auch daran zeigt sich, was dem Deutschen Leichtathletik-Verband entgangen ist, als er zwar vom Deutschen Sportbund die Lauftreffs übernommen hat, aber die Entwicklung des Laufsports außerhalb des DLV-Horizonts sträflich vernachlässigt hat. Die AIMS ist für den „normalen“ Marathonläufer von weit größerer Bedeutung als der DLV. Mich zum Beispiel interessiert, wer in New York in M 80 läuft, die M 80 der Verbands-Weltmeisterschaft kann ich getrost vergessen.
Auch die AIMS ist kein Naturschutzgebiet. Von ihr haben sich vor zwei Jahren die „big five“ New York, Boston, Chicago, London, Berlin zu einem eigenen Zusammenschluß der World Marathon Majors gelöst. Ist es tragikomisch, daß der Konflikt in Berlin familiär ausgetragen wird? Horst Milde, Gründer des Berlin-Marathons, ist nach wie vor der AIMS verbunden. Sein Sohn Mark Milde, der jetzige Renndirektor, gehört schon kraft Amtes zu den elitären „big five“. Andererseits ist es auch tröstlich, daß wenigstens auf diese Weise Gräben vermieden werden. Auch die AIMS und die IAAF reden miteinander. Die World Marathon Majors haben inzwischen ihre erste Wettbewerbsserie für Spitzenläufer abgeschlossen; ihre ersten Champions sind die Äthiopierin Gete Wami, Siegerin beim Berlin-Marathon und Zweite des New York-Marathons, und der Kenianer Robert Cheruiyot, zweimaliger Sieger von Boston und Sieger in Chicago.
Dies ist ein Tagebuch, und ich wollte im Grunde keinen Artikel schreiben, sondern eine Eintragung machen. Doch ums große Ganze kommt man nicht herum. Was hat mich außer dem hier naheliegenden Jubiläum der AIMS bewegt? Etwas, das es nicht verdient hätte. Da ich Kabarett liebe, habe ich im Fernsehprogramm gelegentlich Harald Schmidt eingeschaltet, es dann aber aufgegeben. Was ich jetzt aus seinem Auftritt mit dem neuen Kompagnon Oliver Pocher erfahren habe, da sträuben sich mir die Haare. Ich habe keinen Zweifel gelassen, daß mich political correctness anwidert und daß ich Kurt Tucholsky zustimme, Satire darf alles. Doch was eine öffentlich-rechtliche Anstalt verbreitet hat, war keine Satire, sondern – da ist dem Intendanten Peter Boudgoust absolut recht zu geben – geschmacklos. Eine Satire hätte es werden können, nämlich sich lustig darüber zu machen, daß sprachliche Sentenzen in Acht und Bann getan werden, weil sie von den Nazis benützt worden sind, andererseits aber Ausdrücke des Nazi-Jargons unbekümmert gebraucht werden. Das klassische Beispiel in der Laufszene und nicht nur in dieser ist der innere Schweinehund. Was aber hat das Gespann Schmidt/Pocher getan? Es hat, übrigens entgegen der Medien-Berichterstattung, keine Nazi-Ausdrücke glossiert, sondern bei neutralen Vokabeln Anspielungen auf NS-Verbrechen gemacht und diese damit verharmlost. Ich habe es nur gelesen: Pocher habe einen Nazometer – bis dahin gut –, dieser habe heftig ausgeschlagen, als er die Worte „Gasherd“ und „Dusche“ gebraucht habe. Nichts davon ist witzig. Millionen Menschen sind in den Tod gegangen, wenn aus den Duschen in Auschwitz und zuvor anderswo „probeweise“ tödliches Zyklon-Gas der Firma IG Farben zischte. Bei den Worten „Gas“ und „Dusche“ hat der angebliche Comedian einen Zusammenhang mit den Nazi-Mördern hergestellt und mit Entsetzen Scherz getrieben. Ich vermute, diese Geschmacklosigkeit entspringt der unhistorischen Denkweise der jungen Generation – und ihrer Lehrer.
Ein Marathon im Herbst sollte es schon noch sein. Frankfurt am Main war nach Berlin und München zu früh. Zum Arolser Adventsmarathon würde ich gern gehen, aber der Zielschluß reicht für mich nicht mehr. Auch nach fünfeinhalb Stunden Einlaufende – im vorigen Jahr ein gutes Dutzend – werden zwar gewertet, aber ich möchte mich nicht auf Gnade und Barmherzigkeit verlassen. Siebengebirgsmarathon – die Strecke auf einem relativ kleinen Gebiet reizt mich nicht mehr sonderlich; außerdem kann es hier wie bei anderen Dezember-Läufen passieren, daß unsereiner eingemummt laufen muß, und das macht es noch schwerer. Bei Durchsicht der Angebote bin ich auf den seit zehn Jahren bestehenden Rursee-Marathon gestoßen. Ich sollte doch, meine ich, jede Gelegenheit nützen, in der verbleibenden Zeit möglichst neue Strecken kennenzulernen. Also bin ich in die Eifel gefahren. Mir ist erst jetzt klar geworden, wie ausgedehnt die Eifel ist. Da war ich vordem in der Vulkaneifel, am Nürburgring und in Monschau gewesen, und alles gehört wie der Rursee zur Eifel.
In der Jugend war mir die Eifel nur durch den gleichnamigen Ford bekannt; der Ford Eifel war das vor dem zweiten Weltkrieg meistverkaufte deutsche Auto. Damals hatten die Autos noch richtige Namen; Vorgänger war der Ford Köln, Nachfolger der Ford Taunus. Der erste Achtzylinder von Mercedes hieß Nürburg. Auf meiner 20 Jahre alten deutschen Generalkarte, die inzwischen schon historischen Wert hat, ist das ganze Gebiet am Urft-Stausee nördlich und südlich der Bundesstraße 266 als Truppenübungsplatz eingezeichnet. Das ist allemal ein Zeichen, daß es sich um eine arme Gegend handelt. Inzwischen trägt die Region das Etikett Nationalpark Eifel und wird touristisch professionell vermarktet.
Seeumrundungen haben für Läufer einen eigenartigen Aufforderungscharakter. Ob am Wolfgangsee oder am Achensee, ob am Twistesee oder am Edersee, ob am Greifensee oder am Zürichsee, ob an mecklenburgischen Seen oder am Forggensee, am Neusiedlersee (in zwei Tagen) und wasweißich, vielenorts finden Läufe rund um einen See statt. Und wo nicht, nimmt man das Fahrrad; um den Balaton – auch er ist schon umlaufen worden – ist in den letzten Jahren ein 200 Kilometer langer Radweg angelegt worden, den Bodensee umrunden Zehntausende mit dem Fahrrad, und ich habe mir einmal einen eigenen Ultralauf um den Bodensee gebastelt. Ein Stausee wie der Rursee, der eben nicht bloß ein Becken in der Landschaft ist, sondern eine Vielzahl von Buchten hat, ist geradezu prädestiniert für einen Landschaftsmarathon.
In Einruhr, das sich wie das nahe Erkensruhr, wo ich genächtigt habe, mit h schreibt – bis hierhin ist keine Rechtschreibreform gedrungen –, sind wir aufgebrochen. Ich wußte, es würde wieder ein einsamer Lauf werden. Tröstlich war, daß ich nicht der einzige am Schluß war. So sehr wir uns auch auf der Strecke vereinzelten, am Ziel trafen wir innerhalb weniger Minuten ein, etwas unter oder etwas über 6 Stunden.
Ein Lauf oder Marsch – insbesondere an den neun längeren Steigungen, die mühsamste bei Kilometer 37 – durch herbstlich bunten Laubwald. Zu Unrecht gilt der November als der tristeste Monat im Jahr. Die „grauen Novembertage“ kann es in jedem Monat geben, nur nimmt sie unser Lebensgefühl nicht wahr. Auch im November scheint die Sonne. Wir haben am Sonntag meistens einen bedeckten Himmel gehabt, aber es war kein grauer Tag. Zuweilen illuminierten Sonnenstrahlen das Laub. Man kann auch im November Urlaub machen, ohne in warme Länder zu fliegen. Die Wanderer, denen ich begegnet bin, waren sicher nicht nur Sonntagsausflügler aus Köln und Aachen; der Zahl der Autos nach war mein Hotel gut belegt. Auch Niederländer hatte es in die nächsten Berge gedrängt.
Gewiß hätte ich hier eine Wanderung machen können, statt an einem Marathon teilzunehmen. Doch die Wanderung hätte ich nach der Halbmarathondistanz beendet und wäre eingekehrt. Der Marathon fordert mich; im ersten Teil, weil ich den Anschluß nicht verlieren will, im zweiten Teil, weil ich ankommen will. Der See erleichtert die Orientierung und wohl auch die Festlegung der Strecke. Bei Kilometer 6,5 gab es eine Unsicherheit: Geradeaus den Berg empor oder den steilen Weg nach links? Ich entschloß mich, den Bike-Fahrern zu folgen, die ihre Räder hinauftrugen. Außerdem hatten mich die 16,5-km-Läufer überholt, und ich sah einen nach links hinauf hasten. Wenig später konnte ich mich beim Posten nach der Staumauer vergewissern. Die Trennung der beiden Läuferströme folgte erst ein paar Kilometer später. Ich finde die Strecke sonst gut markiert. An einer Stelle, an der mir ein Posten zurief „Geradeaus!“, sah ich nur rechts und links einen Weg; doch man muß tatsächlich, für einen Marathon eher skurril, über eine niedrige Abschrankung steigen. Im Nordwesten dann Wohngebiete, doch der Asphalt war nach all den Naturwegen willkommen.
Am Ziel dann wieder das Gefühl: Es war ein erfüllter Tag. Andere gehen mit dem Hund spazieren, wobei sicher der Hund das Gefühl der Zufriedenheit hat; warum soll man nicht, auch wenn der Anblick nicht besonders sportlich sein mag, statt dessen an einem Marathon teilnehmen? Alles ist relativ – auch die sechs Stunden.
Die Schwäbische Alb im Herbst – für einen Marathon dort könnte man keinen passenderen Termin finden. Am Samstag war der Himmel zwar den ganzen Tag bedeckt – der optimale Tag wäre heute gewesen –, aber es war wenigstens trocken. So gern fahre ich nicht in Orte, in denen ich gelaufen bin und nun zusehen muß; aber ich hatte mich verabredet, und außerdem wollte ich den erstmaligen Start mit Zieleinlauf auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd erleben.
Als ich durch die Bocksgasse zum Marktplatz schlenderte, versuchte ich, das Stadtbild ganz unbeteiligt zu betrachten. Es ist immerhin die Stadt, in die ich als Redakteur kam, in der ich geheiratet habe und in der unser Sohn geboren wurde. Ganz objektiv finde ich heute, daß es eine schöne, geradezu lauschige Stadt ist. Über fünfzig Jahre ist es her, daß ich drei Jahre hier lebte. Damals bretterte ich mit der Vespa durch die Bocksgasse zum Marktplatz – viel zu schnell. Heute ist das alles Fußgängerzone, die Stadt hat sich herausgeputzt. Damals fühlte ich mich beengt. Die Stadt war vom Katholizismus geprägt, und den Redakteur sah man niemals in der Kirche. Harmlos hatte ich in einer Drogerie Präservative verlangt, ich wurde pikiert angesehen, nein, solche Artikel führe man nicht. Ob sich das geändert hat?
 |
Die Marathon-Installation mit dem aufgeblasenen Tor stand in schrillem Gegensatz zu den Giebelhäusern am Marktplatz. An der romanischen Johanneskirche reihten sich die Klohäuschen aneinander. Ich denke, im Mittelalter war man in dieser Hinsicht auch nicht pingelig, da hat man Verkaufsbuden an die Kirchenmauern gebaut. Tatsächlich gab es nun am Marktplatz eine richtige Zuschauerkulisse. Zum 50-Kilometer-Lauf starteten immerhin 58 mehr als im vorigen Jahr; in der Zeit abnehmender Teilnehmerzahlen bei Provinzmarathons ist das schon etwas. |
3:13:03 durch Jürgen Wieser auf 50 Kilometern und über die Dreikaiserberge, das ist auch ein Wort; Dorothea Grupp schaffte es in 3:57:48 Stunden. Doch ich ertappe mich immer wieder, daß ich alsbald Ergebnislisten von hinten lese. Ich will wissen, wie lange die letzten gebraucht haben. Könnte ich das vielleicht auch noch? Reicht die Zeit, die drei Gipfel zu erwandern? Habe ich mich nicht vielleicht doch zu früh vom Schwäbische-Alb-Marathon verabschiedet? Wilfried Flöter, nun in M 75, überschritt die Sollzeit von siebeneinhalb Stunden nur unwesentlich, und der letzte wurde mit 7:49:39 Stunden auch noch gewertet. Mal sehen, wie es im nächsten Herbst aussieht.
Doch da ist auch der Frankfurt-Marathon. An der Spitze 9 Kenianer und ein Russe; immerhin hat Melanie Kraus die Frauenwertung gewonnen. Und Dieter Baumann ist den Makel von Hamburg losgeworden – eine Zeit von 2:30, so sehr ins Zeug hätte er sich nun auch nicht gleich legen müssen. Was sehe ich? Yau Chien Wong aus Hongkong spazierte nach 6:23:54 Stunden ins Ziel. 13 haben in Frankfurt mehr als 6 Stunden gebraucht. Das muß ich mir merken, da hätte ich noch ein schönes Polster, und ich wäre wie in Berlin wahrhaftig nicht allein. Fast bedauere ich, am Wochenende weder in Schwäbisch Gmünd noch in Frankfurt am Main gelaufen zu sein. Doch drei Marathonläufe innerhalb von vier Wochen, das erschien mir in meiner Situation denn doch zu gewagt. Im Abstand von drei Wochen ein Landschaftsmarathon mit Gehstrecken – da schaut es schon wieder anders aus.
 |
Heute habe ich die Digitalkamera zur Reparatur schicken müssen. Auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd ist sie mir, als ich sie nur an der Schlaufe trug, vom Handgelenk gerutscht und aufs Pflaster geknallt. Dabei wollte ich noch Bilder aus dem „Prediger“ machen. Das barocke Gebäude war in den fünfziger Jahren ziemlich heruntergekommen. Seit einigen Jahren ist es restauriert und zum Kulturzentrum erklärt worden. Darin fand erstmals die Läufermesse statt. Zumal während die Läufer auf der Strecke waren, wirkten die wenigen Stände ziemlich verloren. |
Oben waren Bänke und Tische aufgeschlagen, so daß man sich hier gleich nach dem Lauf aufhalten konnte. Umkleide- und Duschmöglichkeit sind am alten Startgelände geblieben; doch die 900 Meter sind kein Problem. Der Schwäbische-Alb-Marathon ist durch die jetzige Lösung nun wirklich in den Blickpunkt gerückt.
Ein Tagebuch kennt keine Überleitungen. Man kann bedenkenlos vom Zeitungspapier, mit dem man feuchte Laufschuhe ausstopft, zum Inhalt der Zeitung kommen. Was sich bei der Deutschen Bahn abspielt, läßt nur den einen Schluß zu: Die Bahn zu unterhalten, gehört ebenso zu den hoheitlichen Aufgaben des Staates wie die Aufsicht über die Fluglotsen. Das anfängliche Verständnis für die in der GdL organisierten Lokomotivführer hat sich längst verflüchtigt. Millionen von Pendlern sind auf unbestimmte Zeit als Geiseln genommen. Was immer Gewerkschaften herausholen, hier könnte man sagen: herauspressen wollen, – irgendwer muß immer die Zeche zahlen. Wie hatten wir uns in den siebziger Jahren in der Redaktion gefreut, daß wir wieder einmal mehr Urlaub bekamen. Die Folge: Da die Urlaubsperiode nun insgesamt länger war, kamen wir öfter als vordem mit dem Sonntagsdienst dran. Wenn die Gewerkschaft der Lokomotivführer unter Aufkündigung der Solidarität mit anderen Gewerkschaften ihre partikulären Interessen durchboxen könnte, würde nicht Herr Mehdorn die Zeche zahlen, sondern die Bahnbenützer und, da die Kunden zum Auto zurückkehren würden, die Gesellschaft. Nebenbei: Was ist von einer Gewerkschaft zu halten, deren Kapitän bei hohem Seegang die Brücke verläßt, um zur Kur zu reisen? Bei einer völligen Privatisierung der Bahn sehe ich nicht nur weitere Tarifauseinandersetzungen dieses Formats, sondern auch die Gefahr unterlassener Investition und mangelnder Kundenfreundlichkeit. Üble Augenauswischerei: Statt daß der Staat seine Eisenbahn finanziert, die seine Vorgänger Anfang der zwanziger Jahre gegen Widerstand erst unter sein Dach geholt haben, sollen Anleger das Geld aufbringen. Volksaktie – daß ich nicht lache! Schon einmal hat, in der Gründerzeit, eine Generation ihr Geld in Eisenbahnaktien verloren. Aktien zu kaufen, ist immer Spekulation. Wie sollte ein Unternehmen, das verpflichtet ist, schon der Sicherheit wegen zu investieren und aus betriebsfremden Gründen zuweilen auch unwirtschaftlich zu arbeiten, solche Gewinne erzielen, daß Bahn-Aktien eine ernstzunehmende Anlage, etwa fürs Alter, wären! Selbst wenn eine bescheidene Dividende winkte, was mir fraglich erscheint – von Gewinnen durch Aktienverkauf wird man nach der „Volksaktie“ Telekom nicht mehr reden können –, sorgt der Staat durch die Abgeltungssteuer dafür, daß Aktien für Kleinanleger unattraktiv werden. Hier wird wieder einmal gesellschaftspolitische Flickschusterei in größtem Ausmaß betrieben.
Der Läufer, der im Hotelrestaurant mit mir auf alles wartete, die Bedienung, das Essen und das Zahlen, fragte mich, ob ich den München-Marathon schon einmal gelaufen sei. Ja, sagte ich und erzählte von Alfred Pohlan, dem Münchner Architekten, der 1977 den Oktoberfest-Marathon ins Leben gerufen hatte. Von einem Oktoberfest-Marathon hatte mein Gesprächspartner noch nie gehört, geschweige denn von Pohlan, dem „Tarzan“ im Tigerhöschen. Und dabei waren Pohlan und Rolf Brokmeyer jahrelang die beiden Deutschen mit den meisten Marathons. So rasch welkt der Lorbeer. Erst nach unserer Unterhaltung, als ich wieder zu Hause war, schlug ich nach: Ich bin tatsächlich schon zum neuntenmal in München Marathon gelaufen.
 |
1977 war das Olympia-Stadion zwar auch schon Ziel, aber in das Allerheiligste, das Stadion-Oval, wurden wir Läufer nicht gelassen. Die Zeiten haben sich geändert. 1983 fand der 1. Münchner City-Marathon statt, relativ früh also. Der Termin war in den April gelegt worden, und ich erinnere mich, daß, als ich ihn 1985 lief, Alfred Pohlan wie immer sein Tigerhöschen trug und außer den Laufschuhen sonst nichts. Damit verstieß er, wie später so viele Läufer auf Hitzeläufen, gegen die Leichtathletik-Ordnung des DLV. |
| Medaillen des München-Marathons im Wandel |
Tarzan im Tigerhöschen – mich fröstelt, wenn ich daran denke, denn als wir uns damals dem Olympiagelände näherten, fielen Schneeflocken. Am letzten Sonntag hätte er, würde er sich nicht heute am weißblauen bayerischen Himmel wahrscheinlich von Wolke zu Wolke schwingen, abermals seine Abhärtung beweisen können, denn es war am Morgen überaus frisch.
Ich war zu Fuß die zehn Minuten vom Hotel zum Start gegangen. Glücklicherweise hatte ich mich vom „goldenen Oktober“ nicht verleiten lassen, das zurechtgelegte kurzärmelige Laufhemd anzuziehen, sondern eines meiner wenigen langärmeligen und eine Spur dichter gewebten. Ich trug darüber meine allererste, über vierzig Jahre alte Trainingsjacke und wickelte mich in die Wärmefolie vom Berlin-Marathon ein. Dennoch fror ich beträchtlich. Da ich zum Wärmen nicht weitere zehn Minuten bis zur Event-Arena, der früheren olympischen Radsporthalle, und zurück zum Start gehen mochte, suchte ich anderweitig Kälteschutz. In einem Wohnblock fand ich ihn – im Müllbehälter-Raum, der war offen. Meine Sorge war nur, daß jemand von außen die Tür zuschließen könnte – wahrscheinlich hätten mich in diesem Falle später Hundertschaften von Polizei gesucht, nur nicht hier ; deshalb hielt ich mich an der Tür auf.
Nachdem die ebenfalls kniefreien, aber in wärmendes Leder gewandeten Gebirgsschützen auch für uns den Startschuß abgefeuert hatten – man ist ja dankbar für ein bißchen Folklore, das einen Marathon unverwechselbar machen könnte –, warf ich zunächst die Folie ab. Doch konnte ich mich nicht entschließen, mich auch der Trainingsjacke, wahrscheinlich eines Baumwoll-Nylon-Gewebes und damit eines Sportmuseums würdig, zu entledigen, also steckte ich rasch die Startnummer um. An den Lumpen und Folien am Straßenrand mehrere Kilometer nach dem Start erkannte ich, daß auch viele andere so gedacht hatten. Hunderte von Läufern sind also mit unkenntlicher Startnummer gestartet – ebenfalls ein Verstoß gegen die Bestimmungen! Ich schließe weiter aus der späten Enthüllung, daß Tausende völlig unaufgewärmt auf die Strecke gegangen sind – entgegen dem Rat aus schlauen Büchern und von Trainern, die aus schlauen Büchern gelernt haben. Ebenso wurde in diesem Rennen konterkariert, daß man als Hochleistungssportler nicht zwei Marathons in kurzem Abstand laufen könne. Falk Cierpinski war in Berlin der schnellste deutsche Läufer, und er gewann vierzehn Tage später den München-Marathon. Als ich einmal in einer Podiumsdiskussion die Frage, wie oft im Jahr man Marathon laufen könne, lapidar und nach meiner Meinung ganz vorsichtig beantwortete: „Alle vier Wochen“, erntete ich empörtes Kopfschütteln einer ärztlichen Spezialistin für Trainingssteuerung. Mir macht es Vergnügen, den Finger drauf zu legen, wenn sich die Wirklichkeit anders verhält, als sich das für kompetent geltende Menschen ausgedacht haben. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie...
Ich hatte erst bei Kilometer 8 das Gefühl, nun meine Betriebstemperatur erreicht zu haben. München unterm inzwischen wieder weißblauen Himmel hatte zu leuchten begonnen (wenn man München lobt, darf dies auch ein Norddeutscher wie Thomas Mann tun), und bei Kilometer 12 war mir die wärmende Jacke lästig. Ihr vorläufiges Ende fand sie auf einem Pflock im Englischen Garten. Das Umstecken der Startnummer freilich kostete wertvolle Sekunden, sonst nämlich hätte ich meine Berliner Marathon-Zeit erreicht; so aber blieb ich 13 Sekunden darüber. Es war der Test, ob die Zeit des Berlin-Marathons eine unverdiente Gnade oder eine verläßliche Anzeige des Trainingsstandes nach 16 Monaten war.
Erstmals sind wir die Strecke andersherum gelaufen, bei Kilometer 5,5 schon in den Englischen Garten. Meine Meinung ist zwiespältig. Es wird einem jetzt klar, daß man bei diesem Stadtmarathon nicht gar so viel Stadt, verstanden als unverwechselbare Urbanität, zu sehen bekommt. Mehr als das erste Drittel geht herum, bis man nach einem Appendix in die Leopoldstraße, die man insgesamt viermal zurücklegt, den Englischen Garten erreicht und passiert hat. Im zweiten Drittel, das erst durch Villenstraßen, dann durch Gewerbegebiet und am Ostbahnhof entlang führt, freut man sich auf den Stadtkern. Doch das Isartor erscheint erst bei Kilometer 29. Die Zuschauer am Marienplatz und am Rathaus bekommen dann, wenn sie etwas ausharren, ziemlich abgeschlaffte Läuferinnen und Läufer zu sehen. Die Kilometer 32 bis nach 36 spielen sich auf einem eng begrenzten Areal ab; eigentlich will man ja nicht in einem Hippodrom laufen. Doch ich sehe ein, daß die Streckenführung in einer so verkehrsreichen Stadt wie München schwierig sein mag; allein die Trambahn-Schienen, die wir überquert haben, zeugen davon, wie stark der Marathon in die Verkehrsführung eingreift. Aber ganz objektiv: Die Strecke des München-Marathons ist nicht so schön, wie man von München erwartet. Es versöhnen Start und Ziel im Olympiapark, die professionelle Organisation und der Empfang im Stadion. Dank einem Sponsor haben wir endlich einmal einen ordentlichen Stadtplan mit eingezeichneter Strecke im Läuferbeutel vorgefunden. Der magisch illuminierte Weg durch das Marathontor, einen Tunnel unter der Tribüne, erhöht mit Sicherheit den Adrenalinspiegel. Nach dem Zieleinlauf gab es selbst für uns am Schluß noch genügend Bananen, Brezeln und alkoholfreies Weißbier. Allzuoft ist das Angebot am Ziel dürftiger als an der Strecke oder gar nicht vorhanden; selbst der Beutel, den man nun in Berlin überreicht bekommt, war dagegen ziemlich knapp bestückt.
Wir am Schluß.... Ich wäre gern zum 40. Schwarzwald-Marathon gefahren, weil sich mit ihm stark die Erinnerung an meinen Marathon-Beginn verknüpft. Auch der beinahe vor der Haustür liegende Bottwartal-Marathon hat mich gereizt. Doch der Zielschluß ist hier wie so häufig nach 5:30 Stunden. Davon war ich auch beim Schwarzwald-Marathon ausgegangen, tatsächlich sind es, zumindest heute, 6 Stunden. Dennoch war mein Entschluß richtig; der Schwarzwald-Marathon kennt nur Altersklassen bis M/W 70. Warum soll ich dorthin gehen, wo man uns Alte benachteiligt? Stadtmarathons dagegen behalten die Fünf-Jahr-Einteilung bis M 80 bei und lassen das Ziel über 6 Stunden – in München 6:30 Stunden – offen. Ich räsoniere nicht, sondern mache auf die Logik in der Teilnehmerstatistik aufmerksam: Der 22. München-Marathon hat – auch ohne den 10-km-Lauf – die bisher höchste Teilnehmerzahl erreicht, ebenso der Berlin-Marathon. Frankfurt steuert auf einen Teilnehmer-Rekord zu. Hamburg und Köln haben auf sehr hohem Niveau einen nur geringfügigen Rückgang. Dies alles gegen den gegenwärtigen Trend deutlicher Teilnehmerrückgänge beim Marathon. Ob für dieses Phänomen nicht auch die Zielschlußzeit eine Rolle spielt? Tausende von Marathon-Erststartern gehen jährlich auf die Strecke. Sie gehen dorthin, wo sie genügend Zeit und die Chance haben, das Ziel notfalls auch noch im Gehschritt zu erreichen. Einige Zeit lief ich mit meinem 7:30-Minuten-Schnitt hinter einer jungen Läuferin; als ich sie überholte und wir ein paar Worte wechselten, teilte sie mit, dies sei ihr erster Marathon, und sie wolle nichts anderes als ankommen. Am Ziel sprach ich mit einer weiteren, älteren Erst-Marathonläuferin, die offenbar auch gerade die Zielmatten überquert hatte. In einem Forum habe ich neulich eine törichte Äußerung gelesen; man solle die Zielzeiten verkürzen, nach fünf Stunden sei das ja kein Laufen mehr. Nur zu, dann beschleunigt sich noch der Schub zu den großen Marathons, die auch Gehpassagen ihrer Teilnehmer berücksichtigen. Sicher würden manche Erststarter gern in aller Stille, bei einem Landschaftsmarathon, ihre Ausdauer erproben oder die Landschaft im Zuckeltrab genießen wollen. Da keine Leute an der Strecke stehen, tut’s auch nichts, wenn es mit dem Traben nicht mehr geht. Zwar bin ich selbst bei meinem ersten Marathon knapp viereinhalb Stunden gelaufen – aber um den Preis beträchtlicher Schinderei. Ich würde niemandem raten, beim ersten Marathon auf eine Strecke zu gehen, deren Zielschluß Streß provoziert. Bei einem Zielschluß von 5:30 Stunden ist so gut wie sicher, daß ein Erststarter hier auf lauter trainierte und erfahrene Teilnehmer träfe und sich von vornherein mit der Rolle des oder der abgeschlagenen Letzten begnügen müßte – für eine „Marathon-Karriere“ nicht gerade motivierend. Natürlich denke ich auch an uns Alte. Warum denn ist eine M 80 nur beim Berlin-Marathon und vielleicht noch bei einem anderen Stadtmarathon besetzt, obwohl gerade wir Alten den Landschaftslauf schätzen? Die demographischen Veränderungen, die zu einem neuen Potential in den Altersklassen führen, haben offenbar bei zahlreichen Veranstaltern nicht zum Nachdenken geführt. Versteht sich, daß man mit Angeboten zunächst in Vorleistung treten muß. Es ist eine Ironie, daß ich Ende der sechziger Jahre in die Interessengemeinschaft älterer Langstreckenläufer eingetreten bin, weil ich van Aakens Idee vom lifetime-Sport überzeugend fand., und nun, da ich eine Vereinigung dieser Zielsetzung selbst brauchte, gibt es sie nicht mehr.
Bei oder besser vor so manchem der letzten Marathons habe ich mich gefragt, ob ich nicht doch einen kläglichen oder lächerlichen Anblick böte, wenn ich in einer Geschwindigkeit trabte, die von einem raschen Geher auch erreicht werden könnte. Doch die dümmlichen Zurufe „Schneller!“, die wir früher auf unseren Trainingsläufen vernahmen, – sie bleiben aus. Der Sport Hochaltriger ist akzeptiert, wenn nicht sogar respektiert. Das habe ich auch wieder beim München-Marathon erfahren. München war einst geradezu berüchtigt dafür, daß man hier ohne nennenswertes Publikum lief. Die Münchner samt der „Süddeutschen“ ignorierten uns. Das hat sich geändert. Ob das mit der Umkehrung der Strecke zusammenhängt? Ich möchte das für eine zu einfache Begründung halten. Mir schienen am Sonntag auch die Reaktionen des Publikums lebhafter, interessierter zu sein als früher. Der Marathon scheint auch in München und seinen Medien angekommen zu sein.
Wer redet heute, vierzehn Tage nach dem Berlin-Marathon, von Haile Gebrselassie? Er ist den Weltrekord gelaufen. Fertig. Für eine ganze Weile spannender dürfte die Disqualifikation eines Läufers sein. Nun werden bei solchen Stadtmarathons immer wieder Teilnehmer disqualifiziert; Mark Milde, der Renndirektor, gibt die Zahl derjenigen, die beim Berlin-Marathon betrügen, mit etwa 40 an. Bereits am Tage nach dem Marathon ist man einem Betrüger auf die Schliche gekommen, dem angeblichen Sieger der Altersklasse 55, der nach 2:40:57 Stunden eingelaufen war. Nur – es fehlen ihm die Zwischenzeiten von Kilometer 25 und 30. Und es gibt noch andere Indizien für den Betrug. Bereits einem Photographen – dem New Yorker Victor Sailer, einem der erfahrensten Marathon-Photographen, Mitarbeiter von „Runner’s World“ – war der Mann mit den ausgebreiteten Armen aufgefallen: Er trug eine lange Hose und zwei Jacken und schwitzte nicht. Selbst bei uns im hinteren Feld wäre diese Bekleidung unangemessen gewesen. Bei Kilometer 20 hatte der Betrüger eine Zwischenzeit von 1:42:42, eine ordentliche Zwischenzeit für einen 3:30-Läufer. Doch die nächste Zwischenzeit bei Kilometer 35 lautete auf 2:03.53 Stunden. Der Läufer hatte – angeblich – die 15 Kilometer in 21:11 Minuten zurückgelegt; mit einem anderthalb-Minuten-Schnitt für den Kilometer wäre er Haile Gebrselassie nur so vorangeflogen. Leider fiel er dann aber wieder ins Fünf-Minuten-Tempo zurück, wurde aber immerhin als 146. registriert.
Für einen Betrug ist auf dieser Strecke nicht einmal die Kenntnis des U-Bahn-Netzes notwendig; Kilometer 20 und Kilometer 35 liegen nur etwa 400 Meter auseinander. Wir sind auf dem Weg von Kreuzberg nach Schöneberg von der Goebenstraße nach links in die Potsdamer Straße eingebogen und nach Kilometer 35 von der Bülowstraße wieder nach links in die – Potsdamer Straße.
Nun müßte man sich mit einem offenbar recht naiven Menschen, der die Kette der Betrugsindizien nicht durchschaut hat, überhaupt nicht aufhalten, einem von etwa vierzig oder 0,01 Prozent der Teilnehmer halt. Doch der Mann mit der Startnummer 33751 ist nicht irgendwer. Es ist ein hochrangiger Politiker aus Mexiko; Roberto Madrazo Pinado war früher Parteichef der früheren Regierungspartei PRI, der Partido Revolución Institucional, Abgeordneter, Gouverneur des mexikanischen Bundesstaates Tobasco und im vorigen Jahr Kandidat für die Präsidentschaft Mexikos, das höchste Staatsamt. Kein Wunder also, daß sich, mit etwas Verspätung, wohl kaum ein mexikanisches Medium die Nachricht entgehen ließ, während der Fall in die deutschen Sportteile nicht durchgedrungen zu sein scheint. Dabei handelt es sich wohl um den prominentesten Fall von „Laufkriminalität“ – endlich mal was anderes als wieder eine neue Meldung vom Radsport (die Stuttgarter haben ja offenbar inzwischen bereut, daß sie von der Radweltmeisterschaft nicht lassen mochten).
Wie reagiert nun ein Politiker, wenn er mit einem derart massiven Betrugsvorwurf konfrontiert wird? Unsereiner würde sich schamvoll verkriechen, sich vielleicht auf Drogeneinfluß herausreden und zur Sühne den Rest seiner läuferischen Tage bei niederen Diensten wie dem Aufsammeln weggeworfener Pappbecher verbringen. Nicht so ein designierter Präsident. Ein Politiker reagiert politisch. Das bedeutet: Er macht einen Bogen um die Wahrheit sowie große Worte und führt nutzlose Fakten zum Beweis seiner Integrität an. Señor Madrazo hat sich, gestern wohl, mit einer Erklärung an die werte „communidad deportiva Mexicana“, an die mexikanische Sportöffentlichkeit, gewandt. Mein Sportfreund Reinhard Schmid hat sie mir freundlicherweise am Telefon übersetzt. Danach bekundet der Politiker erst einmal sein hehres Sportverständnis. Das will man ja in solcher Situation hören. Ein klassischer Fall von Blablabla, der nicht auf Südamerika beschränkt ist. Dann zählt Señor Madrazo auf, welche bekannten seiner 36 Marathons er in welcher Zeit gelaufen ist – Fakten, die ihm niemand bestritten hat (auch typisch für eine politische Argumentation). Seine Zeiten bewegten sich zwischen 3:14 und 3:54 Stunden. Und was ist mit den 2:40 vom 30. September? Eine solche Zeit zu laufen, sei ihm im Alter von 55 Jahren gar nicht möglich. Aha. Ja, aber diese Zeit ist doch im Ziel gemessen worden? Señor Madrazo erklärt, nachdem er in Deutschland zwei Ärzte konsultiert habe (die Namen werden genannt, auch wieder typisch, denn das interessiert niemanden), habe er bei Kilometer 21 die Strecke verlassen und sich direkt zum Ziel begeben, um sich dort die Teilnahme-Medaille abzuholen, die bekanntlich ausnahmslos jeder Teilnehmer erhält. Dies kann man so wahrscheinlich mexikanischen Campesinos weismachen. Für die Marathonwelt ist es absolut neu, daß man sich eine Medaille abholen kann, wenn man nicht die volle Strecke gelaufen ist. Selbst wenn Señor Madrazo nach 36 Marathons und diversen kürzeren Strecken noch immer dieses Glaubens sein sollte, nahm er keineswegs die Startnummer 33751 ab und den Chip vom Schuh; auch begab er sich nicht direkt zum Ziel, sondern vor Kilometer 35 wieder auf die Strecke, fortan wieder über die Matten und lief in Siegerpose mit ausgebreiteten Armen über die Matten am Ziel. Über YouTube kann man diesen Einlauf im Video sehen; man braucht bei Google nur den Namen Roberto Madrazo einzugeben und erhält eine Fülle von Informationen. Es bleibt nicht verborgen, daß es bei Wahlen, an denen er beteiligt gewesen ist, nicht immer mit rechten Dingen zugegangen sein soll. Es ist wie bei Rosie Ruiz, die in den achtziger Jahren den Boston-Marathon mit Hilfe der Unterpflaster-Straßenbahn gewann; sie wurde auch im wirklichen Leben kriminell.
Den Betrugsversuch beim Berlin-Marathon, eben einen von vielen, könnte man nur als ärgerlich einstufen; doch die Frechheit des Präsidenten-Kandidaten, seinen Zieleinlauf nach etwa 28 Kilometern mit dem „Abholen“ der „Teilnehmermedaille“ zu begründen, ist empörend. Man muß sich dazu vor Augen halten, daß ihn, den Betrüger, wäre er im vorigen Jahr tatsächlich Staatspräsident von Mexiko geworden, eines Tages womöglich die deutsche Bundeskanzlerin, die Schirmherrin des Berlin-Marathons, als Staatsbesuch empfangen hätte. Im November wird sich Roberto Madrazo „Teilnehmermedaillen“ beim 10-Kilometer-Lauf in Mexiko-Stadt und beim Halbmarathon von Philadelphia „abholen“, im Dezember in Barbados und in Dallas, im Januar in Miami, im Februar beim Halbmarathon in Austin und im April beim Marathon in Paris. Als Renndirektor von Paris würde ich ihm die Startgebühr zurücküberweisen. Immerhin hat der Sport dazu beigetragen, ein Politikerbild zu demaskieren, wiewohl Madrazo mit seiner Erklärung, in der von Ehre die Rede ist, die verrutschte Maske des aufrichtigen Sportlers geradezurücken versucht. Wir brauchen einfach mehr Politiker, die Marathon laufen, dann würde vieles klarer.
Zum Berlin-Marathon – und zu anderen Stadtmarathons ähnlicher Größenordnung – gibt es zwei Betrachtungsweisen. Wie im wirklichen Leben, – die eine schließt die andere nicht aus. Kann es denn sein, daß ein Mensch wie ich, ein Individualist, der ein Leben lang Massenansammlungen verabscheut hat, seien es NS-Reichsparteitage (im Film) oder Hexenkessel von Fußballstadien, immer wieder auch bei einem der riesigen Stadtmarathons gestartet ist? Es ist so, und in Berlin mit angeblich 40000 Teilnehmern, jedenfalls aber über 32500 Zielläufern, nun gar zum zehntenmal. Gewiß, manchmal leide ich dabei. Doch leide ich nicht auch beim Landschaftslauf, wenn ich abgeschlagen der Letzte bin und weiß, daß sie alle warten, bis ich endlich ins Ziel gelange?
Schon die Abholung der Startnummer schlug auf die Stimmung, abgesehen davon, daß ich bei der Messe in Berlin ankam, als gerade ein Gewitterregen niederprasselte und mir auf dem abfallenden Messedamm ein Bach den direkten Weg vom Auto zum Bürgersteig verwehrte. Beruflich habe ich viele Messen besucht – 1951, als ich in einem Ostberliner Verlag gearbeitet habe, war ich gar selbst für einen Messestand auf der Leipziger Buchmesse verantwortlich –, aber heute muß ich mir eingestehen, daß sich offenbar eine Messe-Phobie entwickelt hat. Nur wenn ich mir eine ganz konkrete Aufgabe stelle oder gestellt bekomme, kriegt man mich auf eine Messe. Selbst die Schnäppchen, die man da vielleicht machen kann, sind mir zu teuer erkauft. Obwohl ich also Zeit genug gehabt hätte, am Freitagabend durch die Marathonmesse, die in Berlin zur Gesundheitsmesse mutiert ist, zu bummeln, hat es mich sofort, nachdem ich die Startnummer empfangen und die Chip-Prüfung passiert hatte, von hinnen gedrängt. Außerdem hatte es zu regnen aufgehört. Die Wetterprognose schien sich zu bestätigen. Haile Gebrselassie fand die Bedingungen am Sonntag optimal.
Die Betrachtungsweise des Landschaftsläufers: Von dem Moment an, in dem man die S-Bahn-Station betritt, kann man nichts mehr tun, als sich von der Masse der mit roten Beuteln ausgerüsteten Läufer vereinnahmen zu lassen. Vom Zug werde ich unaufhaltsam an den Start gespült. Der Fußgängersteg hält uns, da wir nicht im Gleichschritt marschieren, noch stand. Für den Weg in die Startposition, einschließlich Benützung öffentlicher Verkehrsmittel in Berlin, veranschlagt der Veranstalter anderthalb bis zwei Stunden. Noch immer werde ich zornig, wenn ich mich daran erinnere, daß ich beim Rom-Marathon auf einen Reiseleiter hereingefallen bin, der den Aufbruch seiner Reisegruppe zum Start am Kolosseum entgegen der Empfehlung und meinem Einwand bei weitem zu kurz terminiert hatte (den neuen Prospekt des Reiseveranstalters habe ich daher mit spitzen Fingern in den Papierkorb plumpsen lassen). Da ich als Individualtourist auch in Berlin rechtzeitig am Start gewesen bin – bei Ausfall der S-Bahn hätte es mir auch zu Fuß bequem gelangt – , lasse ich mich auf der Straße des 17. Juni nieder und beobachte, wie sich die breite Startfläche füllt. Amüsiert beobachte ich, wie sich meine künftigen Mitbewerber durch die Aufwärm-Gymnastik fertigmachen lassen; auch so kann man seine Glykogenreserven vernichten und Muskeln strapazieren. Nur zu, das bringt mich weiter. Obwohl ich vorgehabt habe, mich am Ende des letzten Blocks zu placieren, bin ich auf einmal nicht mehr am Ende. Dennoch drängen noch immer Läufer an mir vorbei nach vorn. Ich denke, der Start bei solchen City-Marathons produziert den stärksten Streß.
Auf den Start zu warten, wäre nicht weiter schlimm. Doch der musikalische Krach, den die Lautsprecher verbreiten, dröhnt in meinen Ohren. Wieso eigentlich wird Industrielärm bekämpft, dieser aber vorsätzlich produziert? Haben denn alle 40000 Menschen oder sagen wir: 35000, die wir in diesem Pferch sind, einen so schlechten Geschmack? Im Forum von SCC-Running stoße ich jedoch auf die Bemerkung „Läufer sind sensibel“, in der ebenfalls der Krach beklagt wird. Sie bezieht sich allerdings auf die Party im Postbahnhof am Ostbahnhof (früher Schlesischen Bahnhof), in dem am Sonntagabend die Marathon-Party stattfindet. Ich war dort und hatte sogar meine Startnummer eingesteckt, um sie von Haile Gebrselassie signieren zu lassen. Doch ehe er noch kam, verließ ich den Postbahnhof. Auch hier stieß mich die Aggression aufs Trommelfell ab, enttäuschte mich ein dürftiges Imbiß-Angebot mit dem straßenüblichen Nahrungsmüll – so mochte ich meinen Hunger nicht stillen – und vermißte ich Sitzgelegenheiten. Ein Gespräch, der Austausch von Emotionen, der Nachfeiern beim Landschaftsmarathon so familiär macht, wäre nicht möglich gewesen. Zwanzig Minuten später saß ich behaglich am Schiffbauerdamm, aß gepflegt und versuchte, den Marathon-Verlauf auch ohne gebeamte Bilder im Geiste abzuspulen. Ich bin beim Start
Der zeitversetzte Blockstart verhindert, daß sich Emotionen entladen. Startschuß ganz gedämpft, Luftballons entschweben, die unreinen Lautsprecher werden hymnisch. Zwanzig Minuten nach Gebrselassie und den anderen, darunter Falk Cierpinski (die Namensgleichheit ist nicht zufällig), sind wir dran. Fortan der quälende Versuch, die eigene Position zu behaupten. Bis zur Jugendvollzugsanstalt in Moabit dauert es, ehe ich meinen Rhythmus gefunden habe. Wie immer bei Massenläufen, hinten, wo die Erststarter sind, wird undiszipliniert gelaufen. Mehrfach spüre ich einen fremden Fuß an meiner Sohle. Meine Aufmerksamkeit wird durch quer überholende Läufer beansprucht. So geht es zu beim größten City-Marathon.
Dennoch, dieser Lauf ist unerhört wichtig für mich. Ich habe erst die Strecke zurückgelegt, die ich vom Training her im Griff habe. Alles andere liegt im Nebel. Bei den drei Landschaftsmarathons, die ich seit der Bypaß-Operation bewältigt habe, haben die Anstiege den Gehschritt erzwungen. Bei einem flachen Stadtmarathon kommt die Stunde der Wahrheit.. Hier kann ich mich nicht mit topographischen Argumenten durchmogeln und nach achtstündiger Laufwanderung auf Milde hoffen. Hier muß ich zeigen, ob ich nun endlich wieder einen Marathon laufen kann. Genau deshalb bin ich hier gestartet.
Die andere Betrachtungsweise also: Was ich vorhabe, geht nur bei einem Stadtmarathon. Über zweiunddreißigtausend andere motivieren mich, im Strom zu schwimmen, dran zu bleiben, nicht zu gehen, wenn ich gehen möchte. Es ist tollkühn gewesen, bei einem solchen Marathon zu starten, wenn man nur weiß, daß man bisher 75 Minuten lang ununterbrochen laufen kann. Immer bin ich beim Berlin-Marathon auf die Zeit bedacht gewesen, und von 3:22 bis 5:14 Stunden kann man die Altersspanne ablesen. Jetzt hingegen kenne ich nur das eine Ziel: Durchlaufen, bei strikt limitierten Gehpausen an einigen Verpflegungsstellen. Für eine Anzahl Läufer scheint es ein Problem gewesen zu sein, daß an einer Verpflegungsstelle die Becher ausgegangen waren. Als Ultraläufer kann man nur die Achseln zucken: Wenn’s weiter nichts ist.... Die Parallelgesellschaft kreuzt meinen Weg; plötzlich ist die Frau mit einem großen Pappkarton vor mir und überläßt es mir auszuweichen. Das regt mich auf. Kann man sich nicht wenigstens an einem Tag im Jahr anpassen und den Marathonern den Vortritt lassen?
Sightseeing, Publikum, Kommunikation, alles ist in diesem Jahr zurückgetreten, es geht nur um die Ökonomie des Laufens. Nicht nur; es geht vor allem auch um die Balance zwischen Herausforderung und Kontrolle. Was sagt das Herz? Und wenn ich es bei Kilometer 18 spüre, was will es mir sagen? Ich will nicht mit meinem Leben spielen, aber ich will mich auch nicht dem Leben – und das bedeutet eben auch Laufen – verweigern. Schließlich ist auch in der Herzsportgruppe ein Restrisiko vorhanden, daher wird selbst auf der Walkingstrecke der Defibrillator mitgeführt. Dämliche Frage vor dem Brandenburger Tor, ob Marathon gesund sei. Ich mag jetzt, verdammt, kein Referat halten und begnüge mich mit der stupiden Feststellung, ja, 326 Marathons, dies sei der 327.
Und der zehnte Berlin-Marathon... Seit drei Jahren wieder ein Berlin-Marathon, höchste Zeit. Wenn ich meine Eindrücke bündele: Berlin ist immer attraktiver geworden. Die Erinnerung an die Wunden des Krieges verblaßt. Ich habe ja 1949 bis 1951 alles noch gesehen, die Trümmerbahn, die durch die Linienstraße am Alex fauchte, die Trümmerfrauen, die Ziegel weiterreichten. Nicht nur die Straßenzeilen, durch die ich trabe, sind attraktiv geworden. Auch die Menschen haben sich angenehm verändert. Die Phase des Provinzialismus in Berlin, als es eine Insel war, ist überwunden. Berlin ist wieder die Weltstadt, die es einst war. Berlin hat wieder seinen eigenen Charme, wie alle Weltstädte einen zuweilen rauhen Charme. Wieder packt mich der Zorn über die Politiker der Rhein-Republik, die sich dagegen gestemmt haben, Berlin zur Bundeshauptstadt zu machen. Es erfüllt mich mit tiefer Befriedigung, daß auch der unbedeutende Grunewaldmarathon, dessen Teilnehmerzahl unter der des Schönbuchmarathons in Leinfelden-Echterdingen lag, zum Weltstadtmarathon geworden ist. Schon deshalb muß ich hier laufen.
Beim Halbmarathon hätte ich aufhören wollen, aber das war ja bei meinem ersten Marathon vor fast vierzig Jahren viel stärker der Fall. Die Erfahrung trägt weiter und macht es leichter. Kein Ehrgeiz jetzt, nur weitertraben, so wie ich bisher getrabt bin. In der Leipziger Straße ist es mir aufgefallen: Ich bin, soweit mein Blickfeld reicht, unversehens der einzige, der trabt. Gewiß, es gab eine Power-Walkerin, die eine Minute schneller war als ich. Doch ich durfte als Marathonläufer gelten. Zielschluß in Berlin ist nach 6:15 Stunden. Wo darf unsereiner denn noch Marathon laufen außer auf einer solchen Massenveranstaltung? Weder gibt es bei Landschaftsmarathons soviel Zeit – und wenn, dann reicht sie für uns nicht einmal – noch gibt es da eine M 80. Hier sind wir zu dritt gewesen; erst aus der Liste erfuhr ich, daß die Schweizerin Pina Gurtner mitgelaufen ist. Ein Brasilianer ist zehn Minuten schneller als ich gewesen. Doch mit meiner Zeit von 5:31:07 Stunden hätte ich bei den 17. Senioren-Weltmeisterschaften im September in Riccione locker die Goldmedaille gewonnen. Ich hätte nur hinfliegen müssen und ein paar Gehpausen mehr machen können. Da wäre ich jetzt in der Statistik Marathon-Weltmeister in M 80 und hätte ein miserables Gefühl, denn ich weiß ja, daß es bessere Läufer in M 80 gibt als mich, den Rekonvaleszenten. Mein Verdacht bestätigt sich: Solche Meisterschaften sind eher touristische Unternehmungen. Die Teilnahme taugt dazu, sich dann später im lokalen Rathaus als Seniorensportler feiern zu lassen, wie ich das beobachtet habe. Da ist die Teilnahme an einer Massenveranstaltung mit qualitativ meistens besser besetzten Altersklassen ein tauglicherer Ausweis der eigenen Leistungsfähigkeit. In Riccione hätte ich mich, den Berichten nach, ohnehin über Unzulänglichkeiten, wenn nicht gar Chaos geärgert. Den Weltstadtmarathon Berlin dagegen habe ich mit hohem Respekt vor der Professionalität der Organisation verlassen.
| Zu weiteren Tagebuch-Eintragungen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | |
| 2016 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2015 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2014 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2013 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2012 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2011 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2010 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2009 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2008 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2007 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2006 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2005 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2004 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2003 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2002 | Alle Eintragungen HIER | |||
| Zurück zur den aktuellen Eintragungen HIER | ||||
| Zu weiteren aktuellen Inhalten bei LaufReport.de | ||||