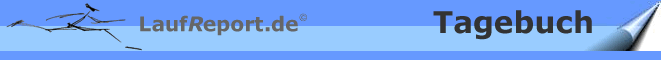

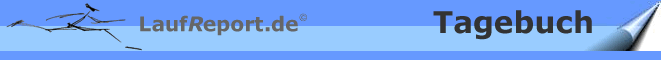  |
|
Laufen, Schauen, Denken Sonntags Tagebuch |
 |
 |
Zahlen sind immer relativ – 2000 Zuschauer beim Schönbuch-Marathon wären eine Sensation, 20000 Zuschauer beim Berlin-Marathon eine Katastrophe. Daher weiß man als Referent nie, ob ein Publikum nun zahlreich ist oder nicht. Das kann nur der Veranstalter beurteilen. Thomas Schäfer, der mich nach Mainz zu den alljährlichen Seniorentagen eingeladen hatte, war mit der Resonanz auf die Vortragsankündigung nicht zufrieden. Ich sehe das so: Wenn es um Sport im Alter geht, bleiben genau diejenigen weg, die mit Sport im Alter nichts am Hut haben. Diejenigen, die Sport im Alter treiben, kommen deshalb nicht, weil sie ja schon aktiv sind und keinen Motivationsschub mehr brauchen. Über dieses Paradoxon, das sich nicht nur auf das Laufen bezieht, war ich mir vorher schon im klaren. |
Die Wissenschaft hat es objektiviert. Im „Handbuch Alterssport“, aus dem ich Zitate vorgesehen hatte, habe ich gelesen: „Solange viele Ältere noch keine gravierenden körperlichen und gesundheitlichen Einschränkungen erfahren haben und die Alltagsanforderungen noch gut meistern können, sehen sie mehrheitlich keine Notwendigkeit, sich durch regelmäßige sportliche Bewegung fit und gesund zu erhalten. Ergeben sich dann mit zunehmendem Alter Einschränkungen – nicht zuletzt auf Grund mangelnder Bewegung –, wird dies – berechtigt oder nicht – als ein Grund für Inaktivität angeführt.“ Ein Teufelskreis also. Immerhin, diejenigen, die zu „Laufend aktiv älter werden“ gekommen waren, sind aktive Menschen – so aktiv, daß sie über Laufen und Walken noch etwas mehr wissen oder zumindest sich bestätigt sehen wollten.
Freilich, zum vorangegangenen Lauf hätte man mehr Teilnehmer erwarten können. Doch ich kenne das, warum soll man sich außerhalb seiner gewohnten Trainingsrunden, seien es individuelle oder im Lauftreff, auf den Weg machen, nur weil ein gemeinsamer Lauf zum Programm einer Veranstaltung gehört? Wochen vorher war ich noch im Zweifel darüber, ob mir die Zeit bis zum Vortragsbeginn für die knapp 9 Kilometer reichen würde. Doch dann traute ich mir die Strecke als Intervalltraining zu. Drei Tage vor dem gemeinsamen Lauf wieder Zweifel. Am Sonntag wurde ich von Herzstichen geplagt, die waren doch in meiner ganzen Rekonvaleszentenzeit nicht vorgekommen. Ich führe sie auf eine ungewohnte Belastung zurück, den Aufstieg über den Treppenaufgang zur Eßlinger Burg. Da kommt auch ein trainierter Mensch ins Schwitzen. Am Montag legte ich meine Trainingsstrecke fast nur gehend zurück. Das Herz beruhigte sich wieder. Der Mainzer Dreibrückenlauf am Mittwoch brachte keinerlei Probleme. Im Gegenteil, ich hatte – wie beim Halbmarathon des Swiss Alpine – das Gefühl, eine Barriere übersprungen zu haben. Der gemeinsame Lauf motivierte mich zu ausgedehnteren Laufintervallen als auf der alltäglichen Trainingsstrecke. 8,7 Kilometer in etwa 75 Minuten – damit bin ich hoch zufrieden. Wenn die Uhrzeit stimmt – ich war mit der Messung wieder einmal nachlässig –, dann hätte ich einen Kilometerschnitt von achtzweidrittel Minuten gehabt. Wenn sie so nicht stimmt, waren es auf jeden Fall immerhin unter 10 Minuten für den Kilometer. Darauf läßt sich psychisch aufbauen.
Die Laufstrecke fand ich hervorragend. Vor über zwei Jahrzehnten habe ich eine Mappe mit Material für einen Laufführer angelegt. Ich hatte vor, für jede größere Stadt eine Laufstrecke zu beschreiben. Den Gedanken habe ich dann – auch unter dem Eindruck einer ganzen, professionell gemachten Buchreihe „Laufen in....“ – fallengelassen. Der Aufwand wäre für einen einzelnen immens gewesen. In diesen Laufführer hätte ich unbedingt die Mainzer Strecke aufgenommen. Sie besticht vor allem durch das Rhein-Panorama. Zudem bietet sie eine leichte Orientierung und läßt sich wahrscheinlich auch bei Dunkelheit laufen.
Am Sonntag habe ich mir angesehen, wo und wie ich operiert worden bin. Die Sana Herzchirurgische Klinik Stuttgart hatte zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Er nahm den Charakter eines Volksfestes an. Hunderte von Menschen drängten sich gruppenweise in den Gängen. In dem freigegebenen Operationssaal demonstrierte eine Operateurin den Gebrauch der Instrumente und faßte – in der Wirtschaft sagt man wohl so – das operative Geschäft von zwei bis sechs Stunden in wenigen Minuten zusammen. Wir alle hätten gern noch viel mehr gewußt, doch die nächste Gruppe harrte ungeduldig vor der Tür. Den Operationssaal hatte ich mir viel größer vorgestellt, was wahrscheinlich daran liegt, daß mein Blickwinkel, als ich im Februar zur Operation in den Raum geschoben worden war, stark verengt war. In Erinnerung ist mir noch der Anblick einer bereits fertig grün verkleideten Ärztin, die mir etwas unschlüssig herumzustehen schien. Es war Montagmorgen, und ich war der erste zu Operierende. Doch zu weiteren Reflexionen kam es nicht mehr. Eine Ärztin stellte sich mir mit den Worten vor: „Ich bin Ihre Anästhesistin.“ Wie das klingt! Unvorstellbar, daß einem auf dem Finanzamt gesagt wird: „Ich bin Ihr Steuer-Sachbearbeiter!“ Oder in Cottbus nach der Geschwindigkeitsüberschreitung: „Ich bin Ihre Oberkommissarin und muß Sie leider gebührenpflichtig verwarnen!“ Die Operateurin am Sonntag im Herzklinikum wirkte fraulich. Wenn sie gesagt hätte „Jetzt zeige ich Ihnen, wie man einen Hefeteig zubereitet“, hätte mich das genauso von ihrer Kompetenz überzeugt. Als in der Gruppe einer von uns älteren Herren zusammenbrach, ließ sie das ziemlich ungerührt. Sie wußte Prioritäten zu setzen, und die Priorität waren nun einmal die informationshungrigen Besucher. Den Zwischenfall hatte sie ja auch kommen sehen. Zu Beginn hatte sie geraten: Wenn jemandem schwummrig werde, solle er sich am besten auf den Boden legen. Die Operationsschwester, an ansehnlichere Zwischenfälle gewöhnt, holte mehr symbolischerweise einen Arzt-Kollegen, der sich des zu Boden Geglittenen annahm, während die Operateurin die Frage beantwortete, ob denn beim Aufsägen nicht der Knochen splittere. Nein, das nicht, aber Säge-, nein Knochenspäne entstünden, und die würden abgesaugt. Ich versuchte, mir Rechenschaft darüber abzulegen, ob mir auch schwummrig geworden sei. Doch nein, ich fühlte mich absolut standfest. Wahrscheinlich hätte ich auch eine Demonstration am lebenden Modell ertragen. Da wußte ich, daß ich wiederhergestellt bin.
Draußen an der frischen Luft waren Bierbänke und -tische unter Zeltdächern aufgebaut; dort ließen es sich die dem wohligen Grauen unbeschadet entronnenen Besucher wohl sein. Ich sah ebenso wohlgefüllte Teller. Was an uns Operierten während der Zeit der künstlichen Ernährung eingespart wird – jedenfalls im Küchenbudget, mitnichten im Klinikhaushalt –, konnte hier freigiebig ausgeteilt werden. Alle Bänke waren besetzt, und am Kaffee- und Kuchenstand wartete eine lange Schlange. Die Standardformel – von der Möbelhaus- bis zur Herzklinikum-Besichtigung – heißt: „Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt.“ Die Formel ist hier wichtig, wir sind im schwäbischen Kernland.
Falls ich gefragt werde, was dies in einem Läufertagebuch zu suchen habe, – es versteht sich, daß es einen läuferischen Bezug gibt. Ich mußte ihn nicht erfinden. Während wir im Untergeschoß des Herzklinikums auf Einlaß in den Operationssaal warteten, beantwortete der Hausherr, der ärztliche Direktor, einige Fragen. Eine Frage ließ mich aufhorchen. Ein Besucher vor mir wollte wissen, ob er, bypaß-operiert, wieder Leistungssport betreiben könne. Das wäre genau meine Frage gewesen, wenn sie mir nicht schon beantwortet worden wäre. Auch die Antwort des Professors fiel positiv aus. Man könne, so faßte ich es auf, mit dem operierten Herzen so ziemlich alles machen. Nun interessierte mich aber, was der Fragesteller unter Leistungssport verstand, Kegeln, Reiten, Tischtennis? Welchen Leistungssport haben Sie betrieben? erlaubte ich mir zu fragen. Marathon, antwortete er. Ich antwortete ebenso bündig: Ich auch. Schade, daß die Bierbänke draußen besetzt waren.
Zum zweitenmal ist es mir nun passiert, daß ich auf meiner Trainingsrunde von Fremden nach einer Lauf- oder Walkingstrecke gefragt worden bin. Kein Zufall, an meiner Laufstrecke liegt die Technische Akademie. Dort lassen sich Fachleute aus verschiedenen Technikbereichen in Lehrgängen über neue Entwicklungen informieren oder bilden sich auf ihrem Gebiet weiter. Im Einzugsbereich meiner Laufstrecke liegen auch Hotels, in denen Lehrgangsteilnehmer für die Dauer ihres Seminars oder Besucher von Industriebetrieben meiner Region wohnen. Das erstemal hatte mich eine solche ortsfremde Läuferin gefragt, ob sie sich mir anschließen dürfe. Sie vertraute einem Läufer offenbar mehr als der abstrakten Auskunft in ihrem Hotel. Diesmal waren es zwei junge Frauen, die mich ansprachen: Sie würden gern eine dreiviertel bis eine Stunde gehen; ob ich ihnen eine Strecke empfehlen könne? Schwierig, meine große Runde kam für sie nicht in Frage. Ich machte ihnen einen Vorschlag, aber ich merkte schon, daß er keineswegs perfekt sein würde. Ich kann auch nur hoffen, daß sie ohne Umstände wieder in ihr Hotel zurückgefunden haben.
Diese Erlebnisse erinnerten mich an einen Vorschlag, den ich Ende der sechziger oder Anfang der siebziger Jahre gemacht habe, als sich bereits die Laufbewegung abzuzeichnen begann. Es war die Zeit der Ideen, hier eine informelle Laufgruppe – noch vor den Lauftreffs –, dort die Anlegung einer Finnenbahn, hier ein Volkslauf, dort ein IVV-Marsch. Ich schlug vor – in welcher Form, weiß ich nicht mehr –, jede Gemeinde möge einen Rundweg ausweisen, für Läufer wie für Fußgänger mit Kinderwagen geeignet. Ich hatte sogar die Illusion, es sei anzustreben, diese Rundwege zu beleuchten. Doch die Gemeinden hatten dafür kein Ohr; sie mußten in meiner Region im Abstand von je 2 bis 6 Kilometern ein Hallenbad errichten. Als sich vier Gemeinden zu einer Stadt von etwas über 30000 Einwohnern zusammenschlossen, sah sich diese plötzlich im Besitz von vier Hallenbädern. Es versteht sich, daß dies schief gegangen ist. Für die Einrichtung eines Rundweges und gar erst für dessen Beleuchtung fehlten also ohnehin die Mittel, vor allem aber bei den Verantwortlichen der Nerv; mochten diese Verrückten doch sehen, wo sie laufen könnten. Schließlich gab es ja Sportplätze. Eine Tribüne für den Sportplatz war wichtiger als ein Rundweg für Läufer. Ein Wanderweg wurde dann nach dem Zusammenschluß zu einer Stadt tatsächlich ausgewiesen, ein Rundweg um alle vier Ortsteile. Wege unterschiedlichen Charakters wurden dazu vereinigt, Fahrwege für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Wanderpfade über Baumwurzeln, auch Straßen im Wohngebiet. Die Anlegung eines Wanderweges am Rand der Siedlung wäre rechtlich möglich gewesen; doch die Anwohner sträubten sich dagegen. Man weiß ja, wie störend Wanderer und Läufer sind. Ich wurde damals in den Ausschuß eingeladen, der die Wanderroute festlegen sollte (der damalige Baubürgermeister kannte mich vom Laufen her). Ich brachte den pragmatischen Vorschlag eines Rundweges ein, der auch für Läufer tauglich gewesen wäre; die Route war 22 Kilometer lang, wäre zu teilen gewesen und hätte eine leichte Orientierung geboten. Die Wanderwarte entschieden sich jedoch für einen Rundweg, mit dem gewissermaßen die Gemarkungsgrenzen der neuen Stadt abgesteckt wurden. Mir erschien dieser Weg als eine Papiergeburt. Wer würde einen solchen ausgedehnten Rundkurs in einer verdichteten Region wandern, gewissermaßen die Gemarkungsgrenze abschreiten wollen? Und gar erst, wer würde ihn zum zweitenmal wandern? Laufen hätten ihn nur diejenigen können, die sich gerade auf den Rennsteiglauf vorbereiteten. Erst recht kann man eine solche Wegkombination, bei der man trotz durchgängiger Markierung häufig nach der Fortsetzung suchen muß, nicht Ortsfremden empfehlen, die sich für ein oder allenfalls zwei Stunden Bewegung verschaffen wollen.
Viele Städte und Gemeinden haben inzwischen ihren markierten Rundweg. Der Eßlinger Höhenweg ist ganz schön, aber er mißt 27 Kilometer. Wer nicht so weit wandern will, muß abbrechen. Für den Stuttgarter Rundweg braucht ein bequemer Wanderer vier Tage. Mir scheint die Idee eines markierten Rundweges um oder in einem Ortsteil, mit leichter Orientierungsmöglichkeit auch für Ortsfremde noch immer aktuell zu sein, ja, vielleicht heute mehr denn je. Die Menschen sind mobiler, vor dreißig Jahren gab es hier noch keine Technische Akademie und nur zwei Hotels. Wir Läufer haben uns längst unseren eigenen Rundkurs gebastelt; doch für Ortsfremde sind diese privaten Laufrouten nicht nachvollziehbar. Bei der innerstädtischen Orientierung hat man sehr wohl an ortsunkundige Besucher gedacht, auf öffentliche Gebäude weist jeweils ein weißes Schild hin und auf die Hotels ein grünes. Doch laufende oder walkende Besucher sind auf die eigene Initiative angewiesen. Noch immer ist es die Ausnahme, daß in Hotels eine Skizze mit möglichen Laufrouten ausliegt.
So schmerzlich auch das Mißglücken meines letzten Marathons war, des Vollmond-Marathons am 14. Januar im fränkischen Hersbruck, so sehr hat es mich überrascht, daß ich hier meine Idee wiederzufinden glaubte; die Stadt hat zwei Lauf- und Walkingrouten auffällig markiert ausgewiesen. Wer hier als Ortsfremder zu seinem Training startet, braucht sich nur den Schildern anzuvertrauen. Bisher habe ich einen solchen Service noch nicht wiedergefunden. Bad Arolsen war zwar schon in der Frühzeit der Laufbewegung führend in der Ausweisung von Laufrouten; doch die Vielzahl von Wanderwegmarkierungen ist, solange man keinen Plan in der Hand hat, verwirrend. Als Läufer findet man den Weg vor lauter Markierungen nicht. Wie in Hersbruck sollten die Kennzeichnungen auffällig genug sein, damit sie auch ein Dreistunden-Marathon-Läufer noch wahrnehmen kann, und die Wege befestigt sein; Asphalt ist in Anbetracht der Laufschuhdämpfung kein Hindernis. Die Streckenlängen sollten realistisch auf die Tagesabläufe von Besuchern abgestimmt sein; mehr als eine halbe bis eine Stunde zwischen Seminar-Ende oder Geschäftsbesuch und Abendessen ist in der Regel nicht drin.
An den Vollmondmarathon, den mißglückten, bin ich jetzt noch einmal bei der Recherche gestoßen. Auf der Website von Hersbruck hoffte ich, auf die Abbildung eines Hersbrucker Walking-Wegweisers zu stoßen. Doch vergeblich. Dafür habe ich dann beim Weiterklicken erfahren, daß der Vollmond-Marathon am 9. August ausgefallen sei. Das ist bei dieser noch sehr jungen Veranstaltung zum zweitenmal geschehen. Ob meine kritischen Einwände vom Januar nicht vielleicht auch von denjenigen, die mich wegen meiner Kritik kritisiert haben, grundsätzlicher zu sehen sind, als ich damals selbst annahm? Nun ja, wir werden sehen; der Mond wird ja wieder aufgehen, hoffentlich zunehmen und als Vollmond uns alle mit mildem Glanz erleuchten, so daß sich Urteile verfestigen können. Darauf ein Hersbrucker Vollmond-Bier.
Fünfter Jahrestag des 11. September in New York. Ich erinnere mich, daß ich an jenem Nachmittag irgend etwas im Fernsehen suchte, sonst vermeide ich es, das Gerät einzuschalten, bevor ich mich durch die Abendnachrichten informieren lassen möchte. Ich erinnere mich, daß ich glaubte, versehentlich in einen Horrorfilm geraten zu sein, eine Gattung, die ich verabscheue. Doch es war Realität. Wenig später wollte ich laufen, doch ich ließ den Lauf ausfallen. Wohl das einzige Mal im Leben, daß ich Fernsehen dem Laufen vorgezogen habe.
Papstbesuch – der freundliche Herr drückte viele Hände, darunter auch die Hand eines Mädchens, das bauchfrei trug. Diese Unbefangenheit hätte ich mir in meiner Jugend gewünscht. Frauen durften nicht mit nackten Armen in die Kirche gehen, so warm es auch sein mochte. Die Kirche meiner Jugend war eine rigide Kirche. „In Demut und Reue bekenne ich meine Sünden....“ Es war soviel von Sünde die Rede. Bauchfrei wäre sicher eine Sünde gewesen, ein Verstoß gegen das 6. Gebot. Nicht nur jede Sexualität außerhalb der Ehe verstieß gegen das 6. Gebot, sondern auch unkeusche Gedanken. Hätten die Mädchen in meiner Jugend bauchfrei getragen, wäre ich aus den unkeuschen Gedanken nicht herausgekommen. Genau das hätten die bauchfreien Mädchen wahrscheinlich bezweckt. Warum nur braucht die katholische Kirche jeweils mindestens ein halbes Jahrhundert, um dem – in der Sprache der Juristen – „Wandel der sittlichen Anschauung“ zu folgen, ja, mehr als das: die menschliche Natur zu begreifen und zu akzeptieren! Wahrscheinlich habe ich in meiner katholischen Jugend eine „ekklesiogene Neurose“ gehabt, den Begriff fand ich später bei dem Psychiater Klaus Thomas („Handbuch der Selbstmordverhütung“). Die Selbstheilung konnte nur in einer Ablösung bestehen; der Prozeß war schmerzlich. Anderen mag es ähnlich ergangen sein. Und nun wundern sich die Kleriker.
Beim Laufen läßt sich vieles verarbeiten. Ich hätte in meiner Jugend mit dem Laufen beginnen sollen. Immerhin konnte ich dann später beim Laufen kühl meine Entwicklungsprozesse analysieren.
Am Wochenende stand für mich ein anderes Thema dieser Eintragung fest, ein Situationsbericht meines Lauftrainings. Nur an solchen Eintragungen kann ich Fortschritte meiner Rehabilitation festmachen. Am Donnerstag, dem 7. September, sieben Monate nach der Bypaß-Operation, bin ich erstmals nach der Uhr gelaufen: Eine Minute Gehen, eine Minute Laufen, etwa 6 Kilometer lang, danach verlängerte ich die Intervalle. Am Tag danach erkannte ich, daß der Trainingsschritt zu groß gewesen war. Unterwegs schon hatte sich eine Art Jucken in der Herzgegend eingestellt, am Tage danach wuchs sich das zu einem Schmerz aus. Ich griff zum Pschyrembel, dem Klinischen Wörterbuch, was in der Hand eines Laien sicherlich ein Frevel ist. Beruhigt erkannte ich, die traumatischen Symptome fehlten. Am Samstag legte ich einen Ruhetag ein. Sieben Monate – und noch immer die Folgen.... Ich fürchte, ich könnte zum Hypochonder werden. Heute habe ich das Experiment vom Donnerstag wiederholt, nur etwas vorsichtiger. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Niemand kann mir sagen, ob ich mich richtig verhalte. Bypaß-Patienten, die es zum Marathon geschafft haben, waren zum Zeitpunkt ihrer Operation erheblich jünger als ich.
Täglich eine Gammelfleisch-Meldung. Mich regt’s nicht auf, es braucht mich nicht aufzuregen. Wie viele Skandale habe ich als Vegetarier schon ungerührt erlebt! Und dabei bin ich erst seit 25 Jahren Vegetarier. Doch mit Sicherheit reduziert sich der Fleischkonsum auch unter dem Eindruck der Meldungen nicht, es kommt nur zu Verschiebungen. Rinderwahnsinn – Ausweichen auf Geflügel. Vogelgrippe – Ausweichen auf Rinder. Und zurück. Gegenwärtig stockt, wie ich gelesen habe, der Döner-Absatz. Doch was ginge uns damit verloren? Es gibt ja auch die Curry-Wurst. Bis vor einer Generation wußte hierzulande kein Mensch, was Döner Kebab ist. Inzwischen sollen damit, wie ich ebenfalls gehört habe, die Umsätze höher sein als bei dem Fast-Food-Verfütterer, dessen Verpackungen am Rande meiner Laufstrecke zu finden sind. Noch nicht einmal die Hälfte der Fleischkonsumenten kauft noch beim Fleischer. Denn der muß halt teurer sein, so wie die Biohöfe teurer verkaufen müssen.
Lachen muß ich, wenn ich von Befürchtungen lese, in meinem Getreidebrei, den ich über Nacht stehen lasse, entwickelten sich Keime. Die entwickeln sich auch in meinem Bauch, kaum ein Mensch unterzieht sich deshalb regelmäßigen Darmspülungen. Im Döner hingegen, der nur äußerlich gegrillt wird, entsteht darunter, wie ich der Sendung WISO heute entnommen habe, eine Temperatur, die den Nährboden zum Beispiel von Salmonellen bereitet. Wenn irgend etwas gegen rohes Getreide gesagt werden kann, wird es gesagt – beim Fleisch nur dann, wenn wie jetzt der Skandal nicht mehr zu verheimlichen ist. Es scheint mir auf dem Gebiet der Ernährung so zu sein wie vor über 30 Jahren mit der Reaktion auf die Laufbewegung. Was konnte man damals nicht alles an Schlimmem lesen? Jogger riskieren Kopf und Kragen, lautete einmal eine Überschrift. Den Anhängern der Vollwertkost, zu der Vollkornbrot und Getreidefrischbrei gehören, müssen die Körner madig gemacht werden. Ich führe diese oftmals wissenschaftlich getarnten Aggressionen auf ein schlechtes Gewissen, zumindest auf Unsicherheit, zurück.
Politikern fällt nun ein, man solle die Namen jener Großhändler bekanntgeben, die verdorbenes oder nicht mehr haltbares Fleisch vertrieben haben. Da fragt sich mancher, weshalb man dies nicht jetzt schon darf. Wir sind also soweit, daß der Vorwurf der Geschäftsschädigung höher gewichtet wird als die Schädigung der Volksgesundheit. Ich vermute, die Nahrungsmittelindustrie hat die besseren Juristen. Ich habe jedoch die Hoffnung, wenn viele Menschen eine Anschauung teilen, können die Juristen nicht mehr viel ausrichten. Ich erinnere an die Zuckerindustrie, die Prozesse anstrengte, als einige wenige Ärzte und Zahnärzte öffentlich vor den Folgen des Zuckerkonsums warnten. Heute muß sie den Mund halten und versuchen, sich durch die Hintertür, durch Kaschierung des Fabrikzuckers, einzuschleichen.
Es ist ein schönes Gefühl im Alter, im Gegensatz zu zumindest gehaltsabhängigen jüngeren Kollegen unverblümt, wenn nicht frech werden zu dürfen.
Genau das, was ich vermeiden wollte, ist eingetreten: Ich war zu lang. Gewiß, wir haben, wie zu erwarten war, nicht pünktlich begonnen, dann kam noch die Moderation. Doch die Welt ist ungerecht, ich hätte um 9.45 Uhr fertig sein müssen. An der Zeitüberschreitung und am Abbruch ändert auch nichts, daß ich mehrfach, fast mit den selben Worten, zu hören bekam: „Ich hätte Ihnen zwei Stunden zuhören können!“ Das ging mir herunter wie Öl – aber da ich Öl nicht trinke, besser: es ging mir herunter wie ein Bordeaux, einer von Rothschild oder aus Margaux. Immerhin, die Frage „Ein Leben lang trainierbar?“ habe ich gleich zu Beginn beantwortet. Nicht auszudenken, wenn ich mir das für den Schluß aufgehoben hätte!
Am Schluß sollten Empfehlungen für den Wettkampfsport der Älteren kommen, denn der Workshop hieß „Sport für Ältere“. Doch da ich sie bei anderer Gelegenheit ausgesprochen und auch den Veranstaltern des GutsMuths-Rennsteiglaufs übermittelt habe, genügt es, sie hier einmal festzuhalten.
„Ich meine, daß das riesige Alterspotential trotz einer Veranstaltung wie dieser an der Basis noch nicht erkannt ist. Ich bedauere, daß es keine Läufe ausschließlich für Ältere mehr gibt. Zwar suchen wir Alten gerade in Volkssport-Veranstaltungen wie den City-Marathons die Begegnungen mit Jüngeren, und unser Erlebnis besteht ja gerade darin, auszubrechen aus der Isolierung von Altengruppen, Altennachmittagen und ,Leitstellen für Ältere’, aber spezifische Altenläufe hätten einen demonstrativen Wert. Die Leistungen von Alten bei Volksläufen gehen unter; von dem Siebzigjährigen, der seinen ersten Marathon lief, habe ich durch Zufall erfahren. Altenläufe könnten auch die Leistungen von weniger begnadeten Teilnehmern ins rechte Licht setzen und motivierend wirken. Ich möchte die Frauenläufe, deren Zahl zunimmt, als Modell heranziehen. Gegen Frauenläufe kann man sehr wohl einwenden, daß sie nicht nötig seien, weil Frauen bei jedem Volkslauf extra gewertet würden. Doch Frauen bilden in der Laufszene eine unterprivilegierte Gruppe, zum Beispiel dadurch, daß sie sich an dieselbe Schlußzeit halten müssen wie Männer, obwohl sie aus physiologischen Gründen mehr Zeit benötigen, oder psychologisch dadurch, daß sie noch immer eine Minderheit darstellen. Insbesondere alte Frauen sind benachteiligt, was sich ja auch in dem Fehlen von höheren Altersklassen ausdrückt. Dabei sprechen Wissenschaftler in Anbetracht demographischer Veränderungen, nämlich dreimal soviel 80- und über 80jährige Frauen wie Männer, bereits von einer ,Feminisierung des Alters’. Senioren-Meisterschaften sind kein Ersatz für Senioren-Laufveranstaltungen, weil sie eine starke Selektion voraussetzen. Andererseits sollten Senioren-Laufveranstaltungen auch nicht den Charakter der einstigen ,Opa-Läufe’ wie in Bad Brückenau, Bad Grönenbach oder Neuss annehmen, wo man halt einige Kilometer vor sich hingetrabt ist. Senioren-Laufveranstaltungen sollten Ansprüche erheben, nur eben bei einer großen Bandbreite, wobei ich das Mindestalter keinesfalls schon wie früher bei vierzig Jahren ansetzen würde. Während sich Deutsche und regionale Meisterschaften auf ein Alterspotential von nur etwa zwei Jahrzehnten erstrecken, was kein Mensch beklagt, würden Seniorenläufe mit einem unteren Limit von 60 Jahren nach oben offen sein müssen. Im optimalen Fall, der aber demographisch in Sichtweite ist, würde das Potential nicht weniger als drei Jahrzehnte umfassen. Davon, daß die Zahl der Läuferinnen und Läufer im Rentenalter gegenwärtig noch nicht ausreichend zu sein scheint, sollte man sich nicht abschrecken lassen. Im Hinblick auf die zu erwartende Altersstruktur muß der Sport bereits jetzt in Vorleistung treten, wenn er die Zielgruppe der künftigen Alten erreichen will. Er darf nicht, wie das in der Vergangenheit immer wieder geschehen ist, zum Beispiel dem DLV mit der Laufbewegung, der Entwicklung hinterherhinken.
Die Altersklasseneinteilung des DLV, nämlich von fünf Jahrgängen zu einer Klasse, ist gerade für das Alter sinnvoll, wo selbst innerhalb einer hohen Altersklasse ein Knick eintreten kann. Denn der physiologische Altersabbau wird so empfunden, als vollziehe er sich in Sprüngen. Aber gerade in den hohen Altersklassen wird nicht mehr differenziert. Das ist paradox, denn zwischen M oder W 30 und M oder W 35 ist kein Leistungsunterschied auszumachen, sehr wohl aber zwischen M oder W 70 und M oder W 75 und gar M oder W 80. In Lausanne, dem Sitz des Olympischen Komitees, ist beim Marathon schon bei fünfzig Schluß. Alles was älter ist, sieht sich in derselben Altersklasse. Beim Jungfrau-Marathon endet die oberste Altersklasse bei 65. Bei einem Lauf wie diesem mag das noch verständlich sein., aber auch bei zahlreichen weniger exponierten Volksläufen endet die Altersklasseneinteilung bei siebzig. Und gar achtzig? Das ist die Ausnahme. Die Bieler Lauftage sind eine. Aber man hat dort für den 100-km-Lauf das falsche Zeichen gesetzt, indem man die ursprüngliche Schlußzeit von 24 Stunden zweimal verkürzt und schließlich nach Protest wieder um eine Stunde verlängert hat. Doch Dr. Adolf Weidmann mit neunzig hätte auch jetzt keine Chance mehr. Zu hinterfragen sind die 12 Stunden des Supermarathons beim Gutsmuths-Rennsteiglauf. Mich stimmt noch immer traurig, daß der fast 80 Jahre alte Franz Weißenböck aus Niederösterreich mir sagte, dies sei seine letzte Teilnahme. Bei hochalpinen Läufen wie dem K 78 und K 42 des Swiss Alpine muß man berücksichtigen, daß immer auch ein Hubschrauber-Transport noch möglich sein muß. Beim Rennsteiglauf ist die Situation anders – auch bei anderen Ultraläufen wie dem Défi Val Travers in der französischen Schweiz oder dem Ultra des Wachau-Marathons in Österreich. Zwar ist man in Schmiedefeld großzügig und hat bisher noch keinen, der die 12 Stunden nicht einhielt, vom Zieleinlauf ausgesperrt, sofern er nur das Limit am Grenzadler einhielt, was für Achtzigjährige auch schon eine Herausforderung ist; doch es ist, wie ich weiß, kein angenehmes Gefühl unterwegs, auf das Entgegenkommen der Organisatoren angewiesen zu sein. Mit dem Beispiel des Rennsteiglaufs möchte ich zu verstehen geben, daß sich Veranstalter von Breitensportveranstaltungen mehr als bisher auf Hochaltrige einstellen sollten.“
Ich bin ein Mensch, der nichts umkommen lassen kann – nicht einmal einen Text wie diesen, wenn er nicht gesprochen worden ist.
Der Anlaß des Referates war der 5. Europäische Workshop zum Sport der Älteren, veranstaltet vom Landessportbund Thüringen. Dort scheint man in dieser Beziehung sehr viel weiter zu sein als in den meisten anderen Bundesländern. Vielleicht rührt das höhere Problembewußtsein daher, daß Thüringen wegen der Abwanderung Jüngerer auf dem Wege ist, ein Altenland zu werden? Vielleicht auch hängt es mit der Breitensportreferentin Kerstin Lang zusammen. Sie hat mir erzählt, daß sie, die frühere Leichtathletin, vorhabe, erstmals einen Marathon zu laufen. Besser hätte sie mich nicht bestechen können. Beim Erfahrungsaustausch erfuhr ich von dem Referenten des Fußball-Verbandes, man mache sich Gedanken, wie man die aktiven Fußballerinnen, wenn sie einmal nach meinen Worten „Alte Damen“ sein würden, an den Sport binden könne. Auch wenn noch kein Konzept vorliegt, – diese Weitsicht hat mir gut gefallen.
 |
 |
Überhaupt hat es mir an der Landessportschule in Bad Blankenburg gut gefallen. Die Sportanlagen harmonisch in die Landschaft gebettet, weitläufige Gebäude, aus der DDR-Zeit stammend und offenbar mit hohem Aufwand auf komfortablen Standard gebracht. Man könnte auch als Hotelgast hier wohnen, wenn man ein paar Schulregeln beachtet: Nicht rauchen und keine Party auf dem Zimmer! Schade, daß ich nichts in der Gegend zu tun habe – ich würde mich hier wohlfühlen. Bei welchem Hotel – mit derart moderaten Preisen – hätte man einen Springbrunnen vor dem Haus, könnte am Wasser essen, auf die Höhen blicken und von der Haustür weg über ein Wegesystem traben! Die weitläufige Anlage ist ein Vorzeigemodell.
Als ich am Wochenende meine Runde ging und lief, dröhnte Musik herüber. Erst vermutete ich die Quelle in einem der Aussiedlerhöfe, wo die Reiter vielleicht ein Fest feierten. Doch dann war mir klar: Im benachbarten Stadtteil findet am Abend ja wieder das Feuerwerk „Flammende Sterne“ statt, wo Pyrotechniker um die Gunst des Publikums wetteifern. Eine Wiese war als Behelfsparkplatz hergerichtet worden; ein Posten wies die Fahrzeuglenker ein. Doch ein Wagen bog nicht auf die Zufahrt zum Parkplatz ein, sondern entgegengesetzt auf den Weg, auf dem ich gerade war. Zwei Damen fragten mich um Rat. Sie hätten nun schon dreimal eine Runde gedreht, es sei alles abgesperrt. Wo man denn parken könne? Ich wies auf den grünen Parkplatz hin. Wie weit es denn bis zum Festgelände sei? Etwa einen Kilometer, sagte ich. Vielleicht habe ich übertrieben, und es waren von unserem Standpunkt aus nur 800 Meter. Ob man nicht auf diesem Sträßchen noch etwas näher heranfahren und parken könne? Ich zuckte die Achseln, dann fiel mir ein: der Mähdrescher, manchmal komme der Mähdrescher hier lang, und der beanspruche die volle Breite. In der Tat kam dann später zwar kein Mähdrescher, aber ein großer Traktor mit einem Anhänger voller Strohballen – ebenfalls in Überbreite. Die Damen wurden noch ratloser. Sie fingen an zu diskutieren, weshalb denn alles weiträumig abgesperrt sei? Weil es bei den ersten „Flammenden Sternen“ ein Verkehrs-Chaos gegeben habe. Da ich ihnen offenbar keinen Geheimtip geben konnte, fuhren sie auf dem Anlieger-Sträßchen weiter – wahrscheinlich machten sie die vierte Runde. Statt der vergeblichen Parkplatzsuche 12 bis 15 Minuten zu Fuß zu gehen, brachten sie offenbar nicht fertig. Die Appelle von Gesundheitsorganisationen, Krankenkassen und Medizinern, sich mehr zu bewegen – alles für die Katz’. Es wurmt mich, daß ich den beiden Damen soviel Aufmerksamkeit gewidmet habe.
Als ich mich unserer Wohnstraße näherte, sah ich, daß die Heißluftballons gestartet waren. Einer nach dem andern – etwa ein Dutzend – hatte sich in den Himmel erhoben. Es reichte mir noch, von unserem Badezimmer aus zu photographieren. Wie die Welt vom Ballonkorb aussieht, habe ich 1984 in der ersten deutschen Freiballonrepublik Reichshof dank dem dortigen Ballon-Sport-Club erfahren. Ich sollte auch mal wieder nach meinen Ländereien sehen, denn mir, dem Grafen Werner von und zu Reichshof, Luftritter über dem Aggerberg und Buchenkitzler von Hackenberg – so mein Titel –, gehören die Ländereien, die wir mit dem Ballon überfahren haben, allerdings nur bis ein Zentimeter über dem Boden. Heiße Luft also, wie so vieles.
 |
Der Blick in den ballonbestückten Himmel und das Geräusch der Gasbrenner erinnerte mich an Biel. Als wir dort eines Jahres auf der 100-km-Strecke aus dem Wald heraustraten – es muß vor Kirchberg gewesen sein –, trafen wir auf ein kleines Geschwader von Freiballons. Sie waren aber nicht unseretwegen unterwegs – anders als die Alphornbläser, die Franz einmal für uns aufspielen ließ. Gesehen habe ich sie nicht, aber nun kann ich mir vorstellen, daß man sich einst zwischen den Almen mit den Hörnern verständigt oder vielleicht auch nur unterhalten hat. |
Mein Vortragsmanuskript „Ein Leben lang trainierbar?“ für das kommende Wochenende habe ich fertig, jetzt muß ich es nur noch kürzen. Denn ich merke, wenn ich mich daran halten würde, müßte ich mehr als eine Dreiviertel Stunde beanspruchen. Das darf nicht passieren. Durch nichts macht sich ein Referent unbeliebter.
Über Nacht hingen die Bäume voller Äpfel. Unsinn, es ist mir nur jetzt aufgefallen. Fast täglich bin ich an den Bäumen vorbeigegangen, an dieser Steigung immer gegangen, nicht gelaufen. Und die heranreifenden Äpfel waren mir nicht aufgefallen. Was wir von der Frau Z. frisch aus dem großen Garten bekommen – das Ziel meiner ersten Gehstrecke nach der Rehabilitation –, bleibt mir dagegen nicht verborgen. Zucchini, Zwetschgen, Brombeeren – nicht drei Stück wie beim Dessert der Nouvelle cuisine, sofern sie noch so heißt –, sondern ein ganzes Schälchen voll. Die Pfirsiche sind noch hart und müssen nachreifen. Wie bin ich froh, daß wir Gemüse und Obst häufig direkt von Erzeugern bekommen, weil Marianne auf dem Wochenmarkt einkauft.
Mehrfach habe ich den Mähdrescher gesehen. In meiner Jugend wurde Getreide mit der Flügel-Mähmaschine gemäht, und eine Kolonne von Frauen mußte das gemähte Getreide zu Garben binden, die dann zu Puppen aufgestellt wurden. Großbauern, etwa von 50 Morgen an, legten sich damals einen Bindemäher zu; er wurde an die Zapfwelle des Traktors gekoppelt, so daß die Technik, das Messer, das Transportband, der Bindemechanismus, die Auswurfgabel, mit Motorkraft in Funktion gesetzt wurde. Die Räder hatten keine Antriebsfunktion mehr. Heute stehen die Bindemäher wahrscheinlich im Landwirtschaftsmuseum, neben den Flügelmähmaschinen, die einst die Sense des Schnitters automatisierten. Der Schnitter hätte kein Fitneß-Studio gebraucht, die Garbenbinderinnen und die Ährenleserinnen sehr wohl aber eine Rückenschule. Der Mähdrescher ist geliehen. Für den einzelnen Hof wäre es unrationell, derart teure Landmaschinen zu kaufen, die dann den größten Teil des Jahres herumstehen. Ich erinnere mich, daß in der DDR, während in der Bundesrepublik noch immer mit eigenen Maschinen gearbeitet wurde, bereits Maschinenausleihstationen eingerichtet worden waren. Nichts anderes besteht heute in der Bundesrepublik Deutschland, nur daß sie mit Privatkapital finanziert und von Unternehmern betrieben werden. Vielleicht vollzieht sich die Wiedervereinigung nach der einstigen Kongruenztheorie schleichend: die Maschinenausleihstation, der Kindergarten-Anspruch, die Ganztagsschule, die Poliklinik. Mit dem Dreschflegel ist die sozialistische Infrastruktur zerschlagen worden, eben weil sie sozialistisch war. Die Sportfreundin G., eine der wenigen Spezialistinnen in der DDR für ultralange Strecken, büßte ihren Arbeitsplatz in einer Station für ambulante Psychiatrie ein; sie eröffnete notgedrungen eine eigene Praxis. Vielleicht werden Historiker nach Jahrzehnten die Wahrheit über den großen Staatsmann Kohl, den Architekten der Wiedervereinigung, herausfinden; der Architekt hat zunächst einmal alles niedergerissen. Der Bauschutt verunstaltet noch immer die blühenden Landschaften.
Leben alte Leute wirklich in der Vergangenheit? Ich gestehe, es kommt mir bei solchen Eintragungen so vor. Dabei messe ich nur an der Vergangenheit die Gegenwart. Ich habe dafür wieder einen Anknüpfungspunkt, die Entsendung einer Schutztruppe in den Libanon. Als wir 1945 in Güterwaggons, belegt mit je 50 Gefangenen, nach Osten rollten – mit Auschwitz als Zwischenstation, die es für mich glücklicherweise nicht war – , gab es wahrscheinlich keinen von uns, der nicht Pazifist geworden war. Und wir hätten uns nicht vorstellen können, daß innerhalb weniger Jahre Deutsche wieder in Uniformen stecken würden. Selbst wer damals resignierend sagte „Kriege wird es immer geben“, wofür er streng getadelt wurde, war der Meinung, zu seinen Lebzeiten mindestens würde Deutschland in keinen Krieg mehr verwickelt werden, das sei das einzig Gute an der Situation. Ich erinnere mich an abenteuerliche Phantasien – sie kamen aber erst nach den Phantasien über das Essen, über Kochrezepte und was man als erstes nach der baldigen Entlassung essen werde. Eine Vorstellung war: Künftige Konflikte sollten in einem Sportstadion unter den Staatslenkern ausgetragen werden – nur diesen, jeweils mit einem Knüppel in der Hand. Um die sei es nicht schade, aber wir, das Kanonenfutter, würden künftig überleben. Wir waren naiv, aber das waren wir schon vorher gewesen. Manche, wie ich, sind es geblieben. Daher bin ich noch immer Pazifist. Vielleicht auch nur, wie auf manchem Gebiet, der Zeit ein wenig voraus – sagen wir: in diesem Fall vielleicht ein paar hundert Jahre. Das ist meine Hoffnung, andernfalls könnte es eines Tages diese zerstörerische Säugetier-Gattung nicht mehr geben. Als ich meine erste Lokalredakteur-Stelle in Schwäbisch Gmünd hatte – das war 1953/54 – , warb auch die SPD für die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland. Obwohl es für einen Journalisten sowohl ungehörig als auch inopportun ist, in einer Parteiversammlung Stellung zu beziehen – ein Verstoß gegen den journalistischen Komment sowieso –, warnte ich davor, dem Adenauer-Kurs zu folgen. Natürlich haben die Genossen nicht auf mich gehört, einen lausigen DDR-Flüchtling von 27 Jahren. Ich ahnte damals schon, daß der Preis hoch sein würde, zu hoch. Weshalb soll man als Siegermacht ein Land, das man gerade erst mit ungeheuren Blutopfern unschädlich gemacht hat, wiederbewaffnen? Doch nur, weil man sich Vorteile davon verspricht. Germans to the front. Das war mir damals klar, heute sehe ich mich darin bestätigt. Die Bundeswehr, konzipiert als Landesverteidigung, ist nichts anderes mehr als eine Söldnertruppe. Wir haben keine Feinde mehr, gegen die wir uns verteidigen müßten, sondern nur Freunde, die den Zoll für die Freundschaft einfordern. Selbst Putin ist regierungsamtlich „mein Freund Putin“. Müssen wir dann gleich Afghanistan retten, das uns nichts anging, weil zwei Weltmächte Fehler gemacht haben? Auf dem Balkan, wo man mir zur Begrüßung ein Hakenkreuz in meinen ersten Volkswagen Export 1960 ritzte, sind wir militärisch präsent, wiewohl wir außer touristischen keine anderen Interessen dort haben. Im Kongo müssen wir unvernünftige Neger trennen – wieso ist diese Bezeichnung, verdeutscht Schwarze, rassistisch? Ich provoziere, vielleicht darf ich das, meine Mutter war eine geborene Deutsch, und wie mir ein israelischer Sportfreund bestätigte, muß es in der Familiengeschichte ganz sicher irgendwann eine jüdische Herkunft gegeben haben. Da sich manche jetzt philosemitisch brüsten, versichere ich auch, daß ich außer einmal in der Volksschule durch einen oberschlesischen Vertretungslehrer keine Probleme damit gehabt habe. Nun also engagieren wir uns auch im Nahen Osten. Wir sind nicht gerufen worden, wir haben es nur angenommen, und selbstverständlich erklärt Frau Merkel vermutlich nach Konsultation von Herrn Schäuble, der deutsche Soldaten in den Irak schicken wollte, was der hiesige Gasleitungsexperte glücklicherweise verhinderte, ihre und ihrer Parteifreunde Willfährigkeit, den einstigen Siegermächten wieder einmal gefällig zu sein.
Das war unter Adenauer schon so angelegt: Germans to the front. Die wenigsten merken es. Doch viele ahnen es. Nach einer Umfrage sind die meisten Deutschen gegen die Entsendung deutscher Soldaten in den Libanon. In den wichtigsten Lebensfragen, ob Wiederbewaffnung oder Euro-Einführung, wird die deutsche Bevölkerung jedoch nicht gefragt.
Cogito ergo sum (Ich denke, also bin ich)? Ich laufe, also denke ich.
Seit Tagen bin ich verkehrt angezogen, zweimal bin ich daher naß geworden, heute trug ich den Regenanzug – also hörte es sofort auf zu regnen. Am Samstag konnte ich mich während eines heftigen Schauers unterstellen. Ein Hausbesitzer hatte von seinem Garten einen Unterstand, fast von der Größe eines Wartehäuschens, für sein Motorrad abgezwackt; der zum Gehweg hin offene Verschlag lud geradezu ein, sich dort unterzustellen. Hoffentlich nimmt das nicht überhand, und der Besitzer müßte den Hausfriedensbruch-Paragraphen bemühen. Unversehens kam die Sonne wieder hervor, und ein schöner Regenbogen zeichnete sich ab. Die beiden Pferde auf der Weide hatten unter dichten Bäumen Schutz gesucht; sie hatten offenbar noch gar nicht bemerkt, daß es nicht mehr regnete. Als ich vorbei kam, standen sie noch immer da. Heute trotteten sie neugierig an den Zaun. Sie suchten den Kontakt; doch als ich einem Pferd über das Fell streichen wollte, wandte es sich ab, nur ein klein wenig. Es blieb ruhig stehen, wich aber der Berührung aus. Es suchte die Nähe, aber keine Vertraulichkeit bitte!
Da ich mich nicht um das Fernsehprogramm kümmere, habe ich die Marathonläufe in Göteborg verpaßt. Ich hätte Ulrike Maisch gern laufen gesehen. Ich freue mich sehr, daß sie mit einer Goldmedaille heimgekehrt ist. Überhaupt die deutschen Frauen im Marathon... sie scheinen dabei eine ähnliche Rolle zu spielen wie eine Zeitlang die deutschen Frauen im Fußball. Vier deutsche Läuferinnen starteten in Göteborg, unter den Männern kein einziger Deutscher. „Dabeisein ist alles“ gilt für den Hochleistungssport nicht. Wäre es nicht besser, sich von den strengen Qualifikationsnormen zu entfernen, wenn man schon keine Wahl hat? Die deutschen Marathonläufer hätten zumindest im hinteren Feld mithalten können. Der letzte lief nach 3:04:38 ins Ziel, er hätte sich von einem Schwarm ambitionierter Volksläufer begleiten lassen können. Er und der vorletzte kamen aus MKD – meine Bildungslücken werden zum Abgrund, ich weiß nicht, was sich hinter MKD verbirgt, vielleicht etwas Exotisches wie Mittelkurdistan? Wer kann schon mit den Staatengründungen oder -umbenennungen mithalten? Das Internet, auch die DLV-Seite, blieb mir die Antwort auf meine Suche schuldig.
Mir ging auf meiner Lauf/Gehstrecke das Bekenntnis von Günter Grass im Kopf herum, er habe der Waffen-SS angehört. Dazu, daß er dies bis jetzt verschwiegen hat, kann man stehen, wie man will. Möglicherweise haben die meisten Menschen eine Leiche im Keller, und viele nehmen ihr Geheimnis mit ins Grab. Bei Thomas Mann rätseln die Biographen: War er nun homophil oder nicht? Er hat sich in seinen Tagebüchern über Läppisches geäußert, aber nicht über sexuelle Orientierungen. Günter Grass hat sich, wenn auch sehr spät, zur Eindeutigkeit bekannt. Sie stünde ihm besser zu Gesicht, wenn er sich nicht bei jeder Gelegenheit als Gewissen der Nation profiliert hätte. Mich empört jedoch etwas anderes. Im ZDF kam flugs ein Redakteur zu Wort, der erklärte, man müsse bei der Waffen-SS differenzieren; viele hätten in ihr nur die Eliteeinheit gesehen, die an Brennpunkten eingesetzt worden sei. Ach nee... Welcher Skandal war es in den Augen der Medien, als Helmut Kohl einen Staatsgast aus Frankreich auf einen Soldatenfriedhof führte, in dem auch zahlreiche Angehörige der Waffen-SS beigesetzt sind! Die Zugehörigkeit zur Waffen-SS wurde des langen und breiten als Argument gegen Franz Schönhuber, den Gründer der Partei Die Republikaner, verwendet. Da wurde gar nicht erst nach persönlicher Schuld gefragt, sondern „Waffen-SS“ als Knüppel gebraucht. In einer Veröffentlichung habe ich gar gelesen, Schönhuber sei SS-Mann gewesen. Dem Verfasser ist offenbar der Unterschied zwischen der ideologisch zementierten Organisation SS und der Waffen-SS nicht klar gewesen. Das muß man nicht, aber dann sollte man sich wegen Ahnungslosigkeit nicht äußern. Niemals zuvor ist angemahnt worden, man müsse bei der Waffen-SS differenzieren. Aber jetzt, da sich herausstellt, daß eine deutsche Identifikationsfigur, ein Nobelpreisträger gar, Dreck am Stecken hat, versucht ein Journalist in einer öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt, der Waffen-SS Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, um die „Jugendverfehlung“ des Günter Grass zu entschuldigen. Dieser Opportunismus widert mich an. Merkt das denn keiner?
Ich habe keinen Anlaß, die SS in Schutz zu nehmen. Die meisten von uns waren erst 16 Jahre alt, als wir zur Musterung mußten. Ich erinnere mich noch an diesen Tag im Görlitzer Konzerthaus bei der Lutherkirche. Bei der Musterung war eine Werbekommission der SS zugegen. Offenbar war der Bedarf so groß, daß die frühere Mindestgröße für die Zugehörigkeit der Waffen-SS fallengelassen worden war. Mit meinen 1,65 Metern gehörte ich also auch zu den Opfern der Erpressung durch die SS. Wir sollten uns freiwillig zur SS melden. Die Zeit verging, niemand hatte sich gemeldet – so ideologisiert war also offenbar der größte Teil der deutschen Jugend auch nicht. Ein SS-Offizier schrie uns an: Hier komme keiner raus, wenn sich nicht soundsoviele zur Waffen-SS gemeldet hätten! So also konnte die Zugehörigkeit zur Waffen-SS auch zustande kommen. Wer sich damals bei solchen Gelegenheiten erpressen ließ, wurde dann später von Leuten, die keine Ahnung vom Leben in einer Diktatur haben, geächtet. Ich meine, wir befanden uns damals etwa zwei Stunden in Gewahrsam, so lange wurde tatsächlich keiner aus dem Musterungslokal gelassen. Ob sich überhaupt jemand „freiwillig“ gemeldet hatte, ist mir nicht mehr erinnerlich. Jedenfalls ging die Werbeaktion ins Leere, wir durften schließlich das Konzerthaus verlassen. In den Krieg nahm ich die Lehre mit, sich nicht ins Bockshorn jagen zu lassen.
Als Soldat war ich über die SS zornig, gerade weil sie eine Eliteeinheit war und die Realität nicht wahrnehmen wollte. Wenn sich in unserer Nähe eine Waffen-SS-Einheit verteidigte, gerieten auch wir in Gefahr. Angehörige der Waffen-SS schossen auch noch, als bereits der Waffenstillstand herrschte. Schließlich wäre ich selbst noch mit einem Waffen-SS-Angehörigen verwechselt worden. Infolge zweier Beindurchschüsse war meine Uniformhose zerfetzt; als Ersatz bekam ich einen Tarnanzug der SS. Anderes stand nicht mehr zur Verfügung. Es hätte übel ausgehen können. Die Sowjets schätzten keine langen Erklärungen.
Ich habe Verständnis dafür, daß Günter Grass die Uniform der Waffen-SS trug. Doch dann hätte er in moralischen Fragen den Mund halten sollen. Leider ist er nicht der einzige, der nach dem Krieg seine Vergangenheit vergessen hat.
Wieder auf der Hausrunde. Wieder ein Stück länger gelaufen, auf der Ebene etwa 300 Meter im Stück. Beim Überqueren der Straßen sehe ich noch immer Autos mit Fähnchen. Wahrscheinlich mögen die Fahrer nicht zur Kenntnis nehmen, daß die Party der Fußball-Weltmeisterschaft aus ist. Das Zeichen der nationalen Identifikation scheint zur Mode zu werden. Doch die Schweizer sind schon immer mit ihrem weißen Kreuz auf rotem Grund verschwenderisch umgegangen. Wo die Schweizer Flagge ohne Anlaß weht, kann man sicher sein, auf eine Gastwirtschaft zu treffen. In der Schweiz einzukehren, liegt gewissermaßen in nationalem Interesse.
Den Mähdrescher umgangen, der die ganze Straßenbreite ausgefüllt hat. Im letzten Teil mehr Läufern begegnet als anderen Passanten. Alle drei Läufer einer Gruppe sagten freundlich "Hallo" und drehten sich nach mir um. Danach fiel mir ein, weshalb. Ich trug das Hemd vom Rennsteiglauf des vorigen Jahres, auf dem Rücken steht ganz groß "Finisher". Da will man doch wissen, wer das ist. Und mir wurde das Gefühl vermittelt, akzeptiert zu werden, obwohl ich nicht lief, sondern im Schritt ging. Wer 72 Kilometer im Thüringer Wald zurückgelegt hat, darf ohne Scham im Schritt gehen.
Durchwachsenes Wetter. Gestern den Regenanzug angezogen und dann doch die Runde
abgebrochen. Im Alter wird man empfindlich. Wahrscheinlich ist man aber auch
bloß zu langsam und spürt erschauernd, wie der dünne Stoff der
Hose gegen die Beine klatscht.
Vorige Woche lief/ging ich am Grundstück des Naturschutzbundes vorbei.
Eine Tafel wies auf ein Nabu-Fest am Sonntag hin. Auf der Tafel wurden in Kreideschrift
unter anderem "Steaks" angeboten. Kommen die nicht zum großen
Teil aus Südamerika? Wird dort nicht der Regenwald abgeholzt, weil man
noch mehr Weideflächen für noch mehr Rinder braucht? Wie glaubwürdig
ist eine Organisation, die sich dem Schutz der Natur widmet? Und wenn die Steak-Lieferanten
aus der Region und vielleicht gar noch von Öko-Betrieben kommen sollten,
warum schreibt man es nicht hin? Abgesehen davon, daß die Erde ohnehin
von zuviel Schlachttieren bevölkert wird. Gedankenlos. Naturschutz läßt
sich am besten dann treiben, wenn die eigenen Interessen nicht berührt
werden.
Den Zug in die Höhe hatte ich zwar schon immer, aber die Neuerung in Davos hat ihn gleich zum Auftakt meines Swiss-Alpine-Aufenthaltes befördert. Erstmals in Davos ist für Inhaber der Gästekarte „Davos inclusive“ nicht nur die Benützung der Stadtautobusse, sondern im Sommer auch der Bergbahnen frei. Also zog es mich am ersten Tag nach der Ankunft aufs 2590 m hohe Jakobshorn. Fürs Eingewöhnen und als unbeschwertes Erlebnis nahm ich mir die Wanderung hinab zum 1861 m hoch gelegenen Sertig-Dörfli vor. Auch Familien mit kleinen Kindern unternehmen diese Wanderung über den ungefährlichen Weg. Schon überlegte ich mir, ob ich nicht am Nachmittag die drei Stunden über Clavadel nach Davos zurück wandern solle. Der Weg war schließlich nur das Endstück des Swiss Alpine, als er noch über den Sertigpaß führte.
 |
Doch nach zwei Stunden Bergabwärts-Wanderns verspürte ich plötzlich das Bedürfnis nach einer Rast; auf den nächstbesten Stein sank ich nieder. Ich sollte ein paar Schluck Wasser nehmen, und die Banane war auch noch da. Das Gefühl kam auf, es gehe mir wie einem Lauf-Anfänger in einer stärkeren Gruppe, der dann, um eine Atempause zu haben, die Schnürsenkel neu binden muß. Die dringende Rast zum Trinken ging zuende, ich brach auf und nach zehn Metern zusammen. Ich redete mir ein, ich sei bei einem etwas schiefen Auftritt ausgerutscht; man konnte es als Erklärung dafür, daß ich im Gras lag, gelten lassen. |
|
Davos 2006: Herzlichen Glückwunsch, Werner! |
Wenig später wollte ich auf dem schmalen Weg eine schnellere Wandergruppe vorbei lassen. Ich merkte, wie mir beim Stehen die Knie zitterten. Ich machte einen Schritt zur Seite, und schon lag ich wieder. Eine Wanderin machte ein besorgtes Gesicht; ich log, ich sei ausgerutscht. Tatsache war, daß ich mich im Sinne des Wortes nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Kein Schwindel, keine Kreislaufschwäche; es waren eindeutig die Beinmuskeln, die sich in sieben Wochen Krankenhaus zurückgebildet hatten. Seit Wochen habe ich zwar fast täglich trainiert, aber eben nur auf der Ebene und auf Steigungen. Gefälle und gar ein solches, bei dem man häufig von Stein zu Stein den Auftritt suchen muß, kam nicht vor. Nun, am ersten Tag im Hochgebirge, war ich auf eine empfindliche Einbuße gestoßen, die sich auf geradezu groteske Weise äußerte. Zweimal noch kippte ich um, glücklicherweise ohne Zeugen, es war jeweils, als habe mir jemand die Beine weggezogen. Dann erreichte ich das Asphaltsträßchen im Sertigtal. Als ich auf den Autobus wartete – denn von einer Wanderung nach Davos konnte nicht mehr die Rede sein –, lehnte ich mich gegen eine Wand. Nur auf diese Weise konnte ich Haltung bewahren, ohne daß jemand auf den Gedanken kam, die Bergwacht zu verständigen. Als ich am Bahnhof in Davos-Platz aus dem Autobus stieg, knickte ich wieder zusammen, konnte mich aber fangen. Die Szene erinnerte mich an ein Kriegserlebnis. Mit zwei Beindurchschüssen war ich auf einem Pferdewagen zur Krankensammelstelle transportiert worden. Als ich vom Wagen stieg, sackte ich unwillkürlich zusammen, wurde jedoch von meinen beiden Begleitern aufgefangen. Völlig unvorbereitet war ich, daß dieser Effekt auch durch wochenlangen Nichtgebrauch von Muskeln auftreten kann. Das Treppentraining im Krankenhaus hatte zur Kompensation der Muskelschwäche nicht ausgereicht. Ich finde dieses Phänomen so sonderbar, daß ich es aufschreiben muß. Vielleicht liest es ein Mediziner und bereitet bettlägerige Patienten, die sich erstmals wieder stärker belasten, darauf vor.
Am Tag nach meinen Zusammenbrüchen habe ich einen Muskelkater in den Oberschenkeln gehabt. Vorsichtshalber habe ich meine weiteren Wanderungen in Davos mit den Teleskopstöcken unternommen.
| Ein einzigartiges Experiment liegt hinter mir, der Halbmarathon des Swiss Alpine. Nie hätte ich gedacht, daß ein Halbmarathon eine solche Bedeutung für mich gewinnen könnte. Für einen Halbmarathon habe ich mich in den letzten Jahren nicht ins Auto gesetzt. Das Experiment: Die letzte lange Strecke bin ich Mitte Januar bei dem verunglückten Vollmondmarathon gelaufen, wo ich es auf wahrscheinlich 32 Kilometer gebracht habe. |
 |
Vom 5. Februar an folgten 7 Wochen Bettlägerigkeit und 3 Wochen Kur, Langsames Erreichen von 11 Kilometer Gehstrecke, Laufversuche von zuletzt über etwa 100 Meter. Dr. K. hatte mir im März schon, als ich noch tief am Boden war, prognostiziert, am 29. Juli würde ich den Halbmarathon in Davos walken können. Ich wollte ihn nicht enttäuschen, außerdem hatte ich das Hotel schon gebucht und freute mich, Sportfreunden wieder zu begegnen. Dr. K. riet mir aber auch, zum Lauf zu melden und nicht zum Nordic walking. Das Gestakse mit den Stöcken würde mich nervös machen; die Logik sagte mir auch, daß das Hauptfeld des Feldes dichter sein würde als beim Lauf. Sicher aus organisatorischen Gründen hat man beim Lauf anderthalb Stunden mehr Zeit als beim Walking. Die Strecke kam meiner Situation entgegen – vom Start weg Gefälle in die Zügenschlucht. Daher konnte ich ohne Krafteinsatz erstmals einige Kilometer laufen, nur von wenigen Gehpassagen unterbrochen. Psychologisch ist dies von großer Bedeutung für mich gewesen. Was spielt dagegen das größere orthopädische Risiko für eine Rolle! Nach einem halben Jahr das Gefühl: Ich kann ja wieder laufen. Eine Barriere ist gefallen. Der Aufstieg nach Monstein freilich, der weit beschwerlicher ist als bei der früheren Streckenführung vom K 78, fiel mir schwer, anderen aber auch. Wir am Schluß unterschieden uns nur durch einen anderen Rhythmus – ich überholte und wurde überholt. Auf weiteren Gefällstrecken lief ich, probierte es auch auf ebenen Strecken, bis ich schließlich auch auf Gefälle in den Gehschritt fiel. Ich hatte das Ende meiner gegenwärtigen Leistungsfähigkeit erreicht. Nach dem Junkerboden wurde ich von den wenigen hinter mir nur noch überholt. Ich blickte auf die Uhr, es könnte unter vier Stunden reichen. Ich hatte mich an der Einlaufzeit des Letzten im vorigen Jahr, beim ersten Halbmarathon, orientiert, er kam in 4:12:01 ins Ziel. Man würde dies einem Achtzigjährigen ein knappes halbes Jahr nach einer Herzoperation auch zugestehen können. Insgeheim motivierte mich aber die Zeit der Vorletzten, 3:44:56. Die Strecke, gewiß der schönste Halbmarathon, an dem ich teilgenommen habe, mündet vor der Bahnüberführung in die Strecke des K 78 und des K 42. Und da war es mir denn doch etwas peinlich, daß ich, obwohl ich ging, denselben Applaus abbekam, wie diejenigen, die 78 oder 42 Bergkilometer bewältigt hatten. Vom Eingang des Stadions bis zum Ziel wollte ich laufen, ich schaffte das einfach nicht mehr. Mit 3:49:18 Stunden bin ich zwar der Letzte gewesen, aber ich bin zufrieden.
Ich sei in gutem Zustand angekommen, sagte mir später Dr. K., der meinen Zieldurchgang beobachtet hatte. Herz und Kreislauf sind völlig in Ordnung gewesen; es war allein die Muskelschwäche, die mich zum Gehen gezwungen hat. Da müßte sich mit weiterem Training einiges verbessern lassen. (Laufgruppenfoto: Werner Sonntag)
In der Hitze ist meine Laufstrecke so leer, als würde gerade Fußball gespielt. Mir ist es recht gewesen.
Nun bin ich in den Turnverein wieder eingetreten, den ich 1979 eher resigniert denn erbost verlassen hatte. Der Wiedereintritt mußte deshalb sein, weil ich anders nicht bei der Herzsportgruppe hätte mitmachen dürfen. Mein Kardiologe hat sie mir empfohlen und auch schon den ärztlichen Betreuer der Gruppe verständigt. Ich sagte mir: Schaden kann es nicht, und vielleicht kann der Arzt in der Gruppe den Trainingseffekt des Walkings optimieren. Zweimal habe ich bisher mitgemacht und beim zweitenmal – auch wieder auf Anraten – mich an einer Gymnastikstunde beteiligt. Ich habe ja wirklich Probleme mit dem Koordinationsvermögen und, wie sich herausgestellt hat, auch mit der Flexibilität.
Zwei Überraschungen: Beim erstenmal begegnete ich der Ärztin, zu der wir privaten Kontakt – insbesondere im Hinblick auf Literatur und Bildende Kunst – unterhalten. Auch ihr hatte der Kardiologe, wenngleich sie nicht operiert worden war, den Herzsport empfohlen. Beim zweiten Treffen begegnete ich der Seniorwirtin des Restaurants, in dem wir gelegentlich gepflegt essen. Immer hatte sie uns, wenn wir erschienen, begrüßt. Als wir neulich nach einem knappen halben Jahr wieder da waren – richtig, ich hatte Geburtstag –, vermißten wir sie. Sie dagegen hatte gar keine Gelegenheit, uns zu vermissen. Bei unserem Gespräch im Wald stellte sich heraus, daß sie etwa zur selben Zeit im Krankenhaus war wie ich. Auch ihr hatte der Kardiologe die Herzsportgruppe anempfohlen. Der Gruppe gehören inzwischen etwa 200 Rekonvaleszenten oder Rehabilitanten an, die in acht unterschiedlichen Gruppen Nordic Walking oder Gymnastik betreiben.
Wie das Leben so spielt: Es muß im Jahr 1972 gewesen sein, jedenfalls als ich zum erstenmal die Hauptversammlung des Turnvereins besuchte, da regte ich in der Versammlung an, Coronarsport anzubieten. Der Hintergrund war, ich hatte von Dr. Hartmann in Schorndorf gehört, der dort Herzpatienten trainierte, und ich hatte Professor Halhuber am Starnberger See interviewt; seine Frau war wenig später dabei, ein Netzwerk von Coronargruppen in der Bundesrepublik aufzubauen. Als in der Jahresversammlung meines Vereins – ich habe das später in „Spiridon“ glossiert – sich unter dem Tagesordnungspunkt Diskussion niemand zu Wort meldete, wunderte ich mich sehr. Das könne doch nicht sein, dachte ich mir, daß in einer Zeit der Veränderungen in einem mitgliederstarken Verein niemand etwas zu sagen habe. Ich improvisierte einen Diskussionsbeitrag, in dem ich als neuartige Aufgaben der Sportvereine die Integration von Ausländern – das waren damals Italiener – und eben den Herzsport nannte. Ich hatte mir darüber eine lebhafte Diskussion vorgestellt. Doch alle schwiegen, auch am Vorstandstisch. Als ich die Sprachlosigkeit des Vereins in „Spiridon“ beklagte, erfuhr ich durch einen (nicht veröffentlichten) Leserbrief den Grund – es war alles noch schlimmer, als ich gedacht hatte: Vereinsfunktionäre sahen in meinem Diskussionsbeitrag ein Indiz für angebliche Profilierungssucht. Offenbar typischer Fall einer Projektion. Ich hätte, erfuhr ich aus jener Zuschrift, die „zuständigen Gremien“ damit befassen sollen. Weshalb? Das erkannte ich später: Damit sich andere mit der Idee schmücken konnten. Denn Jahre später wurde eine Coronargruppe gegründet; ganz am Rande erfuhr ich davon. Als sie das 25jährige Bestehen feierte, erinnerte sich niemand mehr an meine Anregung. Ich reklamierte das zwar nicht, aber mich interessierte das Protokoll jener Hauptversammlung. Der jetzige Vorsitzende teilte mir auf meine Anfrage, die Bitte um Einsichtsgewährung in das damalige Protokoll, in einem freundlichen Brief mit, man habe leider nichts Einschlägiges gefunden. Gewundert hat mich auch das nicht.
In diesem Verein also mache ich ziemlich incognito – denn mein Marathon-Profil hat mich aus den Akten begleitet – einmal in der Woche Herzsport, und nur heimlich amüsiert es mich, daß dies in einer Gruppe geschieht, die ich vor wahrscheinlich 34 Jahren angeregt habe, um mich angeblich zu profilieren. In anderen Vereinen ist mir das besser gelungen; doch da war ich vorsichtshalber schon bei der Gründung dabei. Zuständige Gremien für die entsprechenden Vereinsziele gab es noch nicht.
Mein Kardiologe ist, wie er mir sagte, mit mir zufrieden. Zwei Medikamente abgesetzt, ich fühle mich befreit. Habe ich doch die „iatrogenen Wirkungen“, die Nebenwirkungen des Beipackzettels, an mir gespürt. Andere sterben an den Nebenwirkungen, wie ich gelesen habe. Bilde ich es mir nur ein? Meine Laufversuche auf der Gehstrecke fallen mir leichter, ich kann die Abschnitte verlängern.
Ich verabschiede mich vom Tagebuch nach Davos. Was ich dort machen werde, weiß ich noch nicht. Ich bin selbst sehr gespannt.
Zur Haustür unseres Reihenhauses führen vier Stufen empor. Nach Entlassung aus dem Krankenhaus zog ich mich die Stufen am Geländer empor. Bis zum Donnerstag, 13. Juli, stieg ich inzwischen die Stufen ganz normal hinauf; man konnte mir nichts mehr anmerken. Bis vor der Operation hatte ich die Stufen als Dehn-, Flexibilitäts- und Koordinationsübung benützt; ich nahm je zwei Stufen auf einmal. Am Freitag versuchte ich es wieder, ein bißchen unsicher noch. Seit gestern bin ich mir wieder sicher; ich schaffe wieder die zwei Stufen in einem Schritt, ohne mich festzuhalten. Nichts hängt von dieser Lächerlichkeit ab, aber ich freue mich sehr.
Ursprünglich hatte mir Marianne einen Pulsmesser zum Geburtstag schenken wollen. Doch ich wurde in den erlesenen Kreis von Teilnehmern eines Idiotentests aufgenommen, von Leuten also, die noch keine Erfahrung mit Pulsmessern haben. Eine Erfahrung allerdings habe ich vor über zwanzig Jahren gemacht. Doch als ich bei Wärme damit lief, rutschte der Brustgurt über die schweißbedeckte Haut. Ich konnte mich nicht mehr entschließen, mit Pulsmesser zu laufen. Nun wollte ich es wieder probieren. In zwanzig Jahren kann sich Technik erheblich verändern. Und wie! Der Pulsmesser ist zum Laufcomputer geworden. Mein Testgerät hat 99 Funktionen. Nur einen kleinen Teil der Liste habe ich verstanden. Begriffe wie ZonePointer, RLX-Wert oder alternierende Countdown-Timer bleiben mir verschlossen. Computer-Englisch kommt in meinem Wörterbuch von 1977 noch nicht vor. Timer wird mit Zeitmesser, Stoppuhr oder Zeitnehmer übersetzt. Ein Zeitnehmer – das weiß ich genau – stand nicht dabei. Ich erinnere mich, daß ich an meinem Videogerät auf einen Timer gestoßen bin. Doch bin ich auch nur vorübergehend und eher zufällig in der Lage gewesen, einen Fernsehfilm auf Videoband aufzunehmen. Da Videokassetten als veraltet gelten, habe ich glatt eine technologische Phase völlig übersprungen; so erledigt sich manches von selbst. Als ich ein neues Auto bekommen hatte, in dem es keine normale Uhr mehr gab, nahte die Zeitumstellung. Dazu fuhr ich in die Werkstatt. Die freundliche Dame am Informationsschalter erklärte mir, ich sei nicht der einzige, der mit dem neuen Modell wegen der Uhrumstellung in die Werkstatt gekommen sei. Der Kraftfahrzeug-Mechatroniker nahm sich die Zeit, mich einzuweisen. Seither weiß ich, wie man es macht. Ohne Hilfe wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf meinen jetzigen Computer-Wissensstand gelangt, der mir außer Textverarbeitung immerhin Bankvorgänge, e-mails und Bildbearbeitung ermöglicht.
Da ich seit Jahren eine Läuferuhr trage, stellte ich mir vor, daß es kein Kunststück sei, mit den vier Knöpfen eines Laufcomputers zurechtzukommen. ...ist es aber. Mehrere Abende befaßte ich mich mit der Gebrauchsanweisung, einem kleinen Handbuch von 58 Seiten. Zu meiner Digitalkamera ist erst gar kein Handbuch mitgeliefert worden, das mußte man sich aus dem Internet herunterladen. Das tat ich zwar, aber ich habe in den Ausdruck nie mehr hineingeschaut. Mit Learning by Doing war es angenehmer. Dieses Prinzip läßt mich jedoch bei dem Laufcomputer im Stich. Einmal habe ich es geschafft und frei nach My Fair Lady jubelte ich: „Mein Gott, jetzt hat er’s.“ Ich legte den Brustgurt an und tatsächlich zeigte der Computer meinen Herzschlag an. Die Zahl war allerdings extrem niedrig, ich hätte längst tot sein müssen. Doch dann – Learning by Doing – erkannte ich, daß dies nur die Prozentzahl der maximalen Herzfrequenz war, einer fiktiven, denn ich hatte keine eingestellt. Durch einen Knopfdruck unten rechts konnte ich umschalten. Die 47 Schläge in der Minute stimmten genau, Marianne hat am anderen Handgelenk nachgezählt. Arzthelferinnen machen bei einer solchen Pulszahl stets ein besorgtes Gesicht. Damit sie den Doktor nicht zur Medikation veranlassen, erkläre ich dann, daß Läufer immer einen niedrigen Ruhepuls hätten. Ich hoffe, es stimmt.
An der Pulsuhr konnte ich unterwegs genau ablesen, wie sich Anstrengungen auswirken: Bei Brückenrampen – ich habe zwei zu überqueren – geht der Puls nach oben. Es freut einen denn auch, wenn man seine frühere Erkenntnis objektiv bestätigt findet. Nur eines irritierte mich: Ich hätte unterwegs gern die Uhrzeit gewußt, doch die war weg. Stattdessen wurden die Runden gezählt. Da ich jeweils nur eine Runde zu etwas über zwei Stunden zurücklege, brauche ich keine Lap-Anzeige. Lap – soviel Wissen brachte ich immerhin schon mit – bedeutet Runde. Woher denn auch die Übersetzung von Laptop korrekt Rundenspitze lautet; mit muttersprachlichen Bezeichnungen kann man doch viel mehr anfangen. Die Computersprache ist – wie man weiß – eine indische Geheimsprache, wahrscheinlich aus dem Sanskrit entwickelt.
Seit diesem ersten Meßversuch bemühe ich mich, die Uhrzeit wiederherzustellen. Der offenbar wichtigste Rat des Handbuches ist: Wenn man alle vier Knöpfe gleichzeitig drückt, erfolgt die Rückstellung. Zuvor freilich kommt ein gelinder Schock: Sämtliche Elektronik-Anzeigen sind durch schwarze Rechtecke blockiert. Unsereiner erschrickt: O weh, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Doch auch hier regelt sich alles von selbst, nach einer Weile stellt sich der Urzustand – korrekt: Ur-Uhrzustand – wieder ein. Freilich, jetzt muß man seine persönlichen Daten noch einmal eingeben; wer beim mehrfachen Umgang damit Körpergröße, Gewicht und Geburtstag nicht auswendig gelernt hat, sollte vielleicht ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Das werde ich wohl auch tun. Ich solle beim nächstenmal – das ist eine andere Geschichte – den Pulsmesser mitbringen, sagte er, der laufende Arzt. Natürlich, solche Leute kennen sich ja auch mit Herz-Lungen-Maschinen aus.
Während ich dies schrieb, habe ich für eine Stunde unterbrochen, um zu weiteren Erkenntnissen zu gelangen. Es ist mir gelungen, die Herzfrequenz-Anzeige einzustellen und gleichzeitig in der obersten Zeile die Uhrzeit zu haben. Doch pausenlos läuft in der zweiten Zeile ganz groß etwas, was mich nervös macht, wahrscheinlich die Rundenzeit. Nach verschiedenem Knöpfedrücken bin ich in der 17. Runde. Bis zur 99. zählt der Laufcomputer. Ich bin gespannt, was er dann macht. Beim Training brauche ich ja nun nicht unbedingt auf die dahinrasenden Sekunden zu blicken; doch von Zeit zu Zeit ertönt ein Piepton. Den möchte ich um jeden Preis weghaben. Geht laut Seite 45 auch. Man muß nur durch Drücken und Halten der Stoptaste in die Uhrzeitanzeige zurückkehren. Aber genau das ist mir ja in den vergangenen vierzehn Tagen nicht gelungen.
Längst hätte ich auf meiner Trainingsstrecke sein können. Aber ich habe nochmals für eine halbe Stunde unterbrochen, um zu schauen, ob ich den Idiotentest bestanden habe.
Kann mir meine Laufstrecke, die zur Gehstrecke geworden ist, noch Stoff fürs „Laufen, Schauen, Denken“ geben? Zuweilen zweifle ich daran. Doch sie kann es. Obwohl ich sie immer wieder abschnittweise beschrieben habe, ihren Wandel in den Jahreszeiten, ihre vertrauten Punkte und ihre Auffälligkeiten, ereignet sich doch immer wieder etwas Neues, überraschende Begegnungen beispielsweise. Dieser Tage, als ich gerade die Steigung hinauf ging, sprach mich ein Läufer an; fragend nannte er meinen Namen. Er wohne in Freiburg, sagte er, doch etwa dreimal im Jahr halte er sich an meinem Wohnort auf. Mein Bild war ihm von Veröffentlichungen bekannt. Small talk auf der Strecke... Meine Krankheitsgeschichte gab Stoff her, und er sah, was ich nicht vermutet hatte, die Operationsnarbe auf meiner Brust. Wir standen ein paar Minuten zu lange beieinander; kurz darauf, nachdem wir uns verabschiedet hatten, wurden wir vom Gewitterregen überrascht. Ich ertrug ihn gern.
Die Begegnung am Tag zuvor war weniger erfreulich. Wieder war es an einer Steigung, einer jungen Frau sprang die Kette vom Fahrrad, und sie setzte den Weg, das Rad schiebend, an meiner Seite fort. Sie verweilte nicht lange bei der Einleitung, im Nu war vom lieben Gott die Rede. Ich war das Opfer eines Missionierungsversuchs. Meine Freundlichkeit war längst in abweisende Antworten umgeschlagen. Stille Aggressivität vermochte sie nicht zu erkennen; sie setzte ihren Bekehrungsversuch unbeirrt fort. Wenn es wenigstens eine halbwegs theologische Erörterung gewesen wäre! Ich ordnete die naive Gottespropaganda zwischen ekklesiogener Neurose und religiösem Wahn ein. Mit solchen Menschen haben es die Kirchen schwer; eine Glaubensgemeinschaft kann die ungebetene Missionstätigkeit nicht zurückweisen, andererseits muß sie sich vor Fanatismus und Intoleranz schützen. Glücklicherweise mußte die Radfahrerin dann abbiegen. Den Stadtteil, in dem ich wohne, hatte ich ihr beim ersten Ausfrageversuch nicht genannt. Hoffentlich treffe ich sie nicht wieder. Ich habe keine Lust, Bekehrungsversuche mit Therapieversuchen zu beantworten.. Eine Weile ging mir die gläubige Naivität noch im Kopf herum. So wirkt eine Begegnung weit länger nach, als sie dauert. Bedauerlicherweise bin ich nicht in der Lage, im Sinne des Wortes davonlaufen zu können.
Nicht schon wieder Fußball, doch beim Blick aus dem Fenster konnte ich mich, während ich dies am Samstagabend schreibe, dem Feuerwerk über dem Neckar in der Nähe des Stadions nicht entziehen. Die Scharen von Besuchern des Spiels in Stuttgart waren in meiner Straße auch nicht zu überhören.
Die Atmosphäre der Weltmeisterschaft scheint tatsächlich das Deutschlandbild in der öffentlichen Weltmeinung korrigiert zu haben. Da Hooligans keinen größeren Schaden angerichtet haben und auch kein angeblich unsicheres Stadion zusammengebrochen ist, konnte die Weltpresse das Positive, die Festfreude der Mehrheit, fokussieren. Die politischen Reizworte „Fremdenfeindlichkeit“ und „Ausländerhaß“ scheinen in den Papierkorb geflogen zu sein. Merken das unsere politischen Prediger und medialen Erzieher denn nicht? Es hat sich durch einige Tage Freundlichkeit gegenüber ausländischen Gästen, gemeinsamen Jubel und Verbrüderungsaktionen nicht das geringste ändern können, weil Verhaltensänderungen das Ergebnis eines langen Prozesses sind. Die Deutschen sind so, wie sie immer gewesen sind, und sie sind nie fremdenfeindlich gewesen, und sie haben, zumindest in Friedenszeiten, nie Ausländer gehaßt. Der durch Jahrhunderte hindurch latente Antisemitismus, der im Dritten Reich zur Staatsideologie erhoben wurde, ist ein anderes Kapitel; doch Juden fallen nicht unter den Begriff Ausländer. Was in der veröffentlichten Meinung geflissentlich verschwiegen wurde: Die große Mehrzahl der Deutschen ist nur dagegen, daß sich vor ihren Haustüren eine durch Intoleranz provokante Gegenwelt aufgebaut hat, die Mehrzahl ist gegen importierte Kriminalität, die die ohnehin in jedem Land vorhandene Kriminalitätsrate in die Höhe getrieben hat, die Mehrzahl ist gegen ungehemmte und häufig erschlichene Zuwanderung, gegen Sozialbetrug durch Asylbewerber und Gesundheitsfinanzierung türkischer Großfamilien. Die Medien, die abweichende Meinungen nicht dulden, haben uns Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhaß eingeredet; in Wahrheit haben die meisten Deutschen in ihrem Lebensumfeld ein gutes Verhältnis zu Eingewanderten, zu dem Inder in der Computerfirma, auch zu dem türkischen Müllmann und dem Handwerker vom Balkan, sie schätzen japanische und amerikanische Touristen und gehen zum „Italiener“ oder „Griechen“ essen. Die Fußball-Weltmeisterschaft hat den Widerspruch zwischen behaupteten Urteilen der Polit-Masochisten und realer Ausländerfreundlichkeit deutlich gemacht. Doch bei dem nächsten Ausbruch fehl- oder gar nicht erzogener Jugendlicher wird das im Leitartikel vergessen sein.
Als meine Hausrunde auffallend menschenleer war, wußte ich: Es wird Fußball gespielt. Am Freibad, wo sonst die Autos am Wiesenrand stehen, blieben am Freitag sogar die Parkplätze leer. Als am Abend, gegen Ende meiner Runde, auffallend viele Autos mit auffälligen Insassen auf der Straße zu sehen und zu hören waren, wußte ich: „Wir“ haben gewonnen.
 |
Noch nie habe ich in Westdeutschland – in Mitteldeutschland schon – so viele Fahnen gesehen wie in diesen Wochen. Erstmalig in der Bundesrepublik sind auch die Autos beflaggt. Ein richtiger Fan hat sein Fahrzeug doppelt beflaggt. Aber auch einen Van mit vier Fahnen habe ich gesehen. Unsereiner kommt sich ohne Fähnchen wie ein vaterlandsloser Geselle vor, und das sind wir vielleicht auch. Opportunisten gibt es auch dabei: Selbst Handwerker haben ihre Fahrzeuge schwarzrotgold geschmückt, mit Sicherheit, um sich bei ihren Kunden beliebt zu machen. Niemand hat die Beflaggung zur Fußball-Weltmeisterschaft angeordnet, was durchaus aufhorchen läßt. |
|
Eisbergsalat im Fußball-WM-Rausch |
Nun mag ja jeder, wie er will, Flagge zeigen. Doch mich stört das Mißverhältnis. Ich kann mich nicht erinnern, im November 1989, als die ehemaligen Besatzungszonen wieder zu einem Deutschland vereinigt wurden, diese Spontaneität und diesen Fahnenjubel erlebt zu haben. Der Volksaufstand 1953, da war ich gerade ein reichliches Jahr in Westdeutschland und daher doppelt sensibel, wurde öffentlich kaum wahrgenommen. Was will uns das sagen? Die Nation definiert sich über den Fußball. Jeder mag Karneval feiern, wie er mag, warum nicht einen nationalen Karneval mit Hupen, Tuten, Fahnen, die man sich um den Körper schlingt – man sitzt auf schwarzrotbanane –, und nicht zuletzt mit geschwenkten Bierflaschen. Aber der Unterschied der Beflaggung an Gedenktagen, die immerhin im Zusammenhang mit Schicksalsfragen der Nation stehen, und zu einem circensischen Ereignis – wobei ich größte Hochachtung vor Circus-Artisten habe – gibt mir zu denken.
Wenn diese nationale Identifkation doch bei anderen Gelegenheit durchgebrochen wäre! Ich bin überzeugt: Rechtsradikalismus unter Jugendlichen hätte sich nicht verbreitet, wenn die Nation und vor allem ihr Parlament in all den Jahren mehr Nationalgefühl gezeigt hätten und Politiker gemäß ihrem Auftrag zum Wohle des deutsches Volkes nationale Interessen vertreten hätten. Wer rechts des Mainstreams stand, wurde – im Gegensatz zu denen, die links davon standen – von vornherein verunglimpft. Aus Rechten wie den Republikanern – von wirklich braunen Gruppierungen will ich nicht reden – wurden Rechtsextremisten gemacht, bei der „Jungen Freiheit“, einem nichts anders als konservativen Blatt Feuer gelegt, und Kiosk-Besitzer trauten sich nicht, die rechte Wochenzeitung anders als unterm Ladentisch heraus zu verkaufen. So wie der restaurative Rheinstaat Adenauers die Jugend zur 68er-Bewegung provoziert hatte, so hat der angeblich multikulturelle Staat, der immer mehr Befugnisse abgetreten hat, die Saat zu einem primitiven Nationalismus gelegt.
Wodurch unterscheiden sich eigentlich rechtsradikale Aufmärsche fahnenschwenkender Jugendlicher und Heranwachsender von ebensolchen Fußballfans? Ach ja, durch die Polizei, die in dem einen Fall die Demonstranten von gewaltbereiten Linken trennt und im anderen Fall Spalier steht. Bei dieser Fußball-Gelegenheit erleben wir, welchen Ermessensspielraum die Polizei im Grunde hat. Sie drückt beim ungenehmigten Autokorso beide Augen zu, beim Hupkonzert auch die Ohren, die blockierten Autobusse bringen bei uns den Fahrplan für Stunden durcheinander, Behinderung und Straßenverkehrsgefährdung, wohin man blickt. Unangegurtet hängen sich die Insassen aus den Fenstern, Alkoholkonsum im Straßenverkehr wird offen demonstriert. Das alles, weil „wir“ gerade gewonnen haben. Meine Nachbarin dagegen, eine 85jährige Dame, wird gebührenpflichtig verwarnt, weil ihr Auto für die Dauer der Entladung ihres Einkaufs mit zwei Rädern.auf dem Gehweg stand. Und für die Überschreitung der innerörtlichen Höchstgeschwindigkeit auf einer Bundesstraße um 7 km/h wird die Macht des Staats gebührenpflichtig durchgesetzt.
Miesmacher in einem Spiel, in dem fast alle mitspielen? Ja, die gab es damals im Dritten Reich auch. Meine literarischen Vorbilder, Heinrich Heine, Kurt Tucholsky, Egon Erwin Kisch, waren zu ihrer Zeit Miesmacher. Man muß Unbeliebtheit ertragen. Wer nur beliebt ist, muß sich fragen, ob er etwas falsch gemacht hat.
Die nationale Aufwallung in diesen Wochen erstaunt mich. Vordem hatte unser Nationalgefühl etwas Verschämtes. Dreimal war ich in New York beim Marathon, da sollen jeweils Hunderte von Deutschen gewesen sein. Man hat sie nicht wahrnehmen können. Beim Frühstückslauf vor dem Marathon-Ereignis gruppierten sich die Deutschen um ihren jeweiligen Reiseveranstalter, der, wenn’s gut ging, eine nicht allzu große Fahne mitgebracht hatte; ohne die Reiseveranstalter hätte man die Deutschen als Deutsche kaum ausmachen können. Nach dem Médoc-Marathon intonierte die Kapelle im Festzelt eine Anzahl Nationalhymnen, alle in etwas schrägem Sound. Da wir ziemlich bald drankamen, wußten wir nicht so recht, wie das Abspielen der Hymnen gemeint war. Vorsichtshalber blieben wir sitzen und taten, als ob uns das nichts anginge. Für die Amerikaner existierte die Fragestellung nicht. Sie erhoben sich wie ein Mann und legten pathetisch wie immer die Hand aufs Herz. Bush hätte stolz auf sie sein können. Beim Spartathlon verlangten die Organisatoren nationale Bekenntnisse; die Bevölkerung sollte uns erkennen und zuordnen können. Seither habe ich eine Mütze und ein Trikot mit den „deutschen Farben“.
 |
Mit dem Fähnchen, das ich mir damals – ich weiß nicht mehr, zu welchem Zweck, vielleicht zur Tischdekoration – zugelegt hatte, habe ich jetzt spaßeshalber mein Auto dekoriert. Es war satirisch gemeint. Nach dem Fotografieren nahm ich das Fähnchen sofort ab. Ich warte erst einmal ab, ob die nationale Identifikation anhält. Wenn ja, hätte die Fußballweltmeisterschaft bei uns identitätsstiftend gewirkt. |
| Sonntags Varianten: Gebasteltes & Käsefähnchen für Bielfahrt |
Ganz wird es freilich nicht gelingen, weil da Außenseiter wie ich im Wege stehen.
| Zu weiteren Tagebuch-Eintragungen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | |
| 2016 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2015 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2014 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2013 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2012 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2011 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2010 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2009 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2008 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2007 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2006 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2005 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2004 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2003 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2002 | Alle Eintragungen HIER | |||
| Zurück zur den aktuellen Eintragungen HIER | ||||
| Zu weiteren aktuellen Inhalten bei LaufReport.de | ||||