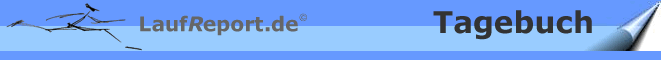

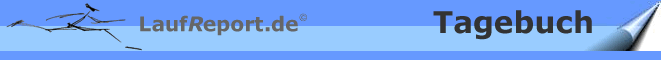  |
|
Laufen, Schauen, Denken Sonntags Tagebuch |
 |
| Um vier Uhr nachmittags begann ich zu laufen. Nachdem ich gegen dreiviertel sechs zurückgekommen war, stand zwei Reihenhäuser weiter der Leichenwagen in der Straße. Ich dachte an den Hundertjährigen gegenüber. Doch es war Frau K. Während ich einen Hitzelauf machte, war sie gestorben. In der Woche zuvor hatte sie mich gebeten, den Drachenzahn zu fotografieren, der gerade aufgeblüht war – und sie hatte keinen Film im Haus. Die kurze Blüte des Drachenzahns sollte sie auch noch erfreuen, wenn er nach wenigen Tagen verblüht sein würde. Ich fotografierte mit der Digitalkamera und bat sie um einige Tage Geduld, dann würde sie die Papierbilder erhalten. Ich bin zu spät gekommen. |
 |
Drei Tage vor ihrem Tod – ich war gerade in Biel – hatte sie mit Marianne und der Doktorin zu Abend gegessen. Ich nehme an, es handelte sich um eine Nachfeier zu ihrem 85. Geburtstag. Die drei alten Damen pflegten ihre Geburtstage außerhalb der Familie mit einem gemeinsamen Essen zu begehen.
An ihrem Todestag zupfte Frau K. Unkraut in ihrem Garten. Dabei muß sie Müdigkeit überkommen sein. Jedenfalls ruhte sie sich auf einem Stuhl aus. Dort fand sie wenig später ihre Freundin, die, als auf ihr Klingeln niemand öffnete, den Zugang über den Garten kannte. Frau K. war für immer eingeschlafen.
Ein Tod, wie wir ihn uns nur wünschen können. Sicher, Neunmalkluge werden fragen: Was mußte die alte Dame an einem heißen Juni-Nachmittag Gartenarbeit machen! Sie tat es, so wie wir an heißen Tagen laufen – ich zum Beispiel nach der Nacht an einem heißen Tage in Biel. Ich mißtraue den Statistiken, die Todesfälle an Hitzetagen prompt auf die Hitze zurückführen. Ich kann mir vorstellen, wie in Frankreich vor zwei Jahren, wenn ich mich recht erinnere, Tausende von Hitzeopfern statistisch zustandegekommen sind. Wäre es ein schönerer Tod gewesen, wenn Frau K. auf dem Klo gestorben wäre, einer infolge der Preßatmung nicht ungefährlichen Lokalität? Den Garten gepflegt, sich am Garten und an der Frucht der Arbeit erfreut, sich ausgeruht – der Augenblick des alten Faust: Verweile doch, du bist so schön...
Sozialverträglich war's auch, die Witwe eines Beamten ersparte ihrem Staat einen langen Krankenhausaufenthalt, eine Zuckerkrankheit, vielleicht eine Raucherbein-Amputation, eine Drogen-Entziehungskur, eine Organ-Transplantation, das Legen des einen oder anderen Bypasses im Wert von Einfamilienhäusern, eine jahrelange Pflegebedürftigkeit. Frau K. starb, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist, "normal". Sie ist, wenn auch dieser Ausdruck bei einer Fünfundachtzigjährigen erlaubt ist, "aus dem Leben gerissen" worden.
In ihrem Todesmonat ist sie als Autofahrerin gebührenpflichtig verwarnt worden. Sie war vor ihrem Haus mit zwei Rädern auf den Gehsteig gefahren, um dort ihre Einkäufe auf dem kürzesten Weg ins Haus zu tragen. Das hat 16 Euro gekostet. Die Politesse ließ nicht mit sich reden, auch wenn eine Fünfundachtzigjährige mit ihr redete. Dummerweise hat Frau K. bar gezahlt, kurze Zeit später hätte der Tod die Eintreibung vereitelt. Dem Argument, daß Besucher der benachbarten katholischen Kirche an manchen Sonntagen mit ihren Autos, die sie für manchmal 800 Meter Fahrstrecke benötigen, auf unseren Gehsteigen stehen, zeigte sich die Eintreiberin nicht zugänglich. Ich möchte Frau K., mit der mich eine 39jährige Nachbarschaft verbunden hat, den letzten Dienst erweisen, indem ich am nächsten katholischen Feiertag – und sei es am Heiligen Abend – die Autoreihe auf dem Gehweg fotografieren werde. Dann möge die Polizei unserer Retortenstadt mit einem von der CDU dominierten Stadtrat ihres Amtes walten. Kommunen sind nicht die Dienstleistungsbetriebe, als die sie sich gewöhnlich ausgegeben haben. Sie sind oftmals unsere nächsten natürlichen Feinde. Unser sogenanntes Stadthaus hat 11 Millionen Mark gekostet, dafür sind die Hallenbäder geschlossen worden – unsere Hallenbaddichte, einstmals fünf für 33000 Einwohner, ist ebenfalls von den Kommunen zu verantworten – , sollen die Bürger Bücher für die Stadtbücherei stiften, städtische Anlagen pflegen, den von uns nicht weggeworfenen Unrat aufsammeln und soziale Aufgaben ehrenamtlich erfüllen. Wenn jedoch Bürger in einen Dialog eintreten – und sei es, daß sich eine alte Dame wegen einer als ungerecht empfundenen Verwarnung zur Wehr setzt –, behauptet die Kommune ihren Standpunkt. Dialogfähigkeit zeigt sich im Alltag, nicht in Festreden.
Wie sehr bedauere ich, daß ich diesen Text Frau K. nicht zeigen kann.
Mein Verhältnis zu den 100 Kilometern von Biel hat eine Entwicklung erlebt. Anfangs war es das große Abenteuer, die unermeßliche Herausforderung. Ein Berg türmte sich in den Wochen vorher auf. Voller Spannung, Aufregung, Neugier. Dann erwachte der Ehrgeiz, zur spezifischen Bieler Ambiance kam die Ambition. Einige Jahre ging das so. Mit der Entfernung von der Bestzeit stellte sich Routine ein. Ich wußte ja, ich würde nach 100 Kilometern ankommen. Die 100 Kilometer begannen, mich als Phänomen zu fesseln. In jener Phase beschloß ich eines Jahres, die Veranstaltung von der anderen Seite kennenzulernen. Ich wollte die Nacht in Biel nicht als Läufer, sondern als Beobachter verbringen. Dann sah ich am Nachmittag, wie sie alle ihre Startunterlagen abholten oder sich noch anmeldeten. Diesem Sog konnte ich mich nicht lange entziehen. In Biel sein und zusehen? Ich meldete nach. Zufällig hatte ich alle meine Laufsachen im Auto. Natürlich war das nicht zufällig. Die Tiefenpsychologie wäre mir auf die Schliche gekommen. Unbewußt hatte ich, während der Verstand das Gegenteil plante, die 100 Kilometer laufen wollen, das Es wollte laufen, auch wenn das Ich behauptete, diesmal nur Zaungast sein zu wollen. Seit Jahren ist – ein weiterer Entwicklungsaspekt – Biel zum jährlichen Test geworden. Ich brauche keine Meisterschaft, um zu wissen, wo ich stehe. Biel ist viel wichtiger und aussagekräftiger. Gewiß, es gab die wohltätigen Illusionen – der Regen, die Hitze verhinderten die bessere Leistung, im nächsten Jahr würde ich die Scharte auswetzen. Regen und Hitze wirken sich nur unwesentlich aus. Die Alterslinien zeichnen sich stärker ab. Die Leistung ist kein Kalkül mehr, kein Ergebnis mehr oder minder großen Trainingsfleißes, mehr oder minder rationalen Trainings, sie ist ein Trotzdem. Ist nicht jede Leistung ein Trotzdem? In den letzten Jahren haben sich mir, dem Individualisten, dem hartnäckigen Außenseiter, dem sozialen Provokateur, die sozialen Beziehungen erschlossen. Die Bieler Lauftage sind für mich zum Läuferfest geworden. In diesem Jahr habe ich das wieder deutlich erlebt. So viele menschliche Annäherungen, Interesse, Akzeptanz, Herzlichkeit. Vor etwa dreißig Jahren würde ich vom Leistungsfetischismus im Verhältnis von Sportlern untereinander gesprochen haben. Reste davon finden sich noch – schade, daß Menschen erst im Alter menschlich werden.
Die 100 Kilometer von Biel im Jahr 2005 haben mir ein Stimmungshoch beschert. Die neue Streckenführung, die dennoch Tradition nicht verraten hat, erweist sich als nahezu optimal. Die 100 Kilometer sind gewiß leichter als vor dreißig Jahren, doch das ist, wenn man Biel nach wie vor als Zubringer zum Ultralauf betrachtet, kein Fehler. Die Nacht war lau, mit dem Lauf durch Hitze mußten wir das bezahlen. Doch im Gegensatz zur Hitze vor zwei Jahren wurde sie durch den Wind gemildert. Die laue Sommernacht hat wieder mehr Menschen an die Strecke gebracht.
Begegnungen: Die erste während des Laufens war bedauerlich, nämlich Constanze hier zu sehen, die Eliteläuferin, die sich verabschiedete. Beate gab mir in Lyss eine Nachricht für ihren Mann mit, der sie bei Kilometer 48 erwartete. Es lief nicht so gut, doch in Kirchberg sagte mir ihr Mann, es sei alles in Ordnung. Ziemlich früh begegnete ich Heinz, wir liefen lange gemeinsam, stundenlang. Immer wieder, wenn wir in den Gehschritt gefallen waren, forderte er zum Traben auf. Zu einem Rennsteigläufer schlossen wir auf, einem Pionier des GutsMuths-Rennsteiglaufs. Irgendwie kam er uns später abhanden. Heinz ließ ich in Büren zurück.
Diesmal bin ich schon in der ersten Hälfte gegangen. Die Fußsohlen brannten, Laufschuhe sind offenbar zum Laufen gemacht, nicht zum Gehen. Vor Gerlafingen sagte ich Heinz: „Und wenn alle Altersgenossen an mir vorüberziehen, – ich möchte gehen.“ Von den fünf Altersgenossen konnten zwei nicht vorbeiziehen, – sie waren ausgestiegen. Einer aber tat es, ein Italiener. Auch wenn ich meine Vorstellung verwirklicht hätte, – seine Zeit hätte ich nicht erreicht. Insofern bin ich zufrieden, daß ich so gelaufen und gegangen bin, wie mir zumute gewesen ist. Ich quälte mich nicht, ich bewältigte einfach die Strecke, auch wenn diese Bewältigung im Gehschritt vielleicht nicht sehr sportlich aussah. Die Eindrücke sind haften geblieben, es sind nicht nur punktuelle Bilder, sondern es ist diesmal ein Film der ganzen Strecke. Hinterher eine Schulterverspannung, aber kein Muskelkater. Ich fühlte mich nicht, als hätte ich 100 Kilometer zurückgelegt.
Ich habe kaum glauben können, daß die Maschinen auf dem Betonsträßchen, an dem die drei Aussiedlerhöfe liegen, nicht deshalb da standen, weil es einen Wasserrohrbruch zu flicken galt. Nein, man hat tatsächlich die Straße ausgebessert. An einer Stelle war ich immer nach links ausgewichen, um nicht Gefahr zu laufen, mit müdem Schritt über einen Betonabriß zu stolpern. Diese und eine Anzahl anderer Stellen sind frisch asphaltiert. Das wird besonders im Winter angenehm sein, hat sich doch in den Vertiefungen immer das Wasser in großen Lachen gesammelt. Manches Mal habe ich mir auf diesem Abschnitt in der Dunkelheit nasse Füße geholt. Gewundert habe ich mich über diese Reparatur deshalb, weil es Ortsstraßen gibt, die in üblem Zustand sind. Rückenleidende im Autobus zucken zusammen, wenn der Bus die Aufstiegsstraße von Eßlingen zu uns empor schaukelt. Was mag Verantwortliche bewogen haben, einen Feldweg zu reparieren? Wir wenigen Läufer hier waren sicher nicht der Anlaß und auch nicht die noch geringere Anzahl Skater. Die Reiterinnen? Heben die Pferde ihre Hufe zu wenig an? Aber die sind doch andere Untergründe gewöhnt. Nun können die Autos rascher an uns vorbeifahren.
Was tut sich in der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung? Es kursieren Unterschriftslisten, mit denen die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung bewirkt werden soll. Dabei war ja doch erst im letzten November Wahl. Ein Sturm im Wasserglas? Oder mehr? Das Forum auf der Website der DUV ist seit Wochen geschlossen. Genau hier könnten die Leute doch ihre Frustration, wenn es eine gäbe, abladen. „Ultramarathon“ bringt nur eine Darstellung des Präsidenten. Bisher habe ich in den meisten Vereinen, die ich kennengelernt habe, eine Krise erlebt, die man gelegentlich auch Putsch nennen konnte. Bei der Interessengemeinschaft Älterer Langstreckenläufer kam es Mitte der siebziger Jahre zu einer Spaltung, die sich in der Gründung einer neuen Laufzeitschrift und einem sang- und klanglos untergegangenen Club manifestierte. In dem Deutschen Verband langlaufender Ärzte und Apotheker wurde von einer winzigen Minderheit die Absetzung des verdienstvollen Gründungsvorsitzenden mittels Satzung angestrebt und in der folgenden Hauptversammlung mit entsprechend mobilisierter Wählerschaft schließlich durchgesetzt. Später war der Verband kaum noch existent. Im GutsMuths-Rennsteiglauf-Verein gab es den großen Krach mit Ablösung des ersten Vorsitzenden und Gründers des Rennsteiglaufs. Eine Weile bestanden zwei Triathlon-Verbände. Wer in seinem Umfeld um sich blickt, wird leicht ähnliche Fälle entdecken. Der TVN an meinem Wohnort war zahlungsunfähig, der Vorsitzende mußte gehen. Von den Mitgliedern wurde eine Umlage erhoben. Gut, daß ich schon 1978 ausgetreten war. Ich habe den Eindruck, Konflikte entstehen immer erst dann, wenn eine Organisation erheblich gewachsen ist. Vorher geht alles gut. Niemand hat ein Interesse, dem Vorstand dreinzureden; man ist ja froh, daß es einen Vorstand gibt. Und der Vorstand steht noch in engem Kontakt zur Mitgliedschaft.
Vom 1. August an wird alles falsch sein, was ich schreibe. Da tritt die angebliche Rechtschreibreform in Kraft. Doch Rechtschreibung kann man nicht auf dem Verordnungswege durchsetzen. Sprache entzieht sich mehr als alles andere der Logik. Rechtschreibung läßt sich nur in winzigen Anpassungen ändern. Die deutsche Rechtschreibung folgt zwei praktischen Prinzipien: Sie soll die Lesbarkeit erleichtern, nämlich fluktuierendes Lesen gestatten. Nur Erstkläßler lesen Buchstabe für Buchstabe, wir anderen springen von Wortbild zu Wortbild; während wir gedanklich noch einen Begriff aufnehmen, lesen wir bereits das nächste Wort. Das zweite Prinzip: Die deutsche Rechtschreibung folgt der gesprochenen Sprache. Die Vorschläge der Rechtschreibkommission und die Verordnung durch die Kultusminister verstoßen gegen beide Grundsätze.
Ohne fluktuierendes Lesen können wir kaum Wissen aufnehmen. Die sogenannte Reform führt für zusammengesetzte Wörter die Konsonanten-Verdreifachung ein – Schifffahrt ist das klassische Beispiel. Es sieht aus, als wäre bei der Tastatur das F hängengeblieben. Es gibt andere, aberwitzige Kombinationen, die unsere deutsche Sprache zum Konsonanten-Steinbruch machen. Man muß sich solche Worte nicht ausdenken, man findet sie in der Zeitung und in Fachliteratur. Ich habe versäumt, sie zu sammeln. Heute habe ich in einem Laufbericht den Schlussspurt gefunden (mein auf die konservative Rechtschreibung programmierter Rechner hat sofort Schlußspurt daraus gemacht und den Schlussspurt rot unterstrichen).
Das ß (kleingeschrieben, weil es ein großes ß nicht gibt) war eine Orientierungshilfe beim fluktuierenden Lesen. Diese Hilfe hat Tradition. In der deutschen Fraktur kannte man zwei verschiedne S (Ahnungslose Werbeagenturen und Malermeister, wenn sie Fraktur als nostalgischen Effekt verwenden, machen das häufig verkehrt). In der Fraktur werden das „lange S“ und das „Schluß-S“ (nach der Reform Schluss-S) unterschieden. „Hausseite“ muß in Fraktur mit zwei verschiedenen S geschrieben werden. So kompliziert viele Buchstaben in der Fraktur-Schreibschrift auch sind, – die beiden verschiedenen S trugen zu besserer Erfassung bei. Eine ähnliche Funktion hat das ß. Das und daß signalisieren auf den ersten Blick ihre unterschiedliche Bedeutung. Man könnte einwenden, das sei auch beim Doppel-S der Fall. Der Wegfall des ß nach kurz gesprochenen Vokalen hat in der Praxis zur orthographischen Anarchie geführt. Da wird ein S vergessen, wo es hingehört hätte, oder es wird hinzugefügt, obwohl es sich um den sächlichen Artikel handelt. Das hastige Schreiben von e-mails hat diese Tendenz verstärkt. Auch bei Akademikern darf man nicht mehr sicher sein, daß sie das und dass richtig schreiben. Das ß in daß setzt ein eindeutiges Zeichen.
Merkwürdig, sonst muß alles immer rationell sein, mit Konsonanten-Verdreifachung und Doppel-S in vielen Fällen, in denen das ß genügt hätten, müssen wir mehr tippen. Beim Tip übrigens auch. Wer künftig im Deutschen den englischen Begriff verwendet, statt den reformierten Tipp, macht einen Fehler.
Auch das Komma vor Und hat eine wichtige Funktion für das rasche Aufnehmen eines Textes, kündigt es doch an, daß ein Hauptsatz folgt und nicht etwa eine Aufzählung. Das Komma vor Und soll nach dem Willen der Reformer wegfallen. Den Schülern soll damit geholfen werden. Erreicht wird, daß sie den Satzbau schwerer begreifen. Es sind Kinder, denen der Computer äußerste Präzision bei der Eingabe abverlangt. Aber das Komma vor dem Und überfordert sie nach Meinung der Rechtschreibkommission.
Die Auflösung des ck in kk bei Trennungen erleichtert ebenfalls das Lesen; zudem folgt sie der Sprechweise, denn vor einem ck pausieren wir nicht. Die nun mögliche Trennung des St wird der Trennung von Haus-tür gleichgestellt. Dazu gelten einzelne Vokale nun als trennfähige Silbe; die Druckereien haben ihre Trennungsprogramme entsprechend umgestellt, wie ich bei einem absichtlich in konservativer Rechtschreibung in Auftrag gegebenen Buch bemerken mußte. Der A- neue Zeile – ckersalat ist der pure Schwachsinn, weil mit solchen Trennungen künstliche Stolpersteine beim raschen Erfassen gelegt werden. Auf den Schwachsinn sind besser verdienende Spezialisten gekommen. Sprachgefühl hat offenbar nicht zu ihrem Anforderungsprofil gehört.
Dem Grundsatz, daß die Entwicklung der Rechtschreibung der Sprechweise gefolgt ist, widerspricht die Neubildung „selbstständig“; kein Mensch spricht so, sondern verwendet nur ein einziges St. Kann man beim Sprechen wirklich Stengel und Stängel, Gemse und Gämse unterscheiden? Was ist hier künftig richtig: Auswendig oder auswändig, inwendig, aufwändig, Einwendungen oder logisch Einwändungen? Die neue Umlaut-Regel stiftet nichts als Verwirrung.
Zur Zusammenschreibung zusammengesetzter Verben kehrt man nun wieder zurück; die Experten haben Jahre gebraucht zu erkennen, daß ihre grundsätzlich eingeführte Getrenntschreibung zu Aussagen ganz anderen Inhalts führen kann. „Der viel versprechende Politiker“, wenn ein vielversprechender Politiker gemeint war, – das war ja wohl ein Eigentor der Kultusminister, die diese Reform abgesegnet haben.
Ich habe, nachdem vor über fünf Jahren die Vorschläge bekanntgeworden waren, etwa vierzehn Tage gebraucht, um zu erkennen, daß diese Rechtschreibreform nicht nur überflüssig, sondern auch schädlich ist. Die Schädlichkeit hat sich später herausgestellt, weil es zum orthographischen Chaos gekommen ist. In meiner Zeitung kann man den Albtraum ebenso lesen wie den Alptraum. Albtraum aber habe ich entgegen dem Duden vorher schon so geschrieben. Einige Medien sind reumütig zur konservativen Rechtschreibung zurückgekehrt. Wer wie ich an ihr festgehalten hat, erspart sich nun die Reform der Reform. Die Schulbuch- und Lexika-Verleger, die es mit der Umstellung nicht eilig genug haben konnten, bieten nun Bücher an, die dem neuen Stand der Rechtschreibreform nicht mehr entsprechen.
Es wird nicht wenige Deutsche geben, die wie ich aus gutem Grunde an der gewohnten Rechtschreibung festhalten, darunter auch eine Anzahl namhafter Autoren. Schüler werden künftig Literatur in zweierlei Orthographie lesen. Das wird ihnen bei der Orientierung bestimmt helfen. Das Festhalten an der konservativen Orthographie betrachte ich als eines unter mehreren Symptomen politischer Reife. Politiker, die ja schon einen europäischen Außenminister (ausgerechnet einen, der gegen seine eigenen Fachleute handelte) imaginiert hatten, sind von den Abstimmungen gegen die EU-Verfassung unsanft in die Realität der Volksmeinung über die europäische Bürokratie und Subventionsverwaltung befördert worden. Wir in Deutschland sind ja, offenbar mangels politischer Reife, gar nicht erst gefragt worden.
Leitartikel im Tagebuch? Damit befinde ich mich in guter Gesellschaft.
Am Montagmorgen habe ich es in der Zeitung gelesen: Beim Stuttgarter-Zeitung-Lauf am Sonntag sind zwei Läufer kurz vor dem Ziel zusammengebrochen und wenig später im Krankenhaus gestorben. Mittags rief mich die „Stuttgarter Zeitung“ an, ein Kollege des Ressorts Wissenschaft befragte mich zu dem tragischen Ereignis. Ich gab Antworten und keine Darstellung. Und davon war dann verständlicherweise nur wenig zu lesen, nämlich daß bereits zu schnell gestartet werde. Profis gäben das Anfangstempo vor. Doch das ist keine Erklärung für Todesfälle. Am besten wäre es, ich würde ein Statement vorbereiten und künftig den Rechercheur bitten, es zu lesen, ehe er Fragen stelle.
Versuchen wir’s. Eine Halbmarathonstrecke bewahrt nicht davor, Risiken zu mindern. Beim Stuttgarter Halbmarathon gab es bereits vor zwei Jahren ein Todesopfer. Wo Spitzenläufer starten – und das sind nicht selten Berufsläufer –, erhöht sich für Amateure der Aufforderungscharakter, nämlich es den Profis gleichzutun. Deren Spurt am Start reißt die Masse mit. Das Anfangstempo ist zu hoch. Das bedeutet nicht nur eine abrupte Belastung der Gelenke und der Muskeln, sondern vor allem auch des Herz-Kreislauf-Systems, dies dann womöglich auch noch zu einem Zeitpunkt, bei dem der individuelle circadiane Rhythmus seinen Höhepunkt noch nicht erreicht hat. Bei Massenveranstaltungen wie dem Stuttgarter-Zeitung-Lauf gilt dies allerdings nur für das vordere Feld, die anderen müssen sich notgedrungen Zeit lassen. Der Start mit Chip ist ein Segen, er bewahrt vor diesem Auf-die -Strecke-Preschen. Auch die Brems- und Zug-Läufer, die bestimmte Endzeiten vorgeben, haben eine regulierende, häufig auch mäßigende Funktion.
In der Anfangszeit des Volkslaufes wurde Hitze dafür verantwortlich gemacht, wenn Läufer kollabierten – Todesfälle kamen noch nicht vor. Otto Hosse, der Volkslaufwart des DLV, wetterte gegen zu späte Startzeiten bei Hitze. Er schoß sich geradezu darauf ein. Doch für ausreichend Trainierte ist Hitze kein Risiko, das nicht zu meistern wäre. Voraussetzung ist aber tatsächlich die Anpassungsfähigkeit des Körpers, und auch sie sollte, will man nicht allen damit zusammenhängenden Problemen aus dem Wege gehen, trainiert werden. Was möglich ist, zeigen der Spartathlon und der Marathon des Sables. Das Wetter am Sonntag in Stuttgart bot kein Risiko, es herrschte nicht das gefürchtete schwüle Talkesselklima, die Luftfeuchtigkeit war nicht erhöht.
Für die Stuttgarter Lauf-Katastrophe ist der Zeitpunkt der Zusammenbrüche typisch, wenige hundert Meter vor dem Ziel oder, in anderen Fällen, nach dem Zieldurchlauf. Weit schlimmer als ein zu schneller Start ist ein Endspurt. Die Erwartung des nahen Ziels führt zu Adrenalin-Ausschüttungen; sie stacheln den Läufer zur Höchstleistung an: Das an diesem Streckenabschnitt meist besonders enthusiasmierte Publikum tut mit seinen Anfeuerungen ein übriges. Unerfahrene Läufer verlieren die Kontrolle, sie wachsen über sich selbst hinaus, unweigerlich geraten sie in eine Sauerstoffschuld. Sie kann man verkraften – sonst gäbe es weder einen 100-m- noch einen 3000-m-Lauf. –, aber nicht dann, wenn der Körper einen Defekt aufweist.
Wo bei zu Tode gekommenen Läufern eine Obduktion vorgenommen worden ist, hat sich immer eine Vorschädigung herausgestellt. Fast immer ist diese nicht bemerkt worden. Spektakulär ist der Fall jenes Herzpatienten in Berlin, dem der Kardiologe Dr. Heepe, der leitende Arzt des Berlin-Marathons, dringend geraten hatte, bei dem geplanten Berlin-Marathon über vier Stunden zu bleiben. Der Läufer jedoch strebte an, die magische Grenze der drei Stunden zu unterbieten. Er hätte sein Ziel erreicht, wenn er nicht in Zielnähe gestorben wäre. Von den beiden Toten in Stuttgart, einem Achtundzwanzigjährigen und einem Zweiundvierzigjährigen, sind mir zur Zeit noch keine Befunde bekannt. Ich bin überzeugt, die Vorschädigungen werden sich zumindest durch eine Anamnese noch herausstellen.
Eine Vorschädigung muß kein Todesurteil bedeuten, wenn sie erkannt wird. Voraussetzung dafür ist ein EKG bei Ausbelastung auf dem Ergometer. Die jedoch scheuen offenbar viele nichtspezialisierte Ärzte, der Patient könnte ihnen ja vom Ergometer kippen. Ärztliche Bescheinigungen, man sei fit für einen Marathon, wie sie in ganz Frankreich vorgeschrieben sind, taugen allenfalls dazu, daß der Veranstalter dem Staatsanwalt beweisen kann, er habe alles getan, Schädigungen zu verhüten. Demjenigen, der ein solches Papier beibringen muß, nützt es nicht das geringste. Er kann sich höchstens des Gefühls erfreuen, im Moment der Untersuchung, wenn sie der ausstellende Doktor überhaupt ernstlich vornimmt, sei er ohne jegliche Herz-Auffälligkeit gewesen. Das Herz kann im Takt vor sich hin schlummern und im nächsten Moment Sprünge machen, und dies vor allem dann, wenn es ein gesundes Herz ist.
Ob diejenigen, die mit der Aktion „Von Null auf Zweiundvierzig“, einer Marathon-Vorbereitung im Crash-Kurs eines Jahres und nicht länger, Ehrgeizige für Medienzwecke instrumentalisieren, nach den zwei Toten in Stuttgart begreifen, welche Verantwortung sie auf sich laden?
Mit irgendwelchen gutgemeinten Maßnahmen verhindern zu wollen, daß Menschen bei einer Herausforderung, die von Zehntausenden ohne andere als muskuläre Probleme gemeistert wird, tödlich zusammenbrechen, greift zu kurz, wenn man es bei der Diagnose Vorschädigung beläßt. Todesfälle infolge verengter Arterien ereignen sich zufällig beim Laufen – nicht durch das Laufen – oder beim Schneeschippen, beim Auto-Anschieben oder – vor allem – auf dem Klo, infolge der Preßatmung alles gefährlicher denn Laufen, einer Aktivität im Sauerstoff-Gleichgewicht. Wobei es für den Betroffenen sicherlich weit erfreulicher ist, sein Leben, wenn es denn zu einem Arterienverschluß kommt, in einem Glücksmoment zu beenden als bei einer so trivialen Handlung. Für die Hinterbliebenen ist dies jedenfalls ein Trost.
Charakteristisch für die Medizin scheint mir zu sein, daß sie sich mit der Diagnose zufriedengibt – zum Beispiel Plaques in den Arterien, Arteriosklerose oder tödlicher Arterienverschluß – und nicht nach den Ursachen fragt. Im Einzelfall mag die Ursache nicht erkennbar sein, insgesamt aber ist die Tendenz eindeutig: Der Herztod hat sich auf ein früheres Lebensalter verlagert. Diese Tendenz ist vergesellschaftet unter anderem mit der Verlagerung des Diabetes auf ein immer früheres Lebensalter. Anstatt nun wieder bloß bei der Bestandsaufnahme stehen zu bleiben und unterschiedliche Krankheitsphänomene mit .einem modischen Begriff zu belegen, dem metabolischen Syndrom, sollten Ärzte zur schonungslosen Wahrheit vordringen: Die Ursachen liegen in der Art unserer Ernährung. Bewegungsmangel spielt eine Rolle, gewiß, aber bei den während der Sportausübung zu Tode Gekommenen kann man wahrhaftig nicht von Bewegungsmangel sprechen. Dafür, daß sich der Mensch von seinen anthropologischen Grundlagen entfernt hat, muß er einen hohen Preis zahlen. Eine dieser Grundlagen ist die Bewegung. Auf diesem Gebiet hat die Medizin erkannt, daß der Bewegungsmangel durch Bewegungstraining kompensiert werden muß. Auf dem Gebiet der Ernährung hingegen fehlt die Einsichtsfähigkeit. Medizinische Rattenfänger haben freie Hand. Wenn man nur Fett spare, wenn man nur auf Vitamine bedacht sei, wenn man nur ausreichend Mineralstoffe zuführe... Tatsache ist, daß unsere Nahrung seit dem 19. Jahrhundert mehr und mehr auf Industrieprodukten beruht. Zehntausende von Jahren hat sich der Mensch grundsätzlich auf die immer gleiche Weise ernährt, Veränderungen bezogen sich nur auf den Austausch natürlicher Produkte untereinander, zum Beispiel durch die Verbreitung der Kartoffel in Europa oder die Einfuhr der Banane im 20. Jahrhundert. Die Veränderungen in den letzten Jahrzehnten dagegen bestehen in der Abkehr von naturbelassenen Lebensmitteln, dem Ungleichgewicht der Nahrung, insbesondere der Erhöhung des Fleischkonsums, und der Überhandnahme der Fabriknahrung bis hin zur ausschließlichen Fehlernährung. Wenn heute das Standardgericht von Kindern Pommes frites mit Ketch up und Cola ist, muß man sich nicht wundern, wenn diese junge Generation in eine tödliche Falle stolpert. Die Todesfälle im Läuferfeld und auf dem Fußballrasen sind nur Alarmzeichen einer Entwicklung, die dieser Generation noch bevorsteht.
Einige tausendmal bin ich diesen Weg gelaufen, meine Hausrunde. Die Hunde wissen es. Der Bussard nicht. Auf dem Heimweg, ungefähr 500 Meter von zu Hause, griff er mich an. Zum erstenmal hatte ich das Gefühl, er sei mir über den Kopf geglitten. Das unheimliche Rauschen und das Gleiten – das war alles eins. Er muß mich berührt haben, ich habe sein weiches Gefieder gespürt. Aber wo hat er seine Krallen gelassen, hat er die beim Anflug abgewinkelt? Ich habe keine Krallen gespürt, sondern offenbar seinen Bauch. Es war nicht unangenehm. Ich konnte die Berührung nicht glauben, ich strich mir übers Haar, ob das sich etwa aufgestellt habe. Doch es lag wie sonst an. Ich fuchtelte noch mit den Armen. Wahrscheinlich lachte er mich aus, er hatte seinen Irrtum längst bemerkt. Ein Jugendlicher auf dem Feld staunte. „Ein Adler“, sagte er zu einem Mann auf dem Feld. Wahrscheinlich hat das Pisa-Phänomen auch den Biologie-Unterricht ergriffen.
Einige Tage zuvor hatte der Bussard mich bereits ausgespäht. Da hatte ich mit meiner Runde gerade begonnen, etwa 200 Meter von zu Hause entfernt. Er flog mich an, jedoch in etlicher Höhendistanz, und entfernte sich sofort wieder. Am Beginn des Gebietes aus Feldern, Gärten und Obstwiesen ist er abgebildet, auf dem Schild „Landschaftsschutzgebiet“. Das Dreieck hat einen grünen Rand, im Grunde müßte es einen roten haben: Achtung, Gefahr aus der Luft! Auf meiner Hausrunde war ich mehrfach schon von einem Mäusebussard (Buteo buteo) bedroht worden, das war im Körschtal, mitten im Grünen. Doch daß sich ein Bussard ganz in der Nähe eines Wohngebietes aufhält, ist mir neu. Auch meine früheren Begegnungen mit einem Bussard fanden abseits von Siedlungsgebieten statt. Im Sauhag, einem größeren Waldgebiet, das ich früher für meine großen Runden mit dem Auto aufgesucht habe, gab es eine Passage, auf der man sich auf einen Bussard einstellen mußte. Ich pflegte mich an dieser Stelle mit einem Knüppel zu bewaffnen, den ich nach der kritischen Passage ablegte. Auch bei der 100-Kilometer-Runde um Marburg bin ich von einem Bussard angeflogen worden. Mäusebussarde jagen, wie ich gelesen habe, von einem Ansitz aus; sie bevorzugen offenes Gelände und fliegen immer von hinten an.
Dabei laufe ich doch gar nicht so schnell, daß mich ein Vogel mit einem kleinen Säugetier verwechseln könnte. Die Flügelspannweite eines Bussards ist beeindruckend, das habe ich jetzt wieder gesehen. Was geschieht, wenn er seinen Irrtum nicht bemerkt? Ende der sechziger Jahre ist ein Läufer aus dem Nachbarort tatsächlich angegriffen worden; die Kopfwunde, die der Vogel gerissen hatte, mußte im Krankenhaus genäht werden. Es klingt nach Läuferlatein, doch der Betroffene hat es mir selbst erzählt.
Meine Erlebnisse mit Buteo buteo, dem Greifvogel aus der Familie der Habichtartigen (Accipitridae), habe ich gestern abend niedergeschrieben. Heute morgen die passende Meldung in der Zeitung: „Mäusebussarde greifen Jogger an“, keine sehr originelle Überschrift. Da die Zahl der Mäusebussarde in Deutschland auf 70000 Paare geschätzt wird, könnte man wahrscheinlich jeden Tag in irgendeiner Zeitung dieselbe Überschrift verwenden. Der Vorfall, über den meine Tageszeitung berichtet hat, hat sich einige Kilometer von meiner Laufrunde entfernt ereignet, im Körschtalwald. „Schläge von Flügeln oder Beinen gegen den Kopf hinterließen deutliche Spuren auf der Mütze.“ Ein Forstbeamter führt die Angriffe auf den Brutpflege-Instinkt zurück. Ende Mai und im Juni seien die Jungen zwar flügge, aber noch flugunfähig. Sich schnell bewegende Personen würden von Bussarden als Angreifer und Eindringlinge ins Revier betrachtet, die ihre Jungen gefährdeten. Doch da ich auch schon im September angegriffen worden bin, traue ich dieser Erklärung nicht ganz. Zumindest darf sie nicht Ausschließlichkeit beanspruchen.
Die sonstige Tierwelt verhält sich friedlich. Die drei Gänse auf einem Grundstück schlagen schnatternd Alarm, wenn man sich nähert, hören jedoch sofort auf, wenn man vorübergelaufen ist. Offenbar sind die Gänse klüger als dumme Hunde, die, wenn sie hinter dem Zaun erst einmal bellen, um ihr Revier zu verteidigen, lange nicht damit aufhören. Da mag man sich längst entfernt haben.
Die Pferde, die unter den Bäumen den Rasen mähen, schauen gar nicht erst empor. Ein Hund, der auf ihre Weide läuft, regt sie nicht auf. Zwei Reiterinnen habe ich eingeholt. Eines der Pferde wandte den Kopf um eine Vierteldrehung, mehr nicht. Pferde als Fluchttiere sollen ausgezeichnet nach hinten sehen können, etwas das uns Autofahrern leider abgeht. Wahrscheinlich hatte mich das Pferd schnaufen hören; also überzeugte es sich davon, daß von mir keine Gefahr ausging. Kaum zu glauben, daß Pferde, diese großen Tiere, auch schreckhaft sein können. Vor Jahren begegnete ich einer Reiterin; ich trug einen gefütterten Regenanzug, und beim Laufen rieben die Kunststoff-Hosenbeine gegeneinander. Das erzeugte ein feines hohes Geräusch. Für das Pferd muß es unangenehm gewesen sein, furchterregend geradezu. Das Pferd weigerte sich, an mir vorbei zu gehen. Es sperrte sich. Erst als die Reiterin es beruhigte und ich im Schritt ging, passierte es mich widerwillig. Bei Löffler denken sie vor der Fertigung an alles mögliche, aber an schreckhafte Pferde hat wohl keiner gedacht.
Heute ging es wieder ganz gut, gestern hatte ich nach 200 Metern das Gefühl, keinen Schritt mehr laufen zu können. Der Rennsteiglauf am Samstag hat seine Spuren heimlich hinterlassen. Kein Muskelkater, nichts – außer einer Hochstimmung. Doch zu einer neuerlichen Herausforderung und sei es nur dem üblichen Trainingslauf bin ich noch nicht fähig. Dabei sind mir die 72,7 Kilometer ausgezeichnet bekommen. Allerdings bin ich sie zum großen Teil gegangen. Vom Marktplatz in Eisenach zur Hohen Sonne hinauf ohnehin. Die Steigungen machen wir mehr zu schaffen als früher. Beim Laufen auf leichten Steigungen – auf stärkeren ist nicht einmal an einen flotten Gehschritt zu denken – spüre ich die Schwere des Herzens. Sobald ich die Anstrengung ein klein wenig zurücknehme, ist alles wieder normal. Vorher schon habe ich Markus gesagt, dies werde mein letzter Supermarathon auf dem Rennsteig sein. Nicht die Strecke ist es, sondern der zeitliche Druck belastet. Jedes Nachlassen des flotten Gehschritts bedeutet Zeitverlust. Im vorigen Jahr hatte ich noch 12 Minuten Zeit bis zum Zielschluß.
 |
Markus hat sich nicht abhalten lassen, den Supermarathon an meiner Seite zurückzulegen. Es ist mir nicht unwillkommen. Das merke ich jetzt. Im Gegensatz zu früheren Jahren bin ich nicht mehr allein – eine beträchtliche psychische Stärkung. Zudem verfügt Markus über Hightech am Handgelenk. Er ist in der Lage, präzise über Standort, Höhenmeter und Durchschnittsgeschwindigkeit zu informieren. Auf diese Weise laufen und gehen wir diszipliniert. Wir schaffen es, dank Umsetzung der Informationen in unsere Fortbewegungsart netto unter 12 Stunden zu bleiben. Am Ziel in Schmiedefeld wird zwar versichert, jeder, der nach 12 Stunden eintreffe, werde ebenso herzlich begrüßt und gewertet. Aber die Liste heute nennt nach uns – mit 11:57:46 – nur einen einzigen Läufer mit über 12 Stunden. Es sind jedoch mehr nach uns gekommen. |
|
Markus am Denkmal des Rennsteiglaufs
am früheren Startort Hohe Sonne |
Ich muß Abschied vom Supermarathon des Rennsteigs nehmen. Ich bin ja zufrieden, daß dies nicht schon am Grenzadler bei Kilometer 55 wegen Überschreitung des Limits geschehen ist. Ich bin zufrieden, daß ich – dank Markus – noch unter 12 Stunden bleiben konnte. Doch ich würde gern weiterhin zum Supermarathon kommen. Dies ist zwar mein individuelles Problem, aber ich bin der Meinung, daß es auch ein gesellschaftliches Problem ist. Ich bin zwar wieder einmal der älteste gewesen, aber es gibt andere, auch Ältere, die diese Strecke ebenso bewältigen könnten, nur eben vielleicht nicht mehr unter 12 Stunden. Zur Zeit der „Opa-Läufe“ in Bad Brückenau, in Bad Grönenbach und in Neuss konnte man sich wirkliche Langstreckenläufe von Achtzigjährigen wohl nicht vorstellen. Denn die „Opa-Läufe“ waren verkürzte Volksläufe der untersten Stufe. 72 Mittelgebirgskilometer hingegen auch nur mit einem Schnitt von vier bis fünf Kilometern in der Stunde zurückzulegen, erscheint nicht nur mir als eine durchaus sportliche Leistung. Doch dafür gibt es außer dem 100-Kilometer-Lauf von Biel keinen Wettbewerb, und selbst in Biel hat man in diesem Jahr mit der Herabsetzung des Zielschlusses auf 20 Stunden genau das falsche Zeichen gesetzt. Es stimmt zwar, daß zu dieser Zeit kaum noch jemand unterwegs ist; aber einst war zu dieser Zeit der 90jährige Adolf Weidmann unterwegs. Sollte man nicht in der Zeit, da ein Lebensalter von hundert nicht mehr nur bloße Utopie ist, eine sportliche Perspektive, meinetwegen die der „Uropa“-Läufe“, bieten? Eine Verlängerung des Zielschlusses in Schmiedefeld würde sicher kein großes Potential aktivieren, aber sie würde ein Zeichen setzen. Reden wir nicht von der Logistik! Hätte man von Anfang an nur im Auge gehabt, wie man Verpflegungsstände und Zeitwertung bei Ultrastrecken auf Punkt-zu-Punkt-Routen besetzen könne, hätte es keinen einzigen derartigen Lauf gegeben. Ich kämpfe nicht darum, nochmals in Eisenach starten zu dürfen – irgendwann ist für jeden einmal Schluß –, ich denke an die Kommenden, jene, die dank lebenslangem Training vielleicht in größerer Zahl noch ein bißchen fitter sein werden als wir. Ich denke an die vielzitierte gesellschaftliche Bedeutung des Sports.
Das Gras steht hoch. Als der Wind darüber strich, bewegte es sich wie in Wellen. Da hier, im Gegensatz zu meiner Geburtsstadt, selten der Wind richtig bläst, ist mir dieses Phänomen erst heute aufgefallen. Bei soviel bewegtem Grün habe ich ans Allgäu gedacht. Das grüne Allgäu der Milchwirtschaft war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ein blaues Allgäu – blau von der Flachsblüte. Ich kenne den Flachs – die Blüte und das „Hecheln“ der Halme – aus Schlesien. Ich habe nie mehr Flachs blühen sehen. Was im Allgäu als wirtschaftlicher Fortschritt betrachtet worden ist, die Umstellung auf die Milchwirtschaft, bedauere ich. An solchen Veränderungen zeigt sich, daß vieles, was uns selbstverständlich zu sein dünkt, eine recht kurze Geschichte hat. Wenn man sich das vor Augen führt, wächst der Mut zu Veränderungen.
Die Geschichte des Laufens als Alltagskultur beschränkt sich nicht aufs Laufen. Nicht das Wandern, sondern das Laufen hat den Anstoß zum Walking gegeben. Erst die rasche Fortbewegung durch das Auto hat uns das Fahrrad wieder entdecken lassen. Die Wellenbewegung geht weiter. Heute bin ich – ja, wem? – begegnet, früheren Spaziergängern, Wanderern, Fußgängern, die ein Ziel erreichen wollten? Jedenfalls gingen sie in forcierter Geschwindigkeit. Sie betrieben keinen Sport, kein Walking zwecks Erreichung von Fitneß; sie legten einfach einen Weg zurück, aber sie legten ihn in forscher Gangart zurück. Sie betrieben Bewegungstraining im Alltag, ohne daß sie dieses Training angesetzt hätten. Mit dieser Entwicklung ist viel erreicht. Aber es hat eines Anstoßes bedurft, eben der Laufbewegung. Daher ist es die pure Dummheit, wenn Kritikpunkte des Laufens zum Anlaß genommen werden, die Laufbewegung schlechthin zu verunglimpfen. Idee festhalten: Eine Geschichte der Verunglimpfung des Laufens zu schreiben. Es könnte eine Geschichte der Kurzsichtigkeit, der Beschränktheit und, denkt man an die Medien, des Opportunismus werden.
Ein Mädchen und ein Bub überholten mich auf ihren Rollern. Der Bub war barfüßig. Auch wieder bemerkenswert. In meiner Jugend war Barfüßigkeit ein Zeichen der Armut. In meiner Volksschulklasse waren es zwei, die barfuß zur Schule gingen. Obwohl meine Eltern ebenfalls arm waren, bildete ich mir etwas darauf ein, in Schuhen zur Schule gehen zu können. Vernünftige Verhaltensweisen erhalten erst durch soziale Bewertung ihr Plus- oder Minus-Vorzeichen. Es leben die Unsozialen, die Menschen, die sich über tradierte soziale Bewertungen hinwegsetzen!
Gestern am Ende der Laufstrecke sah ich ein Mädchen laufen, das mit betont angewinkelten Armen Hanteln in den Händen hielt. Das Mädchen war eher zartgliedrig, keines vom Typ narzißtischer Bodybuilderinnen. Welchen Sport mag das Mädchen betreiben, dachte ich. Ob es kompensiert, wie wir alle etwas zu kompensieren haben? Will es den schmächtigen Oberkörper stählen? Die Frau eines Freundes in Frankreich, die Judo-Lehrerin war, befürchtete Auswirkungen auf ihre Oberarmmuskeln. Sie wollte vermeiden, was andere sich antrainieren. Um mit dem eigenen Körper problemlos umgehen zu können, bedarf es reichlich gesunden Menschenverstandes. Doch woher nehmen?
Gestern bei Sonnenschein losgelaufen, bei Sonnenschein wieder daheim. Doch was dazwischen lag, war grausam. Die sich so harmlos nähernden Wolken schienen noch ein Stück tiefer gesunken und noch ein Stück dunkler geworden zu sein. Der Regen ließ nicht lange auf sich warten. Zum Glück hatte ich diesmal die lange Hose angezogen und ein funktionstüchtiges Hemd. Das hielt den Regen zwar nicht ab, aber es ließ kein Frösteln aufkommen. Der Wind trieb mir Schauer entgegen. Ich versuchte, schneller zu laufen. Dann kürzte ich die Strecke ab, statt hinunter ins Körschtal zu laufen, bewegte ich mich auf der Höhe entlang. Auf Pfützen achtete ich nicht mehr sonderlich, es war ohnehin alles naß. Am Ortseingang einige wohlgelaunte Männer unter Regenschirmen. Einer lief ein paar Meter neben mir mit, den Schirm über mich haltend. Ach, war das lustig – für die anderen. Ich beobachtete an mir einen Mangel an Humor. Die Ampeln an der Kreuzung mißachtete ich – bloß nicht stehenbleiben und auf Grün warten! Dann, nach der Abkürzung, hörte es auf zu regnen, selbst die Sonne kam wieder durch. Die Strecke war zwar kürzer, aber ich hatte ein unfreiwilliges Tempotraining. Zu Hause merkte ich, daß die Füße eiskalt waren. Die Dusche, welche Wohltat! Wie gut geht es uns, die zivilisatorischen Errungenschaften erleichtern uns die Begegnungen mit der Natur.
Heute ist das Wetter ähnlich gewesen – Aprilwetter, Sonnenschein, immer wieder starke Schauer. Da sagte ich mir: Mich legt man nicht mehr rein. Ich bin zu Hause geblieben und sah zuweilen dem Regen zu.
Selbst die Lokalzeitung begeht die Erinnerung an das Kriegsende. Mir ist jetzt klar, daß mein tiefes Gerechtigkeitsgefühl seinen Ursprung in einem Zwiespalt hat. Widerstrebend folgte ich den Einberufungen, erst zum Arbeitsdienst, danach zum Militär. Mein Kriegsziel war zu überleben. Als der Krieg begann, war ich 13 Jahre alt und davon überzeugt, wenn ich das wehrfähige Alter erreicht haben würde, wäre der Krieg Gottseidank vorbei. Mir ging auch durch den Kopf, ob ich nicht meine Eltern dazu bewegen könnte, in die Schweiz zu fliehen. Mein Vater war Handwerker und in der Lage sich durchzuschlagen. Ich war unendlich naiv. Die Schweizer Grenze kannte ich nur aus dem Schulatlas, geschweige denn daß ich eine Vorstellung davon hatte, wie man die Grenze eines im Krieg befindlichen Landes überwindet. Erst recht hatte ich keine Ahnung, daß die Schweiz selbst Flüchtlinge, die sich wie die Juden in höchster Lebensgefahr befanden, abweisen würde. Hitlers Krieg war nicht mein Krieg und auch nicht der meiner Eltern. Mein Vater hatte im ersten Weltkrieg in den Ardennen einen Kopfschuß erlitten, dessen Folgen ihn lebenslang behinderten. Meine Mutter hatte zwei Brüder im ersten Weltkrieg verloren, zwei weitere dann im Verlauf des zweiten Weltkriegs. Wir erduldeten den Krieg, nichts weiter. Ich bin sicher, daß ich nicht der einzige mit solcher Mentalität war. Mein Gerechtigkeitsgefühl empört sich dagegen, daß wir, bloß weil wir dem Krieg nicht entrinnen konnten, in die Verantwortung für den Krieg und die damit verbundenen Verbrechen genommen werden. Genau die Leute unterhalb der obersten Führungsebene, die Verantwortung trugen, sind nach dem Krieg größtenteils nicht zur Verantwortung gezogen worden. Meine Feinde im Krieg waren nicht die Russen, sondern Kommandeure und Unteroffiziere. Die schienen mir für mein persönliches Schicksal viel gefährlicher zu sein. Ein Feldwebel wollte, wie er mir beim Anzünden eines Strohdaches zuschrie, mich in der Tat vors Kriegsgericht bringen; ich hatte den Befehl nicht ausgeführt, ein Geschütz zu sprengen. Erstens wußte ich nicht, wie man das macht, zweitens ist einem, wenn man den Krieg ohnehin für verloren ansieht, ein Geschütz, zumal wenn die Munition dafür fehlt, ziemlich gleichgültig. Nicht gleichgültig war mir zwei Monate zuvor jener Oberschlesier gewesen, der mit einem Bauchschuß zwischen den Fronten lag. Die Wahrheit ist so einfach: Die jeweils Herrschenden zwingen die kleinen Leute, ihnen zu Willen zu sein. Und wenn es schief geht, haben die kleinen Leute, und nur diese, das auszubaden. Die Führungsschicht bleibt in der Gesellschaftsschichtung weiterhin oben. Nur einige wenige haben ihren Irrtum mit dem Leben bezahlt; viele Angehörige des Widerstands hatten mit den Nationalsozialisten zunächst paktiert oder waren wie die Geschwister Scholl vom Nationalsozialismus begeistert. Die Verhältnisse sind heute nicht anders. Welche Irrtümer einer demokratisch gewählten Regierung auch unterlaufen, – sie wird sich, wenn es schief geht, immer darauf berufen, daß sie dazu vom Volk legitimiert worden sei. Meine Lebenserfahrung ist: Immer sind die kleinen Leute schuld. Dazu paßt, daß mir nach meinem Wechsel in die Bundesrepublik Deutschland die Kommission im Auffanglager Gießen 1952 vorhielt, ich sei Nutznießer des kommunistischen Systems gewesen. Die Nutznießung bestand darin, daß ich dort in Lohn und Brot stand und mir nichts Schlimmeres widerfuhr als der Ausschluß aus FDJ und SED.
In den USA ereignet sich die gleiche Flucht aus der Verantwortung. Bei den Folterskandalen der Besatzungstruppe im Irak wird nicht nach der Verantwortung der Verantwortlichen geforscht, sondern ein paar geeignete Perverse werden der Gerechtigkeit zum Fraße vorgeworfen. Weshalb eigentlich ist eine Bundesjustizministerin gechasst worden, bloß weil sie die amerikanische Justiz als ziemlich lausig bezeichnet hatte! Sie hat doch recht gehabt. Der Opportunismus ist heute nicht geringer als früher.
Vielleicht sollte man den Leuten, die unnütz fragen „Was denken Läufer beim Laufen?“ , dies alles als konkretes Beispiel nennen. In Anbetracht der Emotionen, die durch die Zeitläufe bewirkt werden, kann es uns beim Laufen gar nicht langweilig werden.
Am Montag Stunden vor dem Fernsehgerät verbracht, wie ich das ganz selten tue. Doch die Übertragung aus dem Untersuchungsausschuß zur Visa-Affaire faszinierte – mehr jedenfalls als die Vorstellung eines Drehbuchschreibers davon, wie es im Kanzleramt zugehe; von der Reihe „Der Kanzler“ habe ich nur.anderthalb Folgen gesehen, darunter auch die Szene, in der gelaufen wird. Fischer vor dem Untersuchungsausschuß dagegen, das war das pralle politische Leben, das war Realität, und kaum jemals in den letzten Jahrzehnten hatten wir gedacht, daß sie so banal sein könnte.
Mein Verhältnis zu Joseph Martin Fischer, genannt Joschka, ist – nein, nicht gespalten, es ist eindeutig. Gespalten war mein Verhältnis zu den Grünen. Als sich in den siebziger Jahren eine ökologische Bewegung formierte, sah ich darin eine politische Perspektive. Der Widerstand, der sich dagegen regte, schien mir eine Bestätigung des richtigen Weges zu sein. Ich erinnere mich deutlich, daß ich, als ich mich in der „Condition“ zu meiner Sympathie für die Grünen bekannte, von Lesern angegriffen wurde. In einem Brief hieß es ziemlich drohend, es sei gut zu wissen, daß der Chefredakteur der „Condition“ ein Grüner sei. Die Ecke, aus der diese Anwürfe kamen, war mir bekannt. Gerade unter alten Sportlern schimmerte damals noch so mancher braune Fleck durch. Wie Schuppen fiel es mir von den Augen, als ich 1978 nach meinem ersten New York-Marathon an einer Autobusfahrt nach Washington teilnahm. Auf der Rückfahrt mit dem Greyhound – ich hatte eine Pauschalreise mit einem fakultativen Ausflug gebucht – meldete sich die Betriebsnudel, die jede Reisegesellschaft hat, am Mikrophon zu Wort. Nach den Witzen wurde ein Lied nach dem anderen angestimmt. Und dann hörte ich sie wieder, die typischen Lieder aus der Nazizeit. Darunter auch eines, das nicht anders als antisemitisch zu bezeichnen ist. Ich kriege es nicht mehr zusammen, jedenfalls wird darin besungen, daß die Wellen über den Juden zusammenschlügen und die Welt nun Ruhe habe. Alle diese Lieder wurden auch von den Frauen der Läufer mitgesungen; das Durchschnittsalter der Reiseteilnehmer war hoch. Ich war drauf und dran, mich zu erheben und das Mikrophon zu ergreifen. Ich werfe mir einen Mangel an Zivilcourage vor, daß ich es nicht getan habe, sondern nur darauf hoffte, der schwarze Fahrer habe ohnehin kein Wort verstanden. Ich war einfach noch zu angepaßt; außer durch die Teilnahme an einer Anzahl Laufveranstaltungen hatte ich damals wenig persönliche Kontakte zur Laufszene. Ich Außenseiter wollte mich nicht als Außenseiter offenbaren. Denn mir war klar, wenn ich im Greyhound mahnende Worte an die Kameraden gerichtet oder mir gar Nazilieder verbeten hätte, wäre die Stimmung dahingewesen, und ich wäre ausgestoßen gewesen. Ich war feige. Dennoch, meine Empörung war groß genug, daß ich mit solchen Leuten – eine Anzahl von ihnen schien mir in der damaligen IGÄL eine Rolle zu spielen – nichts zu tun haben wollte.
Die Grünen schienen mir in mannigfacher Hinsicht eine politische Alternative zu bieten, nicht nur die ökologische Perspektive, auch die pazifistische Grundhaltung, auch das unkonventionelle Verhalten, der endgültige Aufbruch aus der restaurativen Adenauer-Zeit. Doch ich hatte ein Problem, das war das Verhältnis der Grünen zum Leistungsprinzip, insbesondere auch zur sportlichen Leistung. Alles was nach Anstrengung und Schweiß aussah, wurde von den Grünen abgelehnt. In Stuttgart war damals ein alternativer Sportverein gegründet worden; im Gedächtnis ist mir noch geblieben, daß darin die Jonglage als Alternativsport gepriesen wurde. Dem konnte ich, der ich die bekömmliche Strapaze entdeckt hatte, nicht im entferntesten folgen.
Von einem Joseph Fischer war lange Zeit nicht die Rede. Als er zu den Grünen stieß, hatte er nicht das mindeste ökologische Profil wie viele andere Köpfe und Pioniere der Grünen. Als Zeitungsleser konnte ich beobachten, daß hier ein Straßenkämpfer, der zum Kampf gegen die Staatsgewalt aufgerufen hatte, die junge Partei der Grünen nach und nach umkrempelte. Der Spannungsbogen Fundis und Realos war im Grunde weniger eine ideologische denn eine Personalfrage.
Laufschuhe ausschließlich als Mittel der Provokation zu benützen, dafür brachte ich kein Verständnis auf. Als Fischer 1985 so zu seiner Vereidigung als hessischer Umweltminister erschien, hatte ich mit den Grünen schon gebrochen. Ich gewann den Eindruck: Ein Opportunist buhlt um die Basis. Einer, der kein Format hat, schickt sich an, die Form zu zertrümmern. Es verwunderte mich nicht im geringsten, daß er sich, bundespolitisch zur Machtteilhabe gelangt, ebenso rasch auch äußerlich den Mächtigen anpaßte. Wenn er auftrat und Allgemeinplätze rhetorisch gekonnt – ob er wie Brechts Arturo Ui Unterricht genommen hat? – als tiefe Weisheiten ins Mikrophon artikulierte, erkannte ich in ihm den talentierten Schauspieler. Wenn er auf der Bühne gestanden wäre, hätte ich ihn bewundern können – welche Rollen hätte er ausgefüllt! Vor dem Untersuchungsausschuß machte er auf mich den Eindruck eines Staatsschauspielers, der sich durch immer neues Extemporieren darüber hinwegmogelt, daß er seine Rolle nicht gelernt hat.
Dies ist das Tagebuch eines Läufers, wenngleich eines, der im Laufsport immer nur einen Teil seines Lebens, allerdings mitunter ein Vehikel seines Lebens, gesehen hat. Der Opportunist, der sich von einem Staatsinstrument beschützen läßt, das er einst mit Steinwurftraining und Prügelei mit Polizisten ruinieren wollte, ist auch in die Laufszene eingetreten, als sie zur Massenbewegung geworden war. Jeden anderen, auch Kriminelle, hätte ich hier willkommen geheißen. Bei diesem hier war mir nicht wohl. Die Überschwänglichkeit der Medien konnte ich beileibe nicht teilen. Hunderte von Politikern haben zum Laufen gefunden, Dutzende von ihnen haben einen Marathon bewältigt; diesem hier wurde attestiert, er habe die Deutschen zum Laufen gebracht. Wenn dies stimmen würde, müßte er jetzt die Nachahmer auch wieder vom Laufen weggebracht haben. Es schmerzt schon, wenn ein Autor sein Laufbuch über zweihunderttausendmal verkaufen kann, bloß weil er sich auf anderem Gebiet profiliert und es schließlich zum Außenminister gebracht hat. Ich zählte zu denjenigen, die gegen den Mitläufer kritische Distanz wahrten. Wir haben recht behalten. Das Lauftraining blieb eine Episode. Es liegt nahe, daß ein Außenminister kein Marathontraining mehr betreiben kann, es sei denn er habe inzwischen so viele Marathonläufe absolviert, daß er aus dem Stand starten könnte. Selbst als Redakteur einer Tageszeitung war es mir schwergefallen, meine Marathontermine durch Tausch der Sonntagsdienste freizuschaufeln. Aber was sich jetzt vollzogen hat, ein Dickerchen nähert sich wieder dem Jünglingsbildnis eines Dickerchens, zeigt uns, die wir den lebenslangen Sport empfehlen, daß Joseph Fischer gar kein Bewegungstraining mehr treibt. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, daß man, wenn man in der Woche zusammen zwei Stunden läuft und täglich zehn Minuten auf dem Hometrainer strampelt, selbst als Pykniker wieder soviel Fett speichert. Ein Minimalprogramm an Bewegungstraining wäre auch von einem Minister oder Manager zu bewältigen, käme das doch wieder der Funktion zugute. Seit ich Fischers jetziges Körperbild, das er im Untersuchungsausschuß ungeniert präsentiert hat, vor Augen habe, fühle ich mich in meiner Urteilskraft gestärkt. Den Satz, den Wolfgang Schäuble sagte, hatte ich genauso vorher schon im Familienkreise geäußert, Fischer könne nun die Fortsetzung schreiben: „Mein langer Weg zu mir selbst und zurück“.
Die Unsicherheit war groß, aber nun habe ich den Anschluß wieder, den ersten Marathon in diesem Jahr. Beschwerdefrei. Der Lauf ist mir leichter gefallen als im vorigen Jahr, der Ruhrmarathon – diesmal von Oberhausen nach Essen. Manche behaupten, die Strecke von Oberhausen sei schwerer als die von Dortmund, die ich im vorigen Jahr gelaufen bin. Da ich mir unsicher war, bin ich von Anfang noch verhaltener gelaufen als sonst, dafür gleichmäßiger, auf der zweiten Halbmarathonstrecke nur 4 Minuten langsamer als auf der ersten. Im vorigen Jahr bin ich in Essen, auf der langen Steigung, gegangen, in diesem Jahr nur einen ganz kurzen Abschnitt. Siehe da, der Lauf ist mir nicht nur leichter gefallen, sondern das Ergebnis ist auch nicht schlechter, fast dieselbe Zeit wie im vorigen Jahr, 8 Sekunden schneller.
In Oberhausen vor dem Start anderthalb Stunden gefroren. Ich alter Esel, was vergesse ich auch, Wegwerfklamotten mitzunehmen! Die Plasticplane war kein Ersatz für Wärmendes. Der Bahnhof bestand nur aus einer Unterführung. Die Bank war ebenso geschlossen wie die Geschäfte. Nirgends eine Gelegenheit zum Aufwärmen. In der Straße nach der Unterführung stand an der Bushaltestelle ein Polizeibus. Dorthin strebte ich, nachdem ich in der Unterführung mit einem Läufer ins Gespräch gekommen war. Mein Begleiter beging den Fehler, höflich zu fragen. Ein Blick genügte, und die Frage war als Scherz qualifiziert. Ich belehrte ihn, wenn man frech sein wolle, dann aber richtig. Fragen sei in solcher Situation verkehrt, wir hätten mit der größten Selbstverständlichkeit den Polizeibus, in dem sich offenbar eine Polizeimannschaft umzog, betreten müssen, dabei miteinander in ein Gespräch über unsere vorgebliche Dienststelle vertieft. Dann hätte vielleicht die Chance bestanden, daß wir stillschweigend als wenngleich unbekannte Kollegen akzeptiert worden wären. Ich fror weiter, bis mein Begleiter eine offenbar zum Malen benützte Trainingsjacke anschleppte; jemand hatte sie ziemlich früh ausgezogen und weggeworfen. Nun erfüllte sie zum zweitenmal ihren wärmenden Zweck. Ich zog sie erst aus, als der Startschuß ertönt war.
Festzuhalten bleibt: Unterwegs zweimal getrunken, zusammen anderthalb Becher Wasser. Die Marathon-Ratgeber, die nur selten einen Marathon gelaufen sind, mögen die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Im vorigen Jahr traf ich einen älteren Arzt, der wie ich die Hysterie des Zwei Liter am Tag verächtlich abtut; er läuft seinen Marathon, ganz ohne zu trinken.
Eine Laufbeschreibung erspare ich mir. Ich kann ja verstehen, daß die Menschen hier stolz auf ihre Region sind. Sie halten zusammen, weil nur das sie vor der Tristesse retten kann, ähnlich wie in manchen Quartieren New Yorks. Nur diese schrecklichen Übertreibungen! Da wird dreimal ein ordentlicher Marathon hingestellt, und schon wird der Ruhrmarathon in einem Atemzug mit New York und Berlin genannt. Vermutlich von Leuten, die sich nicht auskennen. Der erste Twin-Marathon der Welt – eine hübsche Idee, aber nicht im entferntesten ist sie hier notwendig. Im vorigen Jahr wurde getont, man erwarte 40000 Teilnehmer. In den Redaktionen wissen sie offenbar nicht einmal, was sie vor einem Jahr selbst geschrieben haben. Es kamen angeblich 32000, und das seien weit mehr als erwartet, las ich. Die Wahrheit ist: 40000 waren erwartet worden. Und an der tatsächlichen Zahl haben die Marathon-Teilnehmer einen ziemlich bescheidenen Anteil. In Dortmund starteten 5094 Läuferinnen und Läufer, die in Essen ins Ziel liefen; in Oberhausen waren es 3433, macht zusammen 8527. Die hätte man auch in einem einzigen Startfeld versammeln können, dies umso mehr, als die 1017 Halbmarathon-Walker uns in Oberhausen das Fortkommen erschwerten, ja, uns hinten geradezu blockierten. Dem Thema Läufer und Walker werde ich noch nachgehen. Der 3. Karstadt-Ruhrmarathon war ein Marathon und Halbmarathon mit hoher Publikumsresonanz, wenn man auf der Oberhausener Strecke die toten 7 Kilometer vom Halbmarathonziel bis zur Vereinigung mit dem Dortmunder Zweig hinter Gelsenkirchen außer Acht läßt. Aber als Twin-Marathon war er eine Schaumschlägerei. Um 8527 Marathon-Läuferinnen und -Läufer ins Ziel zu bringen, braucht man kein Spektakel mit zwei Startorten. Und die über eine Million Zuschauer? Ich habe meine Zweifel an der Zahl. Nach dem Halbmarathon schwenkten die Fahnenträger von Schalke ihre Vereinsfahnen müde und ziemlich einsam. Anzuerkennen bleibt, daß dort, wo sich die Menschen konzentrierten, das Publikum bis zum Ende ausharrte. Den Einlauf in Essen empfand ich als besser denn im vorigen Jahr am Berliner Platz, wenngleich die Fußgängerstraße zur Messe keinen angenehmen Untergrund für die müden Füße bot.
Zu der unkritischen Betrachtungsweise von Organisatoren und Medien paßt das Hornberger Schießen der Marathonläuferin Hera Lind. Die Schriftstellerin hatte zu ihrem ersten Marathon starten wollen, was zu einem Interview in „Marathon Spezial“ der WAZ führte. Ich kann mich nicht erinnern, daß um Günter Herburger jemals ein solcher Starkult betrieben worden wäre. Hera Lind stieg bei der Halbmarathonmarke aus. Der für Sport zuständige Landesminister, Michael Vesper, hatte auf einen schnellen und spannenden Marathon gehofft, „der an vielen Sehenswürdigkeiten des Ruhrgebiets entlang führt“ – sie sind mir sämtlich entgangen. Es hat etwas Rührendes, wenn die Leute trotz allem so begeistert sind.
Die Natur hat ihr eigenes Tagebuch. Erstaunlich, wie sie sich, jedenfalls um diese Jahreszeit, innerhalb von zehn Tagen fortschreiben kann! Es lohnte sich, für jeden Tag festzuhalten, was sich neu entfaltet hat. Ich laufe jetzt auf die Forsythien zu – alle paar hundert Meter ein leuchtendes Ziel. Die Kirschbaumblüte hat sich von Neckar und Rems ausgebreitet hinauf auf die Filder. Der Gärtner hat bei uns zwei Magnoliensträucher gesetzt. Wir hoffen, daß sie in vier Wochen blühen. Für solche Arbeiten müssen wir einen Gärtner beauftragen. An der Stelle, wo die Magnolien gepflanzt sind, stand ein Blauzederwacholder; doch längst war er nicht mehr blau, sondern in großen Partien braun. Er war nicht mehr zu retten. Die mächtige Wurzel hätte ich nicht ausgraben können. In manchem müssen wir uns helfen lassen. Wer uns die Rente neidet, die ohnehin infolge der Preiserhöhungen geringer geworden ist, sollte bedenken, daß wir heute Ausgaben haben, die wir früher nicht gehabt haben. Der Nistkasten auf dem Balkon ist bewohnt, für eine Weile darf Marianne dort keine Wäsche aufhängen. Wenn jedoch die kleinen Rotschwänzchen geschlüpft sein werden, lassen sich die Eltern nicht mehr stören. Der Brutpflegetrieb läßt sie jegliche Furcht überwinden. Die Emotionen, die das Schauspiel der Natur weckt, anhaltend im Fernsehen zu erreichen, müßte man sehr viel Mittel aufwenden. Ich kann nicht glauben, was ich neulich gelesen habe: Drei Stunden am Tage betrage der durchschnittliche Fernsehkonsum. Es geht nichts über eine life-Darbietung. Wenn wir laufen, können wir ihrer teilhaftig werden. Man muß dazu nicht einmal Dichter sein – „Frühling läßt sein blaues Band....“
Zweimal habe ich in den letzten Tagen eine Schafherde weiden sehen. Eine wurde von einer Schäferin beaufsichtigt. Ich habe noch nie einen Schäfer oder eine Schäferin bei ihrer Herde lesen sehen. Was denken Schäfer beim Hüten? Es müssen Philosophen sein, Stoiker vielleicht, nur so kann man einen Tag ohne jegliche Ablenkung verbringen. Der Hütehund ist intelligent. Der Hund lief auf einen Wink den Hang hinunter zum Bach, der nicht einsehbar ist. Der Hund sah nach, ob sich ein Schaf an den Bach verirrt habe. Sekunden später kam er zurück; mit seiner Unaufgeregtheit sagte er dem Schäfer: Alles in Ordnung. Wie bloß mag der Hütehund, der auch Schweine hütet, zu seiner sozialen Deklassierung gekommen sein? Der Schweinehund, der innere gar, ist zu einem Schimpfwort verkommen. In der Studentensprache des 19. Jahrhunderts hat es genistet. Ein General hat es im ersten Weltkrieg in seinen Sprachschatz aufgenommen. Für gedankenlose Läufer ist der innere Schweinehund ein geflügeltes Wort geworden. Gedankenlos deshalb, weil ein General Hütehunde verachtet hat, die nur dazu taugen, friedliche Schafe zu bewachen. Ein General braucht bissige Hunde. An der Zonengrenze wurden sie an langen Ketten gehalten, darauf gedrillt, Flüchtende anzufallen. Als ich nach dem Harzgebirgslauf mit der Harzquerbahn von Wernigerode durch das Sperrgebiet fuhr, habe ich bei Elend und Sorge solche abgerichteten Hunde gesehen. Arme Hunde! Schweinehunde hingegen sind Tiere von hoher sozialer Intelligenz. Wenn von einem inneren Schweinehund die Rede ist, kann nur das gemeint sein: soziale Intelligenz.
Als mich Walter Wagner beim 3. Marathon Deutsche Weinstraße um Mitarbeit bat – ich hatte keine Ahnung, was „Laufreport.de“ ist –, kam ich auf die Idee, ein öffentliches Lauftagebuch zu führen. Tagebuch zu führen und es später einmal zu veröffentlichen, ist eine klassische Mitteilungsform, vor allem von Schriftstellern. Thomas Mann hat sich nicht gescheut, leibliche Alltagsfreuden, seine hypochondrischen Beobachtungen und seine kleinen Eitelkeiten niederzulegen. Lauftagebuch zu führen, wird in jedem Anleitungsbuch empfohlen, allerdings in dem Sinne, daß man dieselben Erfahrungen nicht mehrfach machen muß. Manfred Steffny hat ein ganzes Läuferjahr in einem Lauftagebuch Revue passieren lassen. Meine Absicht war, weder über Kilometerzahlen Buch zu führen noch die Schuhmarken zu notieren, sondern vor allem das Erleben widerzuspiegeln, Erlebnisse am Rande zu schildern und aufzuschreiben, was mir durch den Kopf gegangen ist – keine Artikel, sondern ganz Unfertiges, Spontaneität als Prinzip. Laufen, schauen, denken, heißt das Motto. Damit glaubte ich, eine eigenständige Form gefunden zu haben, und vor allem glaubte ich, damit im Internet originell zu sein. Keine Spur – dem „Spiegel“ (2/2005) habe ich entnommen, daß ich einer aus der Schar von Millionen bin. Das Kunstwort für das, was ich mache, lautet „Blog“, eine Zusammensetzung aus Web und Logbuch. Als Epigone oder, um es mit einem vertrauten Begriff zu sagen, als Mitläufer fühle ich mich dennoch nicht. Ich habe ganz für mich eine Möglichkeit des Netzes entdeckt. Immerhin, der „Spiegel“ gibt die Zahl der Blogs vor zwei Jahren mit 500 an; ob meines mitgezählt worden ist, muß offen bleiben; schließlich erscheint es nicht isoliert, sondern im „Laufreport“. Heute seien es bereits 50000 Angebote, schreibt der „Spiegel“. Hätte ich mein Tagebuch für mich ins Netz gestellt, wäre es völlig untergegangen. Im „Laufreport“ ist es ein Element, eines unter zahlreichen. Das bedeutet, wen ich nicht zu fesseln vermag, klickt mich nicht unwirsch weg und läßt’s künftig ganz bleiben, sondern schweift zu einem anderen Thema im „Laufreport“. Ich erfülle mir mit dem Tagebuch ein Bedürfnis, nämlich Gedanken zu äußern, die man mir in einem Artikel wahrscheinlich nicht durchgehen ließe, schon weil sie manchmal gar nichts mit dem Laufen zu tun haben. Und gleichzeitig habe ich die Gewißheit, daß anders als die meisten 50000 Internet-Tagebücher meine Eintragungen wahrgenommen werden. Wahrgenommen zu werden, wollen wir alle.
Die Zeit fürs Tagebuch anderweitig verwendet, nämlich dafür, Fernsehsendungen über und zum Sterben des Papstes Johannes Paul II. zu sehen. Sensationsgier war es nicht, die Trauer eines Gläubigen auch nicht. Ich mußte mich mit der medialen Behandlung durch den Vatikan auseinandersetzen. Ich habe nun den Sinn dessen begriffen, daß uns ein todkranker Mann am Fenster gezeigt wurde. Manchesmal in den letzten Jahren war es mir peinlich gewesen, wenn ich einen Parkinson-Kranken auf dem Bildschirm hatte sehen müssen. Hätte er zurücktreten sollen? Er hat die Frage für sich beantwortet, und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, daß der leidende und der sterbende Papst uns etwas zu sagen haben. Gerade in einer Gesundheitsbewegung wie der Laufbewegung geraten wir in die Gefahr, Leiden und Sterben als Betriebsunfälle anzusehen, die es zu verhüten gelte. Das Ende von Johannes Paul II. hinterläßt Nachdenklichkeit, auch bei mir. Ich bin Zeitgenosse von sechs Päpsten gewesen. Pius XI., der meine katholische Erziehung begleitete, war fern, davor stand eine ganze Hierarchie. Wenn ich mich recht erinnere, lautete die Anrede des Papstes Eure Heiligkeit, die des Kardinals Bertram in Breslau Eure Eminenz, die des Pfarrers Hochwürden, und nur der Kaplan war der Herr Kaplan. Familiennamen hatten sie alle nicht. Pius XI. hatte das Reichskonkordat abgeschlossen, nichts weiter als ein Arrangement mit den Nazis. Hätte es damals eine moralische Instanz wie Johannes Paul II. gegeben, hätte es Hitler zumindest schwerer gehabt. Hitlers Ächtung wäre ohne diplomatische Beziehungen zu seiner Regierung und mit Boykott der Olympischen Spiele im Bereich der Möglichkeiten gewesen. Das Reichskonkordat bewirkte zum Beispiel, daß der Dienst in Jungvolk, Hitlerjugend und BDM nicht am Sonntagvormittag während der Kirchzeit stattfinden durfte. Auf solche Zugeständnisse konnte sich der Diktator leicht einlassen. Johannes Paul II. hätte wahrscheinlich kein solches Reichskonkordat abgeschlossen. Von den Päpsten, die ich erlebt habe, war er der erste, der den Menschen nahe war. Der Tragik allerdings, daß die katholische Kirche immer Jahrzehnte hinter dem Stand der Erkenntnis und der Entwicklung herhinkt, konnte auch er sich nicht entziehen.
Die beiden ersten Apriltage von Sonne erfüllt. Endlich konnte ich wieder so laufen, wie man im Sommer läuft, in der kurzen Sporthose und dem Funktionshemd. Die Baumwollhemden liegen im Schrank gestapelt, ich mag kaum noch anderes anziehen. Auch die ersten Radfahrer strampeln mit bloßen Waden. Der Schnee ist, zumindest im Tagebuch, noch ganz nah in der Erinnerung, – um so überraschender das Blühen, Narzissen in ganzen Rabatten, Gänseblümchen über die ganze Wiese.
Laufen als Trost unter Widrigkeiten. Die Steuererklärung begonnen. Dringender Besuch beim Zahnarzt. Und in derselben Woche ein harsches Dementi von Dr. Ulrich Strunz, er habe keinen Herzinfarkt gehabt. Im April-Heft von „Runner’s World“ habe ich die Meinung vertreten, Laufen allein genüge nicht, gesund zu bleiben. Das habe ich mit einer Anzahl von Todesfällen und Herzerkrankungen prominenter Sportler zu belegen versucht. Vor Jahren habe ich Material zu sammeln begonnen. In meiner Kolumne habe ich auch Dr. Strunz erwähnt: „Dr. Ulrich Strunz, den die Medien in Unkenntnis auf den Thron eines ,Fitnesspapstes’ gehoben haben, wird ein Herzinfarkt im Jahr 2003 zugeschrieben. Genaues weiß man nicht, Neidkomplexe sind in der Tat nicht auszuschließen – nur, warum stellt sich ein rüstiger Sechzigjähriger, der lauthals mit der Devise ;Forever young’ zum Laufen gelockt hat, keinem Wettkampf mehr?“ Etwas genauer hätte ich’s wissen können; auf der Website des Dr. Strunz habe ich schlicht die Nachricht übersehen, daß sich Dr. Strunz eigens kardiologisch habe untersuchen lassen und der Befund nicht im geringsten die Spuren eines Infarktes erkennen lasse. Es ärgert mich schon, daß mir dieser Fehler bei der Recherche unterlaufen ist und ich mich auf drei mündliche Bestätigungen aus der Szene verlassen habe. Zweierlei Erkenntnis – nun habe ich wenigstens eine eindeutige Aussage: kein Infarkt. Aber für mich erhebt sich die Frage, die noch wichtiger ist: Wer hat ein solches Gerücht, das schließlich zur Nachricht geronnen ist, in die Welt gesetzt, wer hat ein Interesse daran gehabt? Wieso konnte sich das Gerücht derart verbreiten, selbst nach den Dementis von Dr. Strunz? Die Kriminalisten unter uns sind gefragt.
Zu allem Überfluß: In der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung gärt es. Für mich auch hier wieder nur diffuse Information, nämlich über Gründe, die zu der Forderung geführt haben, eine Außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Das Forum der Website ist geschlossen. Viele Fragen offen, das Präsidium sollte sie aufarbeiten und nach seiner Sitzung am 10. April an die Öffentlichkeit treten.
„Psychologie heute“, die sich immer mehr mit Fragen auch der leiblichen Gesundheit befaßt hat, bringt im April-Heft ein Interview mit Dr. Manfred Lütz, dem Chefarzt des Alexianer-Krankenhauses in Köln. Von ihm liegt, wie ich der Veröffentlichung entnommen habe, ein Buch vor: „LebensLust – Wider die Diätsadisten, den Gesundheitswahn und den Fitneßkult“. Dr. Lütz hat auch Theologie studiert, für einen Theologen mögen manche Thesen schon akzeptabel sein: „Mein Eindruck ist, daß die Leute heutzutage nicht mehr an den lieben Gott glauben, sondern an die Gesundheit.“ Aber wenn ein Arzt von „Gesundheitswahn“ schreibt, übersieht er schlicht, daß viele Erkrankungen vermeidbar sind. Es ist vernünftig, sie durch Aufklärung zu vermeiden. Dr. Lütz wirft alles Mögliche in einen Topf. „Und so rennen die Leute durch die Wälder, essen Körner und Schrecklicheres – und sterben dann doch. Der monströse Kult der Gesundheitsreligion, der mächtigsten und teuersten Weltreligion aller Zeiten, scheitert erbärmlich.“ Herr Dr. Lütz übersieht bei seiner Rechnung, daß um Gesundheit anders als um Religionen keine Kriege geführt worden sind. „Alle Phänomene der Religion sind inzwischen restlos im Gesundheitswesen angekommen, und wie jede andere Religion erfaßt die Gesundheitsreligion das ganze Leben. Es gibt Gesundheitspäpste, Fitneßgurus, Irrlehren, die mit inbrünstiger Gläubigkeit von kleinen, verschworenen Gemeinschaften geglaubt werden. Es gibt Missionskampagnen, staatlich geförderte Erweckungsbewegungen und die volksmissionarischen Großereignisse namens Städtemarathon.“ Als ob Städtemarathons auch nur das geringste mit Gesundheit zu tun hätten, außer daß der Straßenverkehr ruht! Gerade rüstet sich die Bundesregierung dazu, mit einem Präventionsgesetz die Erweckungsbewegungen weiter zu fördern. Herrn Dr. Lütz ist allerdings „keine einzige Studie bekannt, die nachweist, daß gesundheitsbewußtes Verhalten den Staat wirtschaftlich entlastet. Im Gegenteil: Wenn jemand mit 41 Jahren am Bronchialkarzinom stirbt, dann kostet er die Solidargemeinschaft wahrscheinlich weniger, denn er wird all die teuren Alterskrankheiten nicht bekommen“. Leute, dann raucht und sauft doch und laßt uns auch die Zahl der Diabetiker vermehren, vielleicht sterben die ja doch „sozialverträglich“ früher! Der Chef vom Dienst der „Stuttgarter Zeitung“ hat, als ich dort war, ähnliche Gedanken zur Gesundheitspolitik vertreten. Schon vor über dreißig Jahren. Er ist dann in der Tat vor Erreichung des Durchschnittsalters gestorben, aber erst nach einigen, wie ich annehme, kostspieligen Bypaß-Operationen. Die 20000 Raucherbein-Amputationen im Jahr geschehen ja wohl auch nicht kostenlos. Was eigentlich hat Herr Dr. Lütz, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, dagegen einzuwenden, gesund zu sterben? Ich kann mir nicht vorstellen, daß Papst Johannes Paul II. nicht gern auf sein Leiden verzichtet hätte, wenn er es hätte abwenden können.
| Zu weiteren Tagebuch-Eintragungen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | |
| 2016 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2015 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2014 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2013 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2012 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2011 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2010 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2009 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2008 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2007 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2006 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2005 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2004 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2003 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2002 | Alle Eintragungen HIER | |||
| Zurück zur den aktuellen Eintragungen HIER | ||||
| Zu weiteren aktuellen Inhalten bei LaufReport.de | ||||