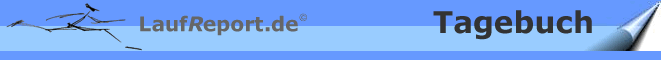

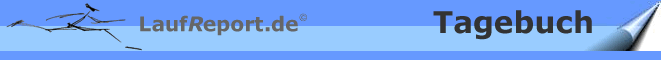  |
|
Laufen, Schauen, Denken Sonntags Tagebuch |
 |
Die letzte Todesnachricht ist gerade einmal zwei Tage alt. Das veranlaßt mich zu einem Rückblick. Die Frau eines ehemaligen Läufers hat mir auf meinen Weihnachts- und Neujahrsglückwunsch den Tod ihres Mannes mitgeteilt.
Der Name wird in Deutschland wohl niemandem etwas sagen, im schweizerischen Kanton Freiburg/Fribourg jedoch sehr vielen. Dort ist am 22. Februar 2014 der Rechtsanwalt und Notar Hermann Bürgy im Alter von 83 Jahren gestorben. Hermann Bürgy und ich standen seit etwa dreißig Jahren in einer losen Verbindung miteinander. Sie beschränkte sich in der Hauptsache darauf, daß er vor dem Start des 100-Kilometer-Laufs nach Biel reiste, mit mir die Abendmahlzeit, bestehend aus Spaghetti, einnahm und mich nach dem Bestehen der 100 Kilometer telefonisch beglückwünschte, sowie auf ein, zwei Anrufe im Jahr und den Austausch von Weihnachtsglückwünschen. Versteht sich, daß Hermann Bürgy Läufer war und nur etwas früher als ich hatte aufhören müssen, jedoch schwimmend Gesundheitssport betrieb. Er war einst die 100 Kilometer von Biel gelaufen und schätzte mein „Irgendwann mußt du nach Biel“. Das hatte ihn veranlaßt, die Verbindung zu mir aufzunehmen.
 |
Das wiederum war typisch für ihn. Früher hätte man ihn als Philantropen bezeichnet. Die „Freiburger Nachrichten“ überschrieben ihren Nachruf mit „Ein großer Menschenfreund ist tot“. Der Nachruf beginnt mit den Worten: „Wenn Hermann Bürgy diese Zeilen lesen könnte, würde er abwinken: Er war nämlich keiner, der sich in den Vordergrund drängte. Er liebte es, gesellige Anlässe zu organisieren und Leute zusammenzubringen, die sich sonst vielleicht nie begegnet wären. |
|
|
Treffen in der Eishalle von Biel im Jahr 2002: Rechts
Herman Bürgy, zweiter von links der Autor.
|
Er war ein großes Organisationstalent und hatte die Gabe, Menschen für eine Sache zu mobilisieren: für Lesungen, Vorträge, ein Orgelkonzert in der Kathedrale, regelmäßige Apéro-Runden im Schönbergquartier oder ein sportliches Ereignis. Hartnäckig fragte er nach und ließ ein Nein nicht gelten, wenn jemand zögerte. Sobald es dann soweit war, saß er in der hintersten Ecke, verhielt sich ruhig und genoß es, seinen Gästen beim Diskutieren zuzuschauen.“ Genauso habe ich ihn bei unserem jährlichen Treffen – immer mit Sportfreunden – oder bei meinem Besuch in Freiburg erlebt. Schweizer Spitzenläufer habe ich auf diese Weise kennengelernt. Meine beiden Bände „Mehr als Marathon“ waren 1986 zum Murten-Lauf im Schaufenster einer Freiburger Buchhandlung ausgestellt; das war Hermann Bürgys Werk.
Weshalb erzähle ich das alles, obwohl ihn kaum ein deutscher Läufer der Gegenwart gekannt hat? Ich meine, meine Verbindung zu ihm ist ein Beispiel für Kontakte im Laufsport, für reale und für mögliche. Wir sollten, wie Hermann Bürgy, einen Blick dafür haben.
Seine Todesnachricht, die ich jetzt erhalten habe, hat mir zudem den Generationenwechsel im Laufsport deutlich gemacht. Einige Monate nach Hermann Bürgy, am 26. Juli 2014, ist Hanny Lambert im Alter von 91 Jahren gestorben, die Frau des Trainers und IGÄL-Vorsitzenden Arthur Lambert, der biographisch die Brücke zwischen dem Ausdauertraining der zwanziger Jahre und der Laufbewegung nach dem zweiten Weltkrieg geschlagen hat. Sie ist ein prominentes Beispiel für die vielen Läuferfrauen, denen über ihre Männer die Laufbewegung ihre Entwicklung zu verdanken hat. Sie sind kaum an die Öffentlichkeit getreten, aber sie haben das Werk ihrer Partner unterstützt, angeregt und diskutiert. Ich selbst bin Hanny Lambert nur wenige Male begegnet, aber ich weiß, nicht zuletzt dank meiner Frau, wie wichtig es ist, daß der Ehepartner eine Aktivität mitträgt. Der IGL-Vorsitzende, Peter Bayer, hat Hanny Lambert im November-Heft von „Laufzeit & Condition“ gewürdigt.
Zuvor, am 30. März 2014, hat uns Dr. Dieter Maisch, Neurologe in Kirchhem u. T., im Alter von 96 Jahren verlassen. Er hat mich, wie auch andere Patienten, 1966 zum Laufen veranlaßt. Seine Verdienste um den Laufsport sind durch die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft im Deutschen Verband langlaufender Ärzte und Apotheker gewürdigt worden.
Viel zu früh hat Dr. Karl Lennartz, der für die Geschichte des Laufens wohl wichtigste Sporthistoriker, am 2. Mai sein Leben beenden müssen. Er hat, wie ich an dieser Stelle festgehalten habe, Wissenschaft und Laufpraxis miteinander verbunden.
Wenn wir ein Jahr zurückgehen, dürfen auf diesem Gedenkblatt Dr. Hans-Henning Borchers, der Gründungsvorsitzende des Deutschen Verbandes langlaufender Ärzte und Apotheker, und Heinz Spies, Pionier des norddeutschen Volkslaufs und IGL-Mitarbeiter, nicht fehlen. Borchers ist am 21. September 2013 im Alter von 72 Jahren gestorben, Heinz Spies am 10. April 2013 im Alter von 78 Jahren.
An diesen Namen wird deutlich, daß wir die Ablösung einer ganzen Generation von Pionieren der zweiten Läufergeneration, deren Aktivitätsbeginn ich auf die Zeit der ersten Volksläufe definieren möchte, erleben müssen.
Photo: Sonntag
Das Weihnachtsgeschenk traf pünktlich ein, die Ausschreibung zu den Bieler Lauftagen. Ich habe sie wirklich als Geschenk empfunden. Wie das? Schließlich habe ich doch nach dem 35. Start die Teilnahme am 100-Kilometer-Lauf bei Kilometer 76 aufgeben müssen. Da war ich – wenige Tage später – 84 Jahre alt, und die 21 Stunden lagen jenseits meines Leistungshorizontes. Die Alternative, den Marathon, hätte ich auch nicht mehr laufend geschafft. Die letzte Möglichkeit, Walking bis Aarberg, schied, wie sich zeigte, ebenfalls aus. Zwei Runden in der Stadt Biel spazieren zu gehen – das war fortan das sanfteste Angebot – , kam für mich nicht in Frage. Und so bin ich in den Jahren 2013 und 2014 gar nicht erst nach Biel gefahren.
Verzeihung, ich muß mich jetzt selbst zitieren. Am 20. Dezember 2011 beschrieb ich die Lage so: „Im Grunde jedoch fehlt es unserer Altersklasse an altersgerechten Wettbewerben, die auch im Gehschritt noch bewältigt werden können. Stadtmarathone wird man, wegen der Straßen und des Abbaus der Infrastruktur, nicht länger offen lassen können. Anspruchsvolle Landschaftsmarathone lassen sich nicht so lange überwachen. … Leider ist auch die Schlußzeit von 3:45 für das Halbmarathon-Walking von Biel nach Aarberg für Hochbetagte viel zu kurz.“
Eine altersgemäße Möglichkeit, an einer Laufveranstaltung teilzuhaben, sind die Wanderungen über 36 und über 17 Kilometer beim Rennsteiglauf. Dort bin ich in den letzten drei Jahren gewandert und werde dies auch im nächsten Jahr wieder tun. Die Überraschung jedoch: Für 2015 bietet nun auch Biel eine Wanderung über 13,6 Kilometer an. Es ist die Walkingstrecke nach Aarberg, jedoch ohne die beiden Runden durch die Innenstadt von Biel und mit einem Zielschluß erst nach viereinhalb Stunden. Damit ist Biel für uns ehemalige 100-Kilometer-Teilnehmer wieder interessant geworden, wenn man davon absieht, daß für den „Nacht-Erlebnislauf“ bis zum 22. April 42 Franken oder danach bis zum 26. Mai 52 Franken zu zahlen sind. Inbegriffen ist allerdings die Fahrt mit dem Shuttle-Postbus zurück nach Biel.
Der Erlebnislauf wird in der Ausschreibung so geschildert: „Teilnehmen und genießen sind wichtiger als Zeit und Rang. Ideal für ambitionierte Walker/innen und Genußläufer/-innen, die auf der Originalstrecke das 100-km-Feeling erleben wollen.“ Für uns Ehemalige kommt das nostalgische Moment hinzu, die Erinnerung, der wir uns auf dem Weg nach Aarberg hingeben können. Eingebunden in den aktuellen Lauf sind wir dadurch, daß wir eine Stunde früher starten und daher von dem größten Teil des Feldes eingeholt werden. Ich hoffe ja, daß die Überholenden keine Schwierigkeiten mit uns haben werden.
Mit dem „wir“ greife ich vor: Versteht sich, daß ich im nächsten Jahr wieder einmal nach Biel fahren werde. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!
Seit dem 12.Dezember liegt wieder der DLV-Laufkalender bereit, jener Kalender, zu dem einst Otto Hosse, der Veranstalter des ersten deutschen Volkslaufs und der erste Bundesvolkslaufwart des DLV, jedes Jahr das Vorwort beigesteuert hatte. Das Vorwort war jedesmal ein Lagebericht der Volkslaufbewegung. Für Läufer, die den Reiz des Wettbewerbs entdeckt hatten, war der Volkslaufkalender ein wichtiger Leitfaden. Man muß sich vorstellen, wie wir damals, hungrig nach Laufterminen, jedes Jahr auf ihn gewartet hatten! Er war die einzige umfassende Termin-Quelle gewesen.
Heute rühmt sich der DLV, es sei der größte Laufkalender. Mag sein. Aber entspricht er den praktischen Bedürfnissen von Läufern? Er ist wie ein normaler Kalender chronologisch geordnet. Man kann ihn unter der DLV-Website „laufen.de“ anklicken, dann erscheinen in zeitlicher Ordnung die kalendarisch nächsten Lauftermine. Lauftermine? „Alle“ steht da; wer jedoch die Fülle des Materials reduzieren möchte, kann sich auch nur auf die Suche nach 5-Kilometer-Läufen, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon beschränken. Ist da nicht noch etwas? Die Rubrik „Ultramarathon“ fehlt. Und dies, obwohl sich geradezu eine Welle von Ultraläufen über die Läufer ergießt.
Früher konnte ein Ultraläufer die im Bundesgebiet veranstalteten Ultraläufe ohne großes Nachdenken aufzählen. Das ist heute nicht mehr möglich. Man muß sich nur den stattlichen Kalender ansehen, den die Deutsche Ultramarathon-Vereinigung auf ihrer Seite unter „Statistiken“ anbietet und ständig aktualisiert. Allerdings erfaßt dieser Kalender alle, zumindest nahezu alle Ultramarathons in der Welt. Das ist im Zeitalter des Lauftourismus sinnvoll. Veranstaltungen in der Schweiz, in Elsaß-Lothringen und in Österreich sind auch früher schon von vielen Deutschen besucht worden.
Doch auf der Internetseite des DLV habe ich die Bieler Lauftage nicht gefunden. Die Suchfunktion bleibt ergebnislos. Mache ich irgend etwas verkehrt? Es könnte sein, daß sich der Deutsche Leichtathletik-Verband auf die deutschen Laufveranstaltungen beschränken muß. Das wäre kurzsichtig. Der Swiss Alpine Marathon und der Jungfrau-Marathon, vielleicht auch der Ultramarathon über den Petit Ballon, der Marathon in Zürich und in Wien, der Ultramarathon in Salzburg und … und … dürften deutsche Läufer bei weitem mehr interessieren als ein 5-Kilometer-Lauf in Kleinkleckersdorf. Zu Recht blicken die Redakteure von Laufzeitschriften bei ihren Veranstaltungskalendarien immer auch über die Grenzen, treffen dafür jedoch eine Auswahl unter den Laufveranstaltungen. Der Laufkalender zum Beispiel von „Runner’s World“ (Januar-Heft) enthält nur Marathons.
Suchen wir also im DLV-Laufkalender nach deutschen Veranstaltungen! Ich gebe „Röntgenlauf“ ein, dann Schwäbische-Alb-Marathon, später „Taubertal“ – die Ergebnisseite auf „laufen.de“ bleibt jedesmal leer. Beim Schlagwort „Ultramarathon“ erscheint allein der 50-Kilometer-Lauf von Rodgau. Selbst wenn der gedruckte Laufkalender diese Veranstaltungen enthalten sollte, wären sie nicht erkennbar, sofern man nicht deren Termine weiß. Anderenfalls müßte man das Kalendarium von etwa 3400 Veranstaltungen durchforschen. Beim Schwäbische-Alb-Marathon muß man den Start- und Zielort Schwäbisch Gmünd nennen, dann wird man fündig, denn die Veranstaltung heißt „Sparkassen Alb Marathon Schwäbisch Gmünd“. Wem als Bewohner nördlicher Gefilde Schwäbisch Gmünd nicht einfällt, hat Pech gehabt, so wie ich beim Röntgenlauf, weil ich als in Südwestdeutschland Lebender den Startort nicht parat gehabt habe.
Gebraucht man die Suchfunktion, sollte man tunlichst den korrekten Namen der Veranstaltung eingeben. „Hamburg-Marathon“ zum Beispiel führt nicht zum Ziel. Wer also den Hamburg-Marathon sucht, gebe unter „Ort“ „Hamburg“ ein und nicht „Hamburg-Marathon“ unter „Event“. Das Verfahren klappt jedoch nicht immer. Ich tippe „Görlitz“ ein, wo im nächsten Jahr der 12. Europa-Marathon durch Görlitz diesseits der Neiße und durch Zgorzelec auf der polnischen Seite der Neiße stattfindet. Doch auf meine Eingabe nennt ihn das Kalendarium nicht ̶̶ weder unter „Veranstaltung“ noch unter „Ort“. In Pirna wird der Halbmarathon nach Dresden gestartet; doch wenn ich als Ort „Pirna“ eingebe, erscheint ebenfalls nichts. Bei der Ortsangabe ist es erfahrungsgemäß sinnvoll, bei der Eingabe einen Umkreis von 50 Kilometern einzubeziehen. Dann hat man allerdings, wie beim Hamburg-Marathon, Dutzende von Veranstaltungen.
Der Remstal-Marathon soll im Jahr 2015 in umgekehrter Richtung gelaufen werden, nämlich von Schwäbisch Gmünd nach Waiblingen. Doch Fehlanzeige bei allen Suchkriterien. Allerdings habe ich auch keine andere Website als die des Remstal-Marathons 2014 gefunden. Dafür ist der Veranstalter verantwortlich – ein dicker Negativpunkt für die beiden Kommunen. Wer im Jahr 2015 einen Lauf veranstaltet, sollte spätestens jetzt aktuell im Netz sein.
Nun habe ich beim DLV-Laufkalender keineswegs mühsam nach Fehlern gesucht, sondern einfach probehalber eingegeben, was mir an Veranstaltungen gerade in den Sinn kam. Das Ergebnis ist so, daß ich ob der zufälligen Fehlerquote ziemlich überrascht bin. Kann ja sein, daß es schwierig ist, Veranstaltungen im Internet auffindbar zu programmieren. Aber hätte man nicht, wie ich auch, Eingabe-Proben machen und bei negativem Ergebnis die Fehlanzeigen korrigieren können?
Einen Menschen, der dem DLV noch weniger als früher über den Weg traut, muß ein Verdacht beschleichen: Womöglich ist man bei „laufen.de“ von der Laufbewegung doch ein Stück weit entfernt, auch wenn die vertrauliche Anrede „Du“ auf der PR-Seite „laufen.de“ das Gegenteil suggeriert.
Doping ist immer ein Thema, leider auch im Laufsport. Ist es Zufall oder Absicht? Da wir am Rande eines Kalten Kriegs mit Rußland – oder sagen wir besser: mit Putin? – leben, paßt das Thema haargenau in die politische Landschaft: Wie Rußland seine Sieger macht. Es macht seine Sieger mit Doping; diese Behauptung legt ein Film des ARD-Dopingexperten Hajo Seppelt nahe, der am 3. Dezember im eher unauffälligen Vorabendprogramm ausgestrahlt worden ist.
Seppelt hat mit seinem Team – nach Angabe der ARD – „exklusive Einblicke in ein Sportsystem, das sonst völlig unzugänglich ist“, präsentiert. „Autor Hajo Seppelt liefert zahlreiche Hinweise, geheime Aufzeichnungen und ernüchternde Fakten, die wohl viele der russischen Sporterfolge erklären.“ Im Kern beruhen seine Recherchen auf den Aussagen des Ehepaars Stepanov und der Marathonläuferin Liliya Shobukhova. Julia Stepanova war unter ihrem Mädchennamen Rusanova eine Spitzenathletin auf der 800-Meter-Strecke. Witali Stepanov hat früher für die russische Doping-Agentur gearbeitet. Liliya Shobukhova hatte russischen Leichtathletik-Funktionären 450.000 Euro Schmiergelder gezahlt, um trotz verdächtigen Blutwerten bei den Olympischen Spielen 2012 in London starten zu können. Hier gab sie jedoch im Marathon wegen einer Verletzung auf. Im April dieses Jahres wurde sie wegen Dopings gesperrt. Daraufhin verlangte sie die Schmiergelder zurück und erhielt offenbar nach internationaler Intervention tatsächlich zwei Drittel davon zurückgezahlt.
Die Aberkennung der Siege Shobukhovas in Chicago und bei den World Marathon Majors bedeutet nach der von germanroadraces verbreiteten Meldung des race-news-service, daß die in Deutschland eingebürgerte Irina Mikitenko nachträglich zur Siegerin des Chicago-Marathons 2009 und der World Marathon Majors-Serie 2009-2010 erklärt werden wird.
Die Aussagen Shobukhovas, des Ehepaars Stepanov und der 800-Meter-Olympiasiegerin Marija Savinova, die ein anaboles Steroid genommen hat, belasten leitende Funktionäre des russischen Leichtathletik-Verbandes, die russische Anti-Doping-Agentur und das russische Doping-Kontrolllabor. Der Internationale Leichtathletik-Verband (IAAF) und das Internationale Olympische Komitee (IOC) kündigten Untersuchungen an. Soweit die Fakten.
Die Reaktionen in der Weltöffentlichkeit sind unterschiedlich; sie reichen von Zurückhaltung und Abschwächung bis zum Aufgeschrecktsein. Laut dpa verlautete die russische Anti-Doping-Agentur Rusada, es gebe keine Tatsachen und keine Originaldokumente, die einen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln belegten. Die von Seppelt zitierten Zeugen werden, da sie wegen Dopings gesperrt seien, als wenig glaubhaft hingestellt. In der Tat haben die Läuferinnen ja durchaus in den Betrug eingewilligt.
Andererseits enthüllt der Film, daß es in Rußland offenbar ein ganzes Netzwerk von Doping und Korruption im Sport gibt. Aber eben, was nur im letzten Satz erwähnt wird, nicht nur in Rußland. Diese Auffassung hat auch der Sportsoziologie-Professor Helmut Digel, früherer Präsident des DLV und langjähriges Mitglied im Council der IAFF, in einem Interview des FAZ-Sportjournalisten Michael Reinsch vertreten. Eine Konstellation wie in Rußland, das kriminelle Zusammenwirken von Medizinern, Pharmazeuten und Athleten, gebe es in nahezu allen Hochleistungssportnationen der Welt. Die Frage „Auch in Deutschland?“ bejahte Digel eindeutig. Zwar habe sich die Situation seit dem Skandal an der Freiburger Universität verbessert, aber „Doping-Mißbrauch im deutschen Hochleistungssport von heute kann jedoch nicht ausgeschlossen werden“. Digel ist überzeugt davon, daß Rußland eine volle Aufklärung betreiben werde, einfach weil es sich einen Reputationsverlust im Sport nicht leisten werde.
Mein persönlicher Kommentar: Skepsis. Es hat zum Beispiel in Deutschland, einem Land von hohem Organisierungsgrad, mehrmals Ansätze eines gründlichen Nachdenkens über Doping und seine Vermeidung gegeben, jedesmal ausgelöst durch einen Skandal wie die Enthüllungen über das Doping in der DDR, den Fall Dieter Baumann, die Machenschaften an der Universität Freiburg i. B. Doch den Wettlauf mit den Doping-Fahndern haben die Kriminellen im Prinzip immer gewonnen. Die Bekämpfungsmethoden mögen immer mehr verfeinert worden sein, aber das Unrechtsbewußtsein im Sport schwindet. Wer heute zu einem erlaubten Mittel greift, um seine Leistung angeblich zu steigern oder zu erhalten, der wird morgen vor einem verbotenen Mittel nicht Halt machen. Wir haben im Amateursport allen Anlaß, uns auch mit dem zu befassen, was im professionellen Sport vor sich geht.
Mein Fernsehkonsum ist quantitativ weit unterdurchschnittlich. Doch das versteht sich in einem Läuferhaushalt. Es gibt nur eine einzige Sendung, die wir uns täglich zu Gemüte führen, das sind die Nachrichten, genauer – da wir der Uhrzeit wegen die Nachrichten des ZDF vorziehen – die „Heute“-Sendung. Freilich, auf die Sekunde genau vermag ich das Gerät nicht einzuschalten; dazu geht meine Läuferuhr zu ungenau, sie geht vor. Also bekommen wir zu sehen, was wir nicht sehen wollen: die Reklame. Ich schalte dann sofort den Ton aus. Angeblich drückt die Hälfte der Fernsehzuschauer, wenn Werbung erscheint, sofort auf die Taste, die den Kanal stumm macht. Frage an das nächste kommunikationswissenschaftliche Seminar: Gehören Leute, die bei Werbung nur den Ton abstellen, zu den 50 Prozent Verweigerern oder nicht? Wie kann man uns statistisch erfassen? Vermutlich gibt es dringendere Fragen.
Fernsehwerbung ist ein Diskussionsthema. Da sie hochproblematisch ist, wie sich an den Werbe-Unterbrechungen von Spielfilmen im privaten Fernsehen zeigt, ist sie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen reguliert. Das öffentlich-rechtliche Ärgernis für viele Zuschauer ist damit jedoch nicht beseitigt. Fachleute wie der einstige Verfassungsrichter Professor Paul Kirchhof haben daher vorgeschlagen, ARD-Sender und ZDF werbefrei zu machen. Eine Kontrollkommission hat errechnet, daß der finanzielle Ausgleich der Werbeeinnahmen die Gebührenzahler je 1,25 Euro im Monat kosten würde. Da die zwangsweise Gebührenabgabe seit der Gebührenumstellung auf 17,98 Euro je Monat und Wohnung einen Mehrertrag von 75 Cent erbracht hat, würde sich der Mehrbetrag auch noch reduzieren. Die Werbefreiheit würde mit Sicherheit einen Gewinn für das Programm der öffentlich-rechtlichen Anstalten bedeuten. Der zumindest geheime Druck auf die Programm-Macher, die Zuschauer durch crime-Sendungen an den Bildschirm zu fesseln und der Werbung auszusetzen, fiele weg. Vielleicht ließe sich dann ja auch mal wieder die Übertragung von Formel-1-Rennen durch Massen-Ereignisse wie einen City-Marathon und Berichte über Volkssport-Veranstaltungen ersetzen.
Neulich habe ich acht Tage lang nicht nur den Ton nicht abgestellt, nein, ich habe das Fernsehgerät so früh eingeschaltet, daß ich sämtliche Werbespots vor der „Heute“-Sendung sehen konnte. Was heißt „konnte“? – ich mußte, weil ich darüber schreiben wollte. Nach den Nachrichten habe ich den Ton ebenfalls nicht abgestellt, weil ich auch die Werbung bis zum Wetterbericht aufnehmen wollte. Mag sein, daß mir damit eine masochistische Neigung zu diagnostizieren ist. Sei’s drum – konkret wollte ich wissen, was beworben wird. Denn auch bei abgestelltem Ton war mir aufgefallen, daß die Werbespots auffallend häufig einer bestimmten Produktgattung zuzuordnen sind. Allzu häufig war beim Anschalten der in jeder Hinsicht graue Hinweis „Bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ zu sehen. In jedem Werbeblock erscheint er mehrfach, immer mit demselben Standard: Sehr viel schneller als der Nachrichtentext, wenn nicht so schnell wie nur irgend möglich und so unbetont wie möglich gesprochen. Eine lästige Pflichtübung offenbar, für die auch nicht gezahlt werden muß. Wahrscheinlich ist sie so wirkungsvoll wie der Hinweis auf der Zigaretten-Reklame, daß Rauchen tödlich sein könne.
Meine Buchführung hat ergeben, daß die Fernsehwerbung zum überwiegenden Teil aus der Reklame für freie Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika und sonstige Gesundheitsleistungen, zum Beispiel für die „Apotheken-Rundschau“, besteht. Nun muß man sich überlegen, daß jede Sekunde Werbung den Auftraggeber Geld kostet, nämlich einige hundert Euro. Präzisieren kann ich das nicht, weil die Sendepreise schwanken. Am teuersten ist der Monat November. Auf jeden Fall müssen Werbekunden mindestens einen Monat lang mindestens 20 Sekunden belegen. Im September hatten die 20 Sekunden je Woche 147.600 Euro gekostet. Da versteht sich, daß unverarbeitete Lebensmittel nicht beworben werden; bei ihnen wird zu wenig Geld verdient. Hochwertige Wirtschaftsgüter dagegen wie ein neues Automodell bilden einen Schwerpunkt. Was man zum Leben wirklich braucht, kommt in der Werbung nicht vor. Der andere Schwerpunkt sind die pharmazeutischen Produkte. Wenn man sich die Werbekosten dafür vor Augen führt, kann man wahrscheinlich ermessen, was mit diesen Produkten verdient wird. Die Werbesendungen in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten sind nicht nur finanziell die reinen Apotheken. Da werden Rückenbeschwerden therapiert, Gelenkschmerzen eliminiert, Verstopfungen beseitigt, Kopfschmerzen zum Verschwinden gebracht, Übergewicht reduziert, das Einschlafen gefördert, Eiweiß zugeführt, die Durchblutung angeregt, Zahnstein aufgelöst, Fußpilz bekämpft, die Venen in Ordnung gebracht, Streß beseitigt, Falten geglättet, das Haar geschönt – was weiß ich, was es noch alles gibt, das über die Fernsehkanäle beworben wird!
Kommt denn niemand, wenn er das sieht, auf den Gedanken, daß ein ganzer Berufsstand ausgedünnt würde, sofern nämlich die Werbeversprechungen gehalten werden könnten! Wenn Werbung tatsächlich Information bedeutete, als die sie sich allzu oft ausgibt, dann müßte gesund zu leben ein Kinderspiel sein.
Denken wir weiter, nämlich an all die Nahrungsergänzungsmittel, die deren Hersteller den Läufern anempfehlen, dann müßte sich das Leistungsniveau in der Laufbewegung sprunghaft vergrößert haben, müßten die Klagen über Schmerzen und Krämpfe überflüssig sein.
Es gibt eine ganz simple Lebensregel angesichts des nach dem Werbeumfang riesigen Angebotes problematischer Produkte. Sie stammt von meinem Gesundheitslehrer Dr. med. Max-Otto Bruker. Er – einer der wenigen Ärzte, die keine Symptombekämpfung praktiziert haben, sondern zu den Ursachen von Erkrankungen und Beschwerden vorzudringen bestrebt gewesen sind – pflegte seinen Schülern auf den Weg zu geben: „Essen und trinken Sie nichts, wofür Reklame gemacht wird!“
Vor vielen Jahren schon – ich erinnere mich gut – fiel beim Deutschen Leichtathletik-Verband die Äußerung, man müsse die Läufer „wieder einfangen“. Damals bereits ist in Darmstadt erkannt worden, daß die Laufbewegung dem DLV entglitten ist. Das freilich hat sich der Verband selbst zuzuschreiben. Er hat nichts, aber auch nichts unternommen, diesen gesellschaftlichen Aufbruch, die Laufbewegung, zu integrieren, nachdem ihm der Deutsche Sportbund die Kompetenz übertragen hatte. Er hat weder Ideen beigesteuert noch versucht, Entwicklungen zu erkennen, geschweige denn sie zu fördern. Die Laufbewegung führt ihr Eigenleben. Es sind im Grunde nur die formalen Strukturen, die Läufer ziemlich lose an den DLV binden. Die Entwicklung hin zu größerer Autonomie der Läufer hat sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt verstärkt.
Ich bin kein Wahrsager; aber ich habe bereits Ende der siebziger Jahre erkannt, daß der DLV als Partner der Läufer nicht genügt. Mir schien damals schon beim DLV die Empathie für die Bedürfnisse der Läufer zu fehlen. Dieser Mangel zog sich hinunter bis zum lokalen Turn- und Sportverein. Das hat mich damals veranlaßt, die Mitgliedschaft aufzukündigen.
Inzwischen hat sich die ständig wachsende Laufbewegung immer mehr differenziert und ihre eigenen Wege eingeschlagen. Die Basis der Turn- und Sportvereine ist vielfach diese Wege mitgegangen. In meinem einstigen Verein, dem ich Ende der sechziger Jahre beigetreten war, schien es undenkbar zu sein, aus der Laufgruppe eine eigene Abteilung zu bilden. In anderen Vereinen jedoch ist das längst der Fall. Ja, es haben sich ganze Vereine gebildet, die nichts anderes als Laufen und Walken pflegen. Ich mache mir heute den Vorwurf, weshalb ich denn nicht die Initiative ergriffen und eine eigene Abteilung für Läufer beantragt und konstituiert habe. Sicher hängt das damit zusammen, daß Läufer laufen wollen und nicht organisieren. Diese Tendenz war in der Frühzeit der Laufbewegung wahrscheinlich weit stärker als heute; denn jetzt gibt es ja genügend Ältere, die ihre Wettbewerbsphase hinter sich gelassen haben und sich als Organisatoren und Initiatoren einbringen.
Vor 25 Jahren, nach dem Mauerfall, gab es nach meiner Ansicht die reale Möglichkeit einer organisatorischen Emanzipation der Laufbewegung. Es ist kein Zufall, daß die Initiative vom Gebiet der früheren DDR ausgegangen war. Jahrelang hatten sich die Läufer der DDR als nur geduldet fühlen müssen. Jetzt war das demokratische Tor offen. Eine eigene Zeitschrift mußte her, die „Laufzeit“. Ein eigenes Reiseunternehmen wurde gegründet. Rational hätte man sehr wohl darauf hinweisen können, daß der Markt gedeckt sei und die Läufer der ehemaligen DDR sich nur der vorhandenen Zeitschriften und Sportreiseunternehmen zu bedienen brauchten. Doch man muß die Emotionen, die zu den Gründungsinitiativen geführt hatten, verstehen.
Eine starke Initiative war die Idee des Läuferbundes, die etliche aktive Läufer der DDR vereinte. Mir schien das die große Chance zu sein, der gesamtdeutschen Laufbewegung eine eigenständige organisatorische Basis zu geben. Ich weiß nicht präzise, woran das Vorhaben gescheitert ist. Nebenbei: Mir ist in Erinnerung, daß ich etwas betroffen war, als ich Visitenkarten von (noch nicht gewählten) Läuferbund-Funktionären zu Gesicht bekam. Meine Lebenserfahrung: Wer eine neue Aktivität mit dem Druck seiner Visitenkarte beginnt, scheitert. Der Läuferbund „did not finish“. Wahrscheinlich waren die schon an Quantität weit überlegenen Strukturen des DLV das Hindernis. Eine winzige Gruppe, wie die spätere IGL, hätte die anstehenden Aufgaben nicht bewältigen können. An die hoffnungsvolle Zeit des Läuferbundes erinnern noch Vereinsnamen wie in Sachsen der Läuferbund Schwarzenberg 90 und in Brandenburg der Luckauer Läuferbund und der Niederlausitzer Läuferbund.
Das alles ist mir durch den Kopf gegangen, als ich auf dieser Website davon erfuhr, daß der DLV demnächst ganz konkret die Wettbewerbsläufer „einfangen“, nämlich einen festen Anteil vom jeweiligen Startgeld erhalten will. Dabei hat mich schon verwundert, daß der DLV es nicht für nötig hielt, seinen Beschluß mit einem konkreten Konzept der Geldverwendung zu verbinden.
Nun wird an der Basis und in den Sitzungen der Laufveranstalter geschimpft. Ich sehe mich in der Vision, eine eigenständige umfassende Läuferorganisation zu gründen, bestätigt. Nichts spricht dagegen, die vom DLV geschaffenen oder übernommenen Wettbewerbsnormen zu übertragen. Oder auch nicht? Daß der Rennsteigmarathon 43,5 Kilometer mißt, hat sich mitnichten als Hindernis erwiesen. Wenn Läufe wie der GutsMuths-Rennsteig-Lauf eine „krumme“ Länge haben, – wen interessiert’s? Einen solchen Lauf zu gewinnen, ist nicht weniger ehrenvoll, als den Titel eines Deutschen Meisters zu erwerben.
Ich weiß, diese Zeilen werden an der Oberhoheit des DLV nichts ändern. Doch das Abkassieren bei Veranstaltungen, von denen die wenigsten von einem Leichtathletik-Landesverband organisiert werden, wird hoffentlich zu einigem Nachdenken führen. Ob man nicht doch vor 25 Jahren eine große Chance ausgelassen hat?
Gibt es eine neue Chance? Beim Surfen bin ich auf eine Seite gestoßen, die da lautet: Süddeutscher Läufer Bund e.V. i. G. Die Seite http://suedlb.de enthält den Vermerk „Hier entsteht die Homepage des – “ es folgt der Titel. Damit nicht genug: Es wird – ein wenig vorzeitig, wie ich finde – auf den „Hanseatischen Läufer Bund“, der für Norddeutschland zuständig sei, hingewiesen. Doch von ihm existiert noch keine digitale Spur.
*
Ein Anhang: Wer einen Sinn für die Geschichte von Laufleistungen hat, sollte die Website von germanroadraces vom 21. November anklicken. Darin hat Wilfried Raatz die Leistungen von Charlotte Teske (12 deutsche Rekorde, 14 deutsche Meistertitel) gewürdigt, die am Sonntag ihren 65. Geburtstag gefeiert hat. Nachträglich: Herzlichen Glückwunsch!
Marathonläufer sind im allgemeinen fit, aber nicht immer gesund. Die Todesfälle, die sich bei einem Marathon ereignet haben, beruhen, wenn nicht alles täuscht, fast immer auf Vorschädigungen. Daher wird schon im Vorfeld einiges unternommen, die mit einem hohen Risiko behafteten Läufer vom Start fernzuhalten. Dem dient insbesondere die Befragung im „PAPS-Test“ (Persönlicher Aktivitäts- und Präventions-Screening-Test), der von der Berliner Humboldt-Universität entwickelt worden ist und Marathon-Veranstaltern zur Anwendung empfohlen wird. Andererseits wäre es falsch, jeden Läufer, dessen Profil irgend ein Risiko zeigt, vom Start zu selektieren. Ich zum Beispiel gehöre zu denjenigen, die jahrelang mit Vorhofflimmern Marathon gelaufen sind.
Das ist durchaus möglich. Aber bei allen kardiologischen Auffälligkeiten bleibt ein Restrisiko. Wenn es gelänge, dieses rechtzeitig, nämlich noch während des Marathons, zu beseitigen oder zumindest zu minimieren? Schließlich entwickelt sich ein tödliches kardiales Geschehen, wie häufig der Zeitpunkt des Todes kurz vor dem Ziel zeigt, erst während des Wettbewerbs. Eine „Gesichtskontrolle“, wie sie auf der Ultrastrecke des Swiss Alpine Marathons vorgenommen wird, ist besser als nichts, kann aber eine Diagnose nicht ersetzen.
Mit der technischen Kommunikation zwischen Patienten und ihren Ärzten befaßt sich Prof. Dr. med. Friedrich Köhler an der Berliner Charité. Er hat den in Deutschland ersten Lehrstuhl für Telemedizin inne und leitet das Zentrum für Kardiovaskuläre Telemedizin. Seine Erkenntnisse über „Diagnostik und Therapie unter Überbrückung einer räumlichen Distanz“ hat er schon in einem Praxisseminar weitergegeben.
Erstmals hat er in dem von ihm geleiteten Team Versuche mit Marathonläufern unternommen. Die Wissenschaftler haben eine Methode entwickelt, mit der das Herz während des Ausdauersports kontinuierlich überwacht werden kann. Die Studie der sieben Wissenschaftler ist jetzt (November 2014) im „European Journal of Preventive Cardiology“ veröffentlicht und die Nachricht von dem medizinischen Pressedienst Univadis verbreitet worden.
Danach ist bei zwei Marathons in Deutschland von zehn Marathonläufern ein Live-Elektrokardiogramm angefertigt worden. Normalerweise wird ein Langzeit-EKG (24 Stunden) auf dem mobilen Gerät gespeichert und danach ausgewertet; hier jedoch ist es über Bluetooth, eine seit den neunziger Jahren entwickelte Methode, auf ein am Arm fixiertes Smartphone übertragen und von dort in das Telemedizin-Center der Charité übermittelt und beobachtet worden. Der Transfer eines Wellenkomplexes dauerte 72 Sekunden. Der erste Versuch war noch mit großen Problemen behaftet. Beim zweitenmal, ein halbes Jahr später mit neuer Software, funktionierte die Übertragung einwandfrei. Die Machbarkeit gilt daher als erwiesen.
Allerdings ist für die praktische Umsetzung in größerem Maßstab noch viel Arbeit notwendig. Grundsätzlich jedoch dürfte es nach Ansicht von Professor Köhler möglich sein, den kardiovaskulären Verlauf während des Marathons in einiger Entfernung von den Beobachteten zu kontrollieren und gegebenenfalls rechtzeitig einzugreifen. Unter Umständen kann diese Intervention schon dann erfolgen, ehe noch der Beobachtete Beschwerden verspürt, denn subjektive Beschwerden treten im Hinblick auf alarmierende physiologische Vorgänge zeitverzögert auf.
Nun auch an dieser Stelle: 25 Jahre Mauerfall. Ist in diesen Tagen nicht genug gefeiert worden? Ist nicht alles gesagt worden? Der „glücklichste Tag in der jüngeren deutschen Geschichte“, dem schließe ich mich voll und ganz an. Ich mag nicht wiederholen, was in diesen Tagen an Statements und Darstellungen, an Verlautbarungen und Geschichten, an Einschätzungen und Emotionen verbreitet worden ist.
 |
Ich will zum wiederholten Male auf den wenngleich überschaubaren Anteil des Laufens an dem Wiedervereinigungsprozeß vor und nach dem Mauerfall hinweisen. Dies deshalb, weil dieser Aspekt in der publizistischen Verarbeitung des Themas gar nicht vorgekommen ist. Zudem haben zahlreiche Läufer von heute – das ist mir jetzt klar geworden – die damalige Kommunikation unter Läufern beider deutscher Staaten gar nicht erleben können. |
|
|
Als die Städte im Osten noch grau waren: Seifengeschäft
des Lauftrainers Arthur Lambert in Wittenberg, der in den zwanziger Jahren
eine Geschäftskette aufgebaut hatte.
|
Fangen wir noch ein Stück früher an! Diskutieren wir auch das: Ich war Bürger der DDR und habe das Land am 1. Januar 1952 verlassen. Damit gehöre ich zu den etwa 3,8 Millionen Deutschen, die bis 1990 aus der Sowjetzone und der DDR geflohen sind. Kleines Streiflicht: Wir wurden bis zur Errichtung der Mauer in der Bundesrepublik keineswegs willkommen geheißen. Die Bundesrepublik zeigte sich „unfähig“ und „unwillig“ (Wikipedia), uns aufzunehmen. Nur ein kleiner Teil, nämlich jener, der nachweisen konnte, daß Leib und Leben gefährdet gewesen waren, erhielt den Flüchtlingsausweis und damit die Einbindung in das Sozialsystem. Der Mehrheit von uns, mich eingeschlossen, ist nur das Aufenthaltsrecht zuerkannt worden. Das bedeutete: Keinerlei Eingliederungshilfe, kein Pfennig Sozialhilfe, kein Wohnraum, keine Krankenversicherung – nichts. Wir waren Vogelfreie. Hilfsorganisationen wie heute bei Zuwanderern, die das Überleben erleichtert hätten, gab es nicht.
Nun ist freilich an dieser Stelle eine kritische Frage zu stellen: Sind nicht wir es gewesen, die sich von der Gesellschaft, und sei es einer pseudosozialistischen, isoliert hatten? Auch wer zu früh kommt, den bestraft das Leben (obwohl ich 1952 in der Aufnahme-Kommission gefragt wurde, weshalb ich „erst jetzt“ gekommen sei). 3,8 Millionen Menschen haben eben nicht nur dem Staat, sondern auch ihrer sozialen Umwelt die Mitgliedschaft verweigert. In meinem Fall waren es Eltern, Familienangehörige und Freunde, die ich ohne Aussicht auf ein Wiedersehen zurückgelassen hatte. Haben wir, habe ich mit unserer Übersiedlung in den anderen Staat recht gehandelt? Was wäre die andere Alternative gewesen? In letzter Konsequenz nur diese: Entweder hätte ich weiterhin Funktionen übernommen und wäre als Diener der pseudosozialistischen Gesellschaft aufgestiegen oder aber ich wäre als Opponent auf irgend eine Weise, eine andere als nur meinen Ausschluß aus FDJ und SED, vernichtet worden. Es gab freilich einen Mittelweg, zu dem sich später, als das Regime dies zuließ, viele – allzu viele? – entschlossen hatten, nämlich seinen Beruf recht und schlecht auszuüben (wenn es in der HO Zitronen gab, verließ man eben kurzerhand zum Einkauf die Arbeitsstelle), gegen Kapitalismus und Imperialismus zu demonstrieren, wenn dies gefordert war, und im übrigen den Mund zu halten. Das wahre Leben spielte sich im Wohnzimmer ab. Diese Orientierung zum Privaten hin – ein Widerspruch zur „sozialistischen Gesellschaft“ – sehe ich durchaus positiv; ich wollte, die Wiedervereinigung hätte uns allen wieder dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in Familie und Freundeskreis gebracht.
 |
 |
 |
|
Unter der "Lagerung" ist zum Aufnahmezeitpunkt
wohl nur noch ein Schlaflager zu verstehen gewesen.
|
Das „Zigarrenhaus“ hat sich gewandelt.
|
Auf einer DDR-Reise 1978 habe ich alte Geschäftsreklamen
photographiert: Pelzwerkstatt in Wittenberg.
|
Dieser Mittelweg der Anpassung war im Jahr 1951 noch nicht so recht erkennbar. Mit Sicherheit war die Toleranz des damals noch sehr jungen Regimes gegenüber den nur äußerlich Angepaßten noch nicht vorhanden. Wer um die Toten an der innerdeutschen Grenze trauert, kann unsere Übersiedlung vor Errichtung der Mauer nicht verurteilen. In meiner persönlichen Rechenschaftslegung bin ich zu dem Schluß gekommen, daß ich mit dem Wechsel in die damalige Bundesrepublik richtig gehandelt habe. Falls ich in der DDR geblieben wäre und den Volksaufstand im Jahr 1953 in Freiheit überlebt hätte, wäre ich im Jahr 1989 vor einem Scherbenhaufen meines Berufslebens gestanden.
Zu den Rückzugsmöglichkeiten in der DDR zählte außer den Kirchen und religiösen Gemeinschaften auch das Laufen. Der Staat argwöhnte, daß Läufer sich auf diese Weise der „gesellschaftlichen Arbeit“ entzogen. Sport hatte in erster Linie dem Ansehen der DDR zu dienen; wer nicht die geforderte Qualifikation erwarb, fiel aus der Sportförderung heraus. Der Ultraläufer Roland Winkler kann ein Lied davon singen. Widerwillig wurde der Rennsteiglauf akzeptiert. Kontakte zwischen west- und mitteldeutschen Läufern kamen bei Laufveranstaltungen zustande. Eine wenn auch nicht große Anzahl Läufer aus der Bundesrepublik nahm illegal am Rennsteiglauf teil. Läufer aus der DDR, die aus familiären Gründen eine Ausreisegenehmigung erhielten, starteten bei einem Lauf in der Bundesrepublik, zuweilen sogar – nach Aushändigung eines bundesdeutschen Reisepasses – in Biel. Der Geburtstag der fast schon vergessenen Tante oder des Onkels in der Bundesrepublik – Tante und Onkel mögen verzeihen! – war Nebensache, er war Mittel zum Zweck. Eine weitere und völlig risikolose Möglichkeit der Begegnung waren Veranstaltungen an neutralen Orten, nämlich im „sozialistischen Ausland“.
 |
All das vollzog sich im völlig privaten Bereich. Die Kontakte verliefen ideologiefrei; es zeigte sich, die Interessen von West- und Ostläufern waren die gleichen. Beim Laufen wuchs schon damals zusammen, was zusammengehörte. Nicht selten folgte auf den persönlichen Kontakt ein Briefwechsel, gelegentlich auch einmal der Versand eines Paars Laufschuhe in die DDR. Laufzeitschriften wurden kostenfrei in die DDR geschickt; sie rangierten unter „Fachzeitschriften“, und diese waren zulässig. Erinnert sei auch daran, daß Ernst van Aaken in Waldniel und Manfred von Ardenne in Dresden ihre Gedanken über die Rolle des Sauerstoffs austauschten. | |
|
„Hufbeschlag und Wagenbau“ – kein Bedarf mehr.
Was uns die Bilder sagen wollen: Die Reklame ist nun auch für die Bewohner der ehemaligen DDR Geschichte geworden. |
Und heute? Die Läufer aus der DDR haben mächtig aufgeholt; sie sind schleunigst zu den Veranstaltungen gereist, zu denen ihnen der Zugang so lange verwehrt gewesen war. Einige Veranstalter wie die von Biel haben nach der Wiedervereinigung die Brücke gebaut und von den Läufern aus der ehemaligen DDR kein Startgeld verlangt. Eine Anzahl DDR-Läufer hat sich mit Spitzenleistungen unversehens in die deutsche Laufchronik eingetragen. Der GutsMuths-Rennsteiglauf ist ein gesamtdeutscher Lauf geworden. Westdeutsche starten ganz im Osten beim Europamarathon in Görlitz und Zgorzelec.
Der 9. November 1989 war ein glücklicher Tag. Das Glück des Laufens hält an.
Photos: Sonntag
Die „Heute“-Nachrichten des ZDF am Sonntag um 19 Uhr sind nur zehn Minuten lang. Sport wird verständlicherweise in einer Kurzfassung geboten. Die erste Sportmeldung am 2. November handelte von einem, wie ich vermute, deutschen Volkssport, vom Golf. Den Anlaß der Meldung habe ich schon wieder vergessen. Ich erinnere mich nur an die Bildsequenz, wie der Ball in ein Loch rollt. Dann kam, versteht sich, der Fußball. Im dritten Stück ging es um Volleyball. Das war’s.
Es war der Tag, an dem in New York Marathon gelaufen wurde. Wo leben eigentlich die Sportredakteure der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten? Wo immer sie sich bewegen, sie treffen auf Läufer. Angeblich sind es in Deutschland über 15 Millionen. Zwar läuft nur ein winziger Teil von ihnen Marathon oder möchte zumindest einmal Marathon laufen, aber die 15 Millionen betreiben genau den Sport, der am Sonntag in New York sein Glanzstück gehabt hat. Der New York City-Marathon ist mit über 50.000 Teilnehmern wieder der größte Marathon der Welt gewesen. Er ist einer der respektablen „deutschen“ Marathons – mit 1871 deutschen Finishern. New York ist die Geburtsstätte des City-Marathons, über den heutzutage in Rathäusern größerer Kommunen nachgedacht wird. Der New Yorker Lauf brachte auch den Abschluß der Wertung der sechs World Marathon Majors 2013/14, zu denen außer Boston, Chicago, London und Tokio auch Berlin zählt. In öffentlich-rechtlichen Anstalten hat dieses wahrscheinlich weltweit größte und attraktivste Laufereignis nicht stattgefunden.
Mag sein, daß für Fernsehübertragungen gezahlt werden muß. In diesem Fall hat Eurosport investiert. Aber es kann ja nicht angehen, daß Nachrichten, auch ins Bild gesetzte, nicht möglich wären. Es ist richtig, daß um 19 Uhr nach Mitteleuropäischer Zeit der New York-Marathon noch im Gange war; aber die Sieger standen fest. Ein Weltrekord-Inhaber (2013) und ein Dubai- wie Boston-Sieger machten es unter sich aus. Die ersten und zweiten Plätze lagen bei den Männern nur sieben Sekunden auseinander, selbst zwischen neuntem und zehntem Platz vergingen nur 31 Sekunden. Bei den Frauen entschieden gar nur drei Sekunden zwischen erstem und zweitem Platz. Wer von uns Alten hätte vor vierzig Jahren gedacht, daß Marathon so spannend sein kann!
Ein Ereignis wie das von New York zu verschweigen, widerspricht allen Regeln journalistischer Berichterstattung. Was jedes Lokalblatt für sich in Anspruch nimmt, nämlich wenigstens einen Agentur-Bericht über den New York Marathon zu veröffentlichen (in meiner Heimatzeitung dreispaltig, mit Bild), kann doch für öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten nicht unerreichbar sein. Hier stimmt etwas nicht.
Versteht sich, daß ich in den inoffiziellen Ergebnissen die höchsten Altersklassen nachgeschlagen habe. Am erfolgreichen Start waren neun Männer und zwei Frauen der Klasse achtzig bis neunundachtzig Jahre (kein Deutscher). In New York gibt es auch eine Klasse 90+. Sie war sogar besetzt – von einer Frau. Die 91jährige Margaret Hagerty aus der Gegend von Concord, North Carolina, legte die Strecke in 9:50:21 Stunden zurück; ihre durchschnittliche Gehgeschwindigkeit betrug 22:31 min je Meile.
Margaret Hagerty hat eine bemerkenswerte Laufbiographie: Im Alter von 64 Jahren gab sie das Rauchen auf und folgte ärztlichem Rat, sich mehr zu bewegen. Sie begann im Alter von 66 Jahren, Marathon zu laufen, und verband das mit dem Reisen. Sie ist die älteste unter den Läufern, die Marathon auf allen sieben Kontinenten gelaufen sind. Sie hat unter anderem den Marathon auf der Großen Mauer bewältigt und, im vorigen Jahr, den Halbmarathon auf dem Kilimanjaro. Inzwischen hat sie über 80 Marathons beendet. Der New York City-Marathon sollte, sagte sie, ihr letzter Marathon sein. Doch ihren angeblich „letzten“ Marathon ist sie schon vor einigen Jahren gelaufen. In der Sports Hall of Fame von North Carolina hat sie ihren Platz gefunden – wie schon ihr Vater, ein Mitglied der American Power Boat Association.
Da Frauen in den hohen Altersklassen eher selten sind, kommt Margaret Hagertys Beispiel als der ältesten Teilnehmerin des New York-Marathons besondere Bedeutung zu.
Der wahrscheinlich älteste Ultraläufer in Deutschland, Horst Feiler, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das hatte ich zwar bald nach seinem am 30. Juli eingetretenen Tod erfahren, aber ich wußte nichts über ihn. Ich konnte keinen Nachruf verfassen. Da es mir jedoch ein Bedürfnis ist, seiner zu gedenken, hole ich das jetzt nach. Denn Jörg Stutzke, der Präsident der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung, hat im dritten Jahresheft von „Ultramarathon“, das vorige Woche zugestellt worden ist, einen Nachruf veröffentlicht, aus dem ich abschreiben kann.
Meine eigene Erinnerung an Horst Feiler beschränkt sich auf eine wenn auch flüchtige Begegnung auf dem Marktplatz in Eisenach, wahrscheinlich im Jahr 2003. Wir starteten zum Supermarathon des GutsMuths-Rennsteiglaufs. Man kennt die Situation wenige Minuten vor dem Start: Zu tiefsinnigen Gesprächen ist da keine Zeit. Wenn ich mich recht erinnere, war Horst auf mich zugekommen. Am Ziel sahen wir uns nicht mehr. Er war in 11:29:22 Stunden eingetroffen, ich erst eine knappe Viertelstunde nach 12 Stunden. Dabei lief er in M80, ich hingegen in M75. Wen wundert es, daß er sechs deutsche Altersklassenbestleistungen und sogar eine Weltbestleistung im Ultrabereich erzielte!
Jörg Stutzkes Nachruf entnehme ich, daß Horst erst im Alter von 63 Jahren zum Laufen gefunden hatte. Im Alter von 67 Jahren lief er seine erste Ultralangstrecke. Mir scheint dies nicht untypisch zu sein; es ist, als erwache bei Späteinsteigern des Laufens auch eine späte Lust am Wettbewerb. Ziele des Leistungsstrebens, das normalerweise den Menschen eigen ist, werden nachgeholt.
Horst Feiler, lese ich, hatte früher Kanusport betrieben. Ein schwerer Unfall im 54. Lebensjahr zwang ihn, den Raumausstattermeister, zu einer beruflichen Neuorientierung. Ganz sicher war ihm später der Laufsport eine Lebenshilfe. Seine Altersleistungen wie in M80 die 100 Kilometer in 12:46:27 Stunden und in M90 in 24 Stunden 101,683 Kilometer verführten ihn nicht dazu, seine Bescheidenheit aufzugeben. Seine Zurückhaltung ist ein weiterer Grund, ihm dieses Gedenkblatt zu widmen.
Sein Tod im 93. Lebensjahr ist offenbar die Folge eines häuslichen Unfalls. Sein Gesundheitszustand jedenfalls hatte nicht auf sein Ende hingedeutet. Horst hinterläßt seine Frau und zwei Kinder. Die Laufbewegung hat allen Anlaß, deren Trauer zu teilen.
Zwar bin ich des Laufens wegen am Wochenende in Berlin gewesen, aber ich kann und will nicht über den Anlaß schreiben. Doch ein Leben lang ist es mein Prinzip gewesen, die Reise zu einem Laufanlaß mit einer Besichtigung zu verbinden. Manchmal bestand die Besichtigung aus dem Lauf selbst. In Berlin jedoch sind es immer zusätzlich Museen und Theater gewesen. Bei meinem jüngsten Berlin-Aufenthalt habe ich die am 10. September eröffnete Ausstellung „Die Wikinger“ im Martin-Gropius-Bau besucht.
Nanu! Sind die Wikinger ein Thema? Es gab eine Zeit, da waren sie es nicht. Eine solche Ausstellung hätte Ende der vierziger und in den fünfziger Jahren nicht gezeigt werden können. Nach meiner Ansicht hatte das Wikinger-Thema, wie es im Schwäbischen heißt, ein Geschmäckle. In der Schule des Nationalsozialismus waren die Wikinger positiv besetzt. Nicht allzuviel fehlte, und die Wikinger wären in der Zeit, als die „germanische Herrenrasse“ das Leitbild der Nazis war, zu unseren Vorfahren ernannt worden. Wir lernten in der Schule die Namen der Götter in der Wikingerzeit. Die kühnen Seefahrer waren ein Leitbild, das zur nationalsozialistischen Erziehung taugte. Ihre Brandschatzungen und Mordbrennereien waren in der Zeit der Konzentrationslager und der Judenverfolgung absolut kein Hindernis.
Nach dem Zweiten Weltkrieg schlug das Pendel in die Gegenrichtung aus. In der Zeit der Demokratisierung eigneten sich die Wikinger nicht dazu, sich abseits der Wissenschaft öffentlich mit ihnen zu beschäftigen. Nun ist wohl alles im Gleichgewicht. Das haben die Umstände der Ausstellung und die Ausstellung selbst deutlich gemacht.
Es ist eine Gemeinschaftsausstellung des Dänischen Nationalmuseums, des British Museum und des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin. Nachdem sie in Kopenhagen und in London gezeigt worden ist, kann man sie nun bis zum 4. Januar in Berlin sehen.
Ihre aktuelle Bedeutung erhält sie dadurch, daß in den letzten zwanzig Jahren bemerkenswerte Funde gemacht worden sind, Der bedeutendste Fund ist sicherlich die Entdeckung des Wikingerschiffs Roskilde 6 im Jahr 1996. Fünfzehn Jahre dauerte es, bis die Holzplanken und der gesamte Kiel dieses mit 37 Metern größten bisher erhaltenen Wikingerschiffes aus dem Jahr 1025 konserviert und ausstellungsreif gemacht waren. Das Schiff, das etwa 100 Krieger und Ruderer aufnehmen konnte, bildet im Lichthof des Martin-Gropius-Baus den zentralen Punkt der Ausstellung. Sie ist in die Themenbereiche Kontakte und Austausch, Krieg und Eroberung, Macht und Herrschaft, Glaube und Ritual gegliedert.
Damit wird das lange Zeit von kriegerischer Aggression dominierte Bild der Wikinger wissenschaftlich korrigiert. Die Wikinger haben mit ihren Schiffen eben nicht nur Raubzüge unternommen, sondern – wahrscheinlich überwiegend – zum kulturellen und wirtschaftlichen Austausch beigetragen. Die Vitrinen der Ausstellung zeigen außer Waffen Schmuckstücke und Alltagsgegenstände, die ein hohes kulturelles Niveau erkennen lassen.
Auf diese Weise trägt die Ausstellung dazu bei, einen eher verwaschenen Begriff, die Wikinger, zu differenzieren. Eine geschichtliche Epoche, das frühe Mittelalter von etwa 800 bis 1050 n. Chr. bei nordischen, zum Teil auch baltischen Völkern, gewinnt Farbe. Wenn man als Läufer mit Geschichtsbewußtsein durch die Ausstellung geht, wird einem vielleicht auch das Laufen in den Sinn kommen. Auch hier sollten wir uns vor Klischees hüten, die zu einem großen Teil durch Medien kolportiert werden.
In diesen Wochen feiern wir das Fünfundzwanzig-Jahr-Jubiläum des entscheidenden deutschen Wiedervereinigungsprozesses. Ausgelöst war dieser Prozeß durch Demonstrationen in der DDR und die Massenflucht von DDR-Bürgern in Drittländer. Im Fernsehen sind historische Aufnahmen von der Deutschen Botschaft in Prag gezeigt worden, als sie von Urlaubern aus der DDR überrannt worden war, und davon, wie an der österreichisch-ungarischen Grenze der Stacheldraht zerschnitten und damit die DDR-Flucht über Ungarn ermöglicht wurde. Doch die „innere“ Wiedervereinigung hatte schon vorher begonnen. Die Laufbewegung hat ihren Anteil daran.
Wie kaum auf einem anderen Gebiet gab es hier enge Gemeinsamkeiten. Das Laufen war diesseits und jenseits der innerdeutschen Grenze als Mittel der Lebensbewältigung entdeckt worden. Die DDR tat alles, gemeinsames Laufen von Ost- und Westläufern zu verhindern. Dennoch, Läufer aus der Bundesrepublik starteten dank der Hilfe von DDR-Bürgern illegal beim Rennsteiglauf. Bürger der DDR, die infolge Erreichens der Altersgrenze oder wegen „dringender Familien-Angelegenheiten“ die Ausreisegenehmigung erhielten, starteten, wenn es sich zeitlich machen ließ, in Biel (den notwendigen Reisepaß erhielten sie problemlos in der Bundesrepublik). Doch da all das unter der Decke gehalten werden mußte, waren die Gelegenheiten zur Begegnung, ausgenommen private Verbindungen, eher selten.
Anders war es bei Veranstaltungen, die legal sowohl von DDR-Bürgern als auch von Bundesdeutschen besucht werden konnten. Eine Rolle hat dabei der Supermarathon im Donauknie gespielt. Ungarn war uns, was den Ultramarathon angeht, ein Stück voraus. Györgi Schirilla, der bereits 1965 die 100 Kilometer in 8:02 Stunden gelaufen war, hatte einige Fernläufe solo bewältigt, so 1967 die Strecke von Budapest nach Moskau, 2226 Kilometer in 30 Tagen. In 24 Stunden legte er die Distanz Budapest – Wien zurück (252 Kilometer). Eine Woche lang lief er nach Warschau (719 Kilometer), vier Tage nach Belgrad (400 Kilometer). Von ihm stammt der Begriff „Supermarathon“. Der erste organisierte Supermarathon in Ungarn führte 1977 um den Plattensee. Fünf Jahre später wurde unter der Schirmherrschaft des Sportamtes des Komitates Pest eine Supermarathon-Sparte gebildet. An dieser Entwicklung hat der Physiotherapeut Schirilla den entscheidenden Anteil.
Ich lernte ihn 1984 kennen; da war er beim ersten „Szuper-Marathon“ im Donauknie tätig. Dieser Lauf führte durch eine der interessantesten Landschaften Ungarns. In drei Tagen waren etwa 200 Kilometer zurückzulegen. Am ersten Tage wurde auf dem Sportplatz von Sroksár, am südlichen Stadtrand von Budapest, gestartet; das Ziel war nach 68 Kilometern in Szigetszentmiklós. Am zweiten Tage liefen wir 60 Kilometer vom Marktplatz in Esztergom, im Mittelalter der Hauptstadt des Landes, über eine 7 Kilometer lange Wendepunktstrecke nach Szentendre. Der dritte Tag brachte einen Rundkurs über 68 Kilometer von Dunakeszi nördlich von Budapest. In einem Hotel in Dunakeszi nächtigten wir die drei Tage.
Anders als zuvor am Plattensee, wo nur die ausländischen Läufer in einem Hotel logiert hatten, die Ungarn hingegen in Massenquartieren, lebten wir alle im selben Hotel. Für den Supermarathon im Donauknie war auch in Wien geworben worden.
 |
Dort hatte Jahre zuvor ein österreichischer Ingenieur mit dem eingedeutschten Vornamen Tony einen Laufshop eröffnet. Da ich mit ihm gut bekannt war, erfuhr ich auf diese Weise von dem Supermarathon im Donauknie. Außer ihm waren nur zwei österreichische Läufer am Start. Vier hingegen kamen aus der DDR. Das waren Roland Winkler, den ich schon beim Rennsteiglauf kennengelernt hatte, Wolfgang Kahms, Dr. Klaus Manske und Georg Maeth. Zusammen mit einem Tschechen waren wir 43 Läufer. |
|
|
Gemischte deutsch-deutsche und österreichische Gruppe
im Jahr 1985 in Ungarn (von links nach rechts): Irmgard Neumärker (DDR),
Sigrid Eichner (DDR), Werner Sonntag (BRD), Wolfgang Kahms (DDR), Dr.
Klaus Manske (DDR), Roland Winkler (DDR), Waltraut Reisner (BRD), Wilhelm
Böhm (Österreich), hockend Ludwig Lukas (Österreich) und Franz Kirchner
(BRD).
|
Im Jahr darauf – seither gab es eine gedruckte Broschüre – stießen aus der DDR Sigrid Eichner und das Ehepaar Neumärker hinzu. Zusammen waren wir 64 Läufer. 1986 kamen aus der DDR zusätzlich Folker Lorenz und Dr. Gudrun Spitzner, eine Medizinerin, die in Leipzig Abhängige in einer Laufgruppe um sich geschart hatte, aus der Bundesrepublik Karl Weiß, Werner Schmidt, Franz Kirchner, Horst Preisler, Heinz Schmidt, Matthias Meinzinger, Sukru Meric (ein in Frankfurt a. M. lebender Türke), Wilfried Waldhausen und Stefan Schlett; zusammen waren wir 78 Teilnehmer. 1987, beim letzten Supermarathon im Donauknie, waren neu aus der DDR Gerhard Baumann, Alfred Schmeizer, Günter Gelhaar, Ulf Hartmann, aus der Bundesrepublik Dieter Roth, Herbert Oberbeck, Hans Reich, David Goodwin und Christa Quentin. Zusammen waren wir 59 Finisher.
Da wir Deutschen und Österreicher keine sprachlichen Probleme hatten, gab es keine Gruppenbildung. Wir lebten vier Tage miteinander und lernten einander kennen. Ich schrieb damals: „Kenntnis vom Laufen, vom Laufwettbewerb, erwirbst du auf den Strecken bis hin zum Marathon. Erkenntnisse, vor allem über dich selbst, sammelst du auf der Ultralangstrecke.“ Die beiden Deutschland waren bei unserer Begegnung völlig in den Hintergrund getreten. Unsere Wiedervereinigung hatte begonnen.
Photo: Gottfried Neumärker (?)
Die Siegerehrung endete mit standing ovations für Hubertus Beck, den Gründer und Cheforganisator des Taubertal 100, des neuen Ultralaufes von Rothenburg o. T. nach Wertheim.
Bei allem Respekt: Wer ist Hubert Beck? Die Statistik der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung führt nicht weniger als 134 Ultraläufer mit dem Namen Beck auf. Einer von ihnen ist Diplom-Ingenieur Hubert Beck aus Lauda-Königshofen. Der Hauptort, nur als Eisenbahn-Knotenpunkt bekannt, und sein Teilort liegen an einem Radtourenweg namens „Liebliches Taubertal“, einer Strecke von über 100 Kilometern, fast durchgehend asphaltiert und auch innerhalb von Städten wie Bad Mergentheim markiert. An diesem Weg ist Beck, 56 Jahre alt, auch läuferisch zu Hause. Über Biel (zuletzt im Jahr 2012 in 10:42:20 Stunden) und den GutsMuths-Rennsteiglauf hat er sich zu einem Ultraläufer mit Profil entwickelt – 2009: Ultra Trail Mont Blanc in 42:18:45 Stunden, 2011: Spartathlon in 34:30:12, in diesem Jahr Self Transcendence 10 Days Race in New York mit 841,686 Kilometern. Über seine Entwicklung und das Laufen hat er reflektiert und dessen Faktoren im Marathon und im Ultramarathon gründlich analysiert. Das Ergebnis sind „Das große Buch vom Marathon“ und – im vorigen Jahr – „Das große Buch vom Ultramarathon“, dazu Seminare und vor einigen Jahren die Idee, auf dem Weg seines Trainings einen Ultralauf zu veranstalten.
 |
 |
|
|
Spartathlon- und UTSB-Finisher, Autor und nun Veranstalter:
Hubertus Beck beim Vortrag.
|
Nein, nicht verwackelt – neblig war’s am Morgen: Matthias
Stuhl aus Wargolshausen.
|
Wenn man bedenkt, daß die Klassiker Biel und Rennsteiglauf sich aus privaten Unternehmungen ganz allmählich zu ihrer späteren Bedeutung entwickelt haben und hinter anderen Veranstaltungen Vereine und Verbände, Kommunen und Touristiker stehen, muß man es als sehr mutig bezeichnen, daß ein einzelner Läufer eine solche anspruchsvolle Veranstaltung ins Leben ruft. Zu Recht hat Beck daher diejenigen öffentlich gewürdigt, die ihn mit ihrem Fachwissen unterstützt haben, darunter auch eine Gruppe aus der Schweiz.
Der vor etwa 30 Jahren eingerichtete Radweg führt im Prinzip entlang der Tauber vom fränkischen Rothenburg zum nordwürttembergischen Wertheim. Die Tauber schlängelt sich durch eine harmonische hügelige Landschaft, durch Wiesen und Auenwälder, vorbei an Streuobstanlagen, Weinbergen und Steinriegeln; eine Kombination von Bundesstraße und Verbindungsstraßen trägt den Namen „Romantische Straße“. Müßte man nicht laufen, wäre es auch eine hochrangige Kulturroute, angefangen von Rothenburg, einem der beliebtesten Anziehungspunkte in Deutschland, über die Stuppacher Madonna in Creglingen, den Stadtkern von Röttingen, die Steinbrücke von Balthasar Neumann in Tauberrettersheim und das Renaissanceschloß in Weikersheim nach Bad Mergentheim, dem langjährigen Sitz der Deutschordensritter, zur Altstadt von Tauberbischofsheim, zum Kloster Bronnbach und schließlich zur Altstadt und zur Burg von Wertheim, dazwischen tauberfränkische Dörfer ohne Verdichtungsgebiete und Verbauung (der Main-Tauber-Kreis hat die geringste Siedlungsdichte in Baden-Württemberg). Eine der schönsten Radwanderrouten und trotz kleinen Steigungen noch als flach zu bezeichnen. Oder, wie Hubert Beck sagte: „Wenn Ihr von einer Anhöhe hinunter blickt, dann seid Ihr falsch!“
 |
 |
|
|
Vor Kilometer 60: Läufer und Radfahrer begegnen sich.
|
Smarana Puntigam vom Sri Chinmoy Team Wien (links) und
Peter Böhm von der LG Kreis Verden.
|
Das Wetter am 4. Oktober trug ganz sicher zu der geglückten Veranstaltung bei. Zur Startzeit um 6 Uhr morgens war es noch stockdunkel. Die 38 Teilnehmer hatten sich eine halbe Stunde zuvor nach gemeinsamem Frühstück am Würzburger Tor versammelt und trabten mit Fackeln durch die mittelalterliche Stadt. Auf dem Weg hinunter ins Taubertal erreichte ich sie mit dem Auto – doch der Weg verengte sich; ich mußte wenden und sah die Fackelläufer niemals wieder. Der Start war, wie ich erst am Vorabend erfahren hatte, von dem über eine Holzbrücke zu erreichenden Punkt zur „Barbarossabrücke“ verlegt worden. Mein Navigationssystem blieb mir die Auskunft schuldig, die mündliche Schilderung beruhte auf einem Mißverständnis; ich fuhr in die falsche Richtung – die Startzeit war vorbei. Die Photos von Fackelläufern und danach Stirnlampenträgern blieben unphotographiert. Da frühstückte ich erst einmal und suchte die Laufroute bei Tageslicht. Das war mit dem Auto gar nicht so einfach. Nicht der anfängliche Nebel war schuld. Ich halte die Markierung der Strecke nicht für ausreichend. Die Tauber als grobe Markierung ist von der Romantischen Straße aus immer nur stellenweise sichtbar; ist man ausgestiegen, sieht man soviele Wege, daß die Orientierung außerordentlich schwer ist. Bei nur 38 Läufern dauert es mitunter eine ganze Weile, bis vielleicht ein Läufer kommt und einem die Ungewißheit nimmt. Es wundert daher nicht, daß auch Verlaufen vorgekommen ist, allerdings nur auf kurze Strecken. Der wichtigste Verbesserungsvorschlag wäre daher: Die Markierung, auch wenn sich die Markierer der Bedeutung ihrer Arbeit sicher waren, müßte dichter sein: nach Abzweigungen wäre die Bestätigung durch einen neuerlichen Pfeil oder ein Schild kein Luxus. Mehrfach wartete ich auf dem Weg, den ich für den Radweg „Liebliches Taubertal“ hielt, vergeblich auf Läufer; wahrscheinlich wartete ich auf dem falschen Weg.
Die Verpflegungsstationen dagegen – alle 10 Kilometer, dazwischen jeweils ein Getränkeangebot – waren mustergültig: Die beiden Tische standen in Zelten, das Angebot war beschriftet, es entsprach Becks Erkenntnissen. Wo sonst steht Chia-Samen, eines der hochwertigsten natürlichen Lebensmittel und entsprechend teuer, auf dem Verpflegungstisch? Chia-Samen liefern unter anderem dank Verlangsamung der Zuckergewinnung lang anhaltende Energie. Oder Kokosöl? Und Kartoffelpüree und Suppe? Alles überschaubar und appetitlich. Dazu war jeweils eine Bank für diejenigen aufgestellt, die sitzend pausieren wollten. Sicher, eine vielfache Teilnehmerzahl würde hier auch eine Vervielfachung der Betreuer erfordern.
 |
 |
|
|
Verpflegungsstation in Beckstein: Kritischer Blick von
Diethard Steinebecher aus Cottbus.
|
Die Tauber in Tauberbischofsheim (km 71): Ob der Weg
am jenseitigen Ufer die Route des Taubertal 100 ist?
|
Es war ein Erlebnislauf. Das spiegelte sich auch in der Spitzenzeit. Der 60 Jahre alte Volker Dittmar aus Oberasbach, TSV Fürth, war mit 8:45.42 Stunden am schnellsten im Ziel mitten in der Wertheimer Altstadt; ihm folgte sogleich der 25 Jahre alte Michael Dessler aus Süßen bei Göppingen (es war sein erster 100-km-Lauf) in 8:46:49, auf dem dritten Platz Hilmar Langperter aus Roth bei Nürnberg in 9:19:54. Die drei Frauen waren die drei schnellsten Frauen: die 25jährige Rebecca Lenger aus Mayen, LG Laacher See, in 10:27:10, die 42jährige Judit Menz aus Lauda-Königshofen, ETSV Lauda, in 11:36:20 und die 40jährige Katrin Arnold aus Mühlheim a. R., LC Duisburg, in 14:28:40 Stunden. Zwar gab keiner der Gemeldeten auf, aber die Zahl der drei für 71 Kilometer nach Tauberbischofsheim Gemeldeten wuchs auf fünf (Florian Bachmeier vom Team Klinikum Nürnberg in 6:34:44 und Friederike Müller aus Inzing, Run to the top, in 6:41:31), und die Zahl der fünf 50-km-Teilnehmer verdoppelte sich (Christian Schlehlein aus Creglingen, Ultra-Team Hohenlohe, in 4:10:48 und Nicole Benning aus Vaihingen a. d. Enz, EK Schwaikheim, in 4:31:21). So wurde der Taubertal 100 auf voller Distanz unter nur 20 Läufern ausgetragen. Wer die 100 Kilometer nicht beendete, konnte mit der Bahn nach Wertheim reisen. Vom Zielort Wertheim verkehrte am Sonntag ein Bus zum Startort Rothenburg.
Hubert Beck hat präzise Vorstellungen vom Teilnehmer-Potential. Mit dem Zielschluß nach 15 Stunden – der letzte war der älteste, Hagen Brumlich aus Königswusterhausen, in 14:41:52 – spricht er ausdrücklich allein diejenigen an, die 100 Kilometer in 14 Stunden zurückgelegt haben oder einen Marathon in bis zu 4 Stunden laufen. Bei mittlerweile über 8000 Ultraläufern in Deutschland und einem wachsenden Potential müßte eine Wachstumsrate für diesen sehr schönen Streckenlauf vorhanden sein.
 |
 |
|
|
Eine Sekunde bis zum Ziel in Wertheim: Judit Menz aus
Lauda-Königshofen.
|
Boxberger Guggenmusik beim „Ritteressen“ auf Burg Wertheim:
Die Läufer sind auch nach 17 bis 18 Stunden noch ziemlich munter.
|
Noch eine Absicht verfolgt Hubert Beck: Er möchte die Läufer, wenn sie denn schon größtenteils allein oder mit einem einzigen Partner laufen, zu einander führen. Dem dienten nach dem Briefing am Vorabend ein gemeinsames Essen in Rothenburg, nämlich eine „Kartoffelparty“, und ein Vortrag „Faszination Ultramarathon“, in dem Beck einige Aspekte seines Ultra-Buches verwendete. Am Zielort Wertheim gab es auf der Burg das dort übliche „Ritteressen“, mit dem nach Zielschluß die Siegerehrung verknüpft war. Freilich, das Gesamtpaket für 100-km-Teilnehmer mit den beiden Abend-Essen einschließlich Getränken, dem Frühstück in Rothenburg und Bus-Rückfahrt von Wertheim hat bis zum 1. Juni 150 € gekostet, nach dem 2. August 190 €. Die Teilnahmegebühr ohne Extras betrug 100 €. Das klingt nach viel, scheint mir aber nach meinem Eindruck korrekt zu sein.
Auf jeden Fall: Der Taubertal 100 wird weitergelaufen, möglicherweise im nächsten Jahr in umgekehrter Richtung. Hubert Beck hat auch die Vision eines 100-Meilen-Laufes. Doch dazu müßte sich wohl die Teilnehmerzahl noch etwas vergrößern. Verdient hat es der Lauf.
Photos: Werner Sonntag
| Zu weiteren Tagebuch-Eintragungen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | |
| 2016 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2015 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2014 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2013 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2012 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2011 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2010 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2009 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2008 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2007 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2006 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2005 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2004 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2003 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2002 | Alle Eintragungen HIER | |||
| Zurück zur den aktuellen Eintragungen HIER | ||||
| Zu weiteren aktuellen Inhalten bei LaufReport.de | ||||