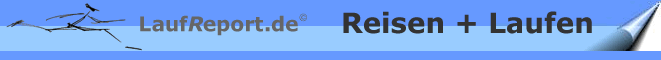

 |
 |
 |
 |
 |
 |
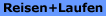 |
 |
 |
 |
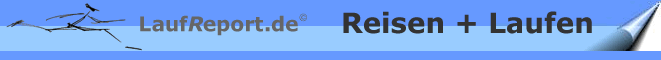 
|
 |
18. Nordmarka Skogsmaraton Oslo
|
 |
|
von Ralf Klink
|
Wenn es eine Sportart gibt, die eine eindeutig zu definierende Heimat hat, dann ist es wohl der nordische Skisport. "Holmenkollen" heißt sie und findet sich in der Luftlinie gerade einmal acht Kilometer entfernt, aber vierhundert Meter oberhalb vom Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo. Zwar wurden Skilanglauf und Skispringen an diesem Ort nicht wirklich erfunden, aber nirgendwo haben sie eine größere Tradition.
Die dortige Schanze ist - wenn auch inzwischen fast zwanzigmal umgebaut - jedenfalls die älteste, die es weltweit gibt. Und nirgendwo sonst werden auch schon so lange Wettbewerbe auf jenen zwei Brettern veranstaltet, die nicht ganz zufällig fast überall auf der Welt unter ihrer norwegischen Bezeichnung bekannt sind. Schließlich dienten sie in Skandinavien schon seit vielen Jahrhunderten als Fortbewegungsmittel im Winter.
 |
 |
 |
| Herrliche Ausblicke über die vierhundert Meter weiter unten gelegene Stadt hat man vom Holmenkollen-Skistadion und der benachbarten Kapelle | ||
Seit 1892 gibt es das "Holmenkollen skifestival", das damit auf eine ähnlich lange Geschichte wie die Radrennen Lüttich-Bastogne-Lüttich und Paris-Roubaix oder der Boston Marathon zurückblicken kann. Und die Vorläuferveranstaltung, die am nahegelegenen Husebybakken stattfand, lässt sich sogar bis 1879 zurück verfolgen. Die Disziplin der nordischen Kombination geht genauso auf diese ersten Konkurrenzen zurück wie die heute üblichen Langlaufdistanzen von fünfzehn oder dreißig Kilometern.
Immerhin auch bereits seit 1902 stehen bei den Skispielen die "fem mila i Kollen" - die "fünf Meilen am Kollen" - auf dem Programm. Zwanzig Jahre länger als beim legendären schwedischen Wasalauf von Sälen nach Mora und gar dreißig Jahre früher als bei dessen norwegischem Gegenstück, dem Birkebeinerlauf in Lillehammer wird also am Holmenkollen schon über ziemlich lange Distanzen gelaufen.
Denn mit "Meile" gemeint ist dabei selbstverständlich keineswegs die britische sondern die skandinavische Variante dieses Maßes. Und deren Länge beträgt - der Weite des Nordens durchaus angepasst - stolze zehn Kilometer. Es handelt sich also um den mit Abstand traditionsreichsten Fünfziger im Langlaufzirkus.
Auch diese bei internationalen Meisterschaften übliche Streckenlänge geht also auf das Holmenkollen-Festival zurück. Das Rennen gilt als einer der wichtigsten Klassiker in dieser Sportart. Ein Sieg dort kommt - ähnlich wie zum Beispiel ein Erfolg bei den großen Marathons London, Boston oder New York - vom Stellenwert her für Skilangläufer nicht weit nach einer olympischen oder WM-Medaille.
Doch alleine das genügt nicht, um diesen Hügel, der 1954 auch schon Austragungsort olympischer Spiele war, zum absoluten Zentrum des nordischen Skilaufens zu machen. Was den Wettbewerben wohl wirklich den einzigartigen Flair verleit, ist die Begeisterung der Norweger für diese Sportart.
Denn schon zu den "normalen" Holmenkollen-Skispielen pilgern Zehntausende an die Schanzen und Loipen. Was den Skispringern auch von anderen Orten her durchaus gelegentlich bekannt ist, stellt insbesondere für die sonst oft ziemlich alleine durch den Wald hetzenden Langläufer etwas völlig ungewohntes dar.
Und während der in diesem Jahr zum vierten Mal nach 1930, 1966 und 1982 in Oslo ausgetragenen Weltmeisterschaften sollen insbesondere bei den beiden abschließenden Rennen über die ganz langen Distanzen - 30 km bei den Damen und 50 km bei den Herren - weit über einhunderttausend Menschen im Skistadion und an der Strecke gestanden und den Athleten zugejubelt haben.
Und zwar allen Athleten, nicht nur den norwegischen, wenn auch deren zahlreiche Erfolge sicher nicht nachteilig für die Stimmung waren. Einige Läufer aus dem Ausland gaben später in Interviews zu Protokoll, dass sie sich regelmäßig umgeschaut hätten, ob da nicht doch ein Einheimischer hinter ihnen käme. Sie hätten einfach nicht begreifen können, dass diese Begeisterung ihnen ganz allein gelten sollte.
Wer jene - schon vor dem Fernsehgerät für eine leichte Gänsehaut sorgenden - Bilder von sich in mehreren Reihen hintereinander drängenden, die Hänge hinauf ziehenden Zuschauermassen entlang einer immerhin über acht Kilometer langen Schleife gesehen hat und dann auch noch berücksichtigt, dass alleine auf den Tribünen einige zehntausend Plätze vorhanden waren, wird die Zahl bedenkenlos akzeptieren.
Gleichzeitig wird man in Zukunft allerdings auch noch stärker an den Meldungen von der angeblich halben oder ganzen Million zweifeln, die laut so manchem Veranstalter bei seinem Marathon zugegen gewesen sein sollen. Die eher bescheidene, nicht zu übermäßigen Übertreibungen neigende Mentalität der Skandinavier sorgt da wohl doch für deutlich realistischere Angaben und einen brauchbaren Vergleichsmaßstab, den man sich immer einmal vor Augen halten kann.
 |
 |
 |
| Die norwegische Hauptstadt Oslo bietet am nach ihr benannten Fjord eine große Bandbreite mit viel Modernem und auch einigem Alten | ||
Vermutlich ist der Holmenkollen sogar die wichtigste und bekannteste Sehenswürdigkeit der Stadt Oslo. Übrigens wäre bei dieser Art der Formulierung genau genommen "der Holmenkoll" angebracht, denn der Artikel wird in den skandinavischen Sprachen nicht vorangestellt sondern ans Wort angehängt, was natürlich gelegentlich zu Verwirrung führt. Doch da sich der Name im Deutschen längst durchgesetzt hat, bleiben wir auch weiter beim eigentlich doppelten "der Holmenkollen".
Ansonsten dürften die meisten der norwegischen Hauptstadt jedenfalls kaum irgendwelche Wahrzeichen oder bekannten Bauwerken zuordnen können. Oslo ist in dieser Hinsicht wohl doch eher eine große Unbekannte. Ein Schicksal, das man allerdings durchaus mit den anderen nordischen Metropolen teilt.
Natürlich eher zufällig, aber irgendwie doch recht passend, dass Kopenhagen wohl ausgerechnet mit der nur etwas über einen Meter hohen kleinen Meerjungfrau dabei noch die besten Karten hat. Sehenswert sind diese Städte natürlich dennoch allesamt. Und selbstverständlich hat jede von ihnen trotzdem auch ihre typischen und unverkennbaren Symbole sowie einen eigene Charakter.
Aber wieso geht es überhaupt, mitten in einer Großstadt, in deren Umfeld mehr als ein Drittel der nur ungefähr fünf Millionen Norweger lebt, Wettbewerbe in einer Freiluftsportart wie dem Skilanglauf zu veranstalten? Nun, als Metropole ist Oslo bezüglich seiner Weiträumigkeit dem von ihm aus regierten Staat - dessen Quadratkilometerzahl ja die deutsche noch um rund zehn Prozent übertrifft - durchaus ziemlich ähnlich.
Nur wenige Hauptstädte in Europa erstrecken sich nämlich administrativ über eine größere Fläche als die norwegische. Doch haben diese dann eben zumeist auch deutlich mehr Einwohner, als jene gute halbe Million, die dem eigentlichen Verwaltungsgebiet Oslos ohne die eigenständigen Vororte zuzurechnen sind.
In Deutschland sind außer Berlin und Hamburg jedenfalls alle Großstädte flächenmäßig - zum Teil sogar deutlich - kleiner. Und die beiden Stadtstaaten können trotz sechs- bzw. dreifach so großer Bevölkerung dennoch nicht einmal die doppelten Ausmaße bieten. Selbst die österreichische Metropole Wien reicht bei ebenfalls knapp dreimal so vielen Menschen in Bezug auf das Areal nicht ganz an Oslo heran.
Und so beginnt dann nicht nur bereits wenige Kilometer außerhalb des Zentrums eine Bebauung, die man mit ihren von großen Gärten umgebenen, bunten skandinavischen Holzhäusern fast schon ländlich genannt werden kann. Über die Hälfte des Stadtgebietes ist zudem auch von Wald bedeckt. Ja selbst der geographische Mittelpunkt von Oslo befindet sich deshalb bereits mitten in der Natur.
In einem gar nicht einmal so großen Halbkreis legt sich insbesondere im Osten und Norden eine Hügelkette direkt um Oslo herum, von der man auf die Stadt zu ihren Füßen herunter blicken kann, und bildet so beinahe ein natürliches Amphitheater. Über diesen in seinen höchsten Punkten mehr als siebenhundert Meter aufragenden Höhenzug erstrecken sich riesige Waldgebiete, die unter dem Namen "Marka" - eine altnordische Bezeichnung, die sich auf deutsch am besten schlicht mit "der Wald" oder "die Wildnis" übersetzen lässt - bekannt sind.
Den zentralen Teil dieser Landschaft, die nicht nur den gleichnamigen Stadtbezirk umfasst sondern weit über die Grenzen Oslos in die umliegenden Provinzen Akershus, Oppland, Buskerud und Østfold hinaus reicht, nennt man "Nordmarka". Und tatsächlich findet sie sich, wie es der Name vermuten ließ, ziemlich genau nördlich des Stadtkerns. Nur fünf Kilometer von Rathaus, Königschloss und Parlament entfernt ist nichts mehr außer Natur.
Der Fünfziger der Holmenkollen-Spiele müsste also nicht einmal auf mehreren kurzen Runden gelaufen werden. Die an das Skistadion angrenzenden Wälder wären weit genug eine einzige große Schleife abzustecken. Und beim Holmenkollen-Volksskimarathon, der jedes Jahr im Februar mehrere Tausend Sportler an den Start bringt, tut man das dann auch tatsächlich.
 |
 |
 |
| Vorbei an Universität (links) und Nationaltheater (rechts) führt die Karl Johans Gate direkt aufs königliche Schloss (mitte) zu | ||
Unzählige Kilometer Loipen - ein ebenfalls ursprünglich aus Norwegen stammendes Wort, das man dort allerdings "Løype" schreibt - ziehen sich im Winter durch das Waldgebiet direkt vor den Toren der Hauptstadt. Und selbstverständlich wird dieses dichte Netz auch reichlich genutzt. Denn die Skandinavier sind vom Langlauf nicht nur als Zuschauer sondern noch viel mehr als Aktive angetan.
Doch auch ohne Ski kann man in der Heimat des Wintersports einen Marathon absolvieren. Und zwar im Sommer. Der Nordmarka Skogsmaraton macht's möglich. Viel treffender könnte der Name für einen solchen Landschaftslauf auch gar nicht gewählt sein, bedeutet doch "skog" ebenfalls nichts anderes als "Wald" - diesmal jedoch nicht im Altnordischen sondern im aktuellen norwegischen Sprachgebrauch.
Seit 1994 wird am Rande von Oslo über zweiundvierzig Kilometer gelaufen.
Und im Gegensatz zum großen Bruder unten in der Stadt, der um die Jahrtausendwende
einige Male ausfiel, können die Organisatoren von IL GeoForm und Jernbaneverkets
Bedriftsidrettslag - die Betriebssportgemeinschaft des norwegischen Eisenbahnnetzbetreibers,
der auch einer der wichtigsten Sponsoren ist - seitdem auf eine ununterbrochene
Reihe von Veranstaltungen zurück blicken.
Ein wenig leichter als ihre Kollegen vom "richtigen" Oslo Maraton haben es die Macher des Skogsmaraton - wer nun schon zum wiederholten Male das bei "Marathon" eigentlich doch übliche "h" vermisst hat, sei daran erinnert, dass nicht nur die Norweger sondern alle Skandinavier nach ihren Rechtschreiberegeln darauf verzichten - natürlich schon. Denn mit Straßensperrungen, Umleitungen oder ähnlichen Problemen müssen sie sich nicht wirklich lange aufhalten.
Einige hundert Sportler durch den Wald laufen zu lassen, erfordert dann doch bei weitem nicht den organisatorischen Aufwand, der für eine Veranstaltung mitten im Stadtzentrum notwendig ist. Und so kommt man mit Teilnehmerzahlen, die von Beginn an praktisch konstant zwischen drei- und vierhundert lagen, ganz gut zurecht. Insbesondere da zuletzt die Werte sogar noch einmal deutlich anstiegen und die Vierhundertermarke regelmäßig überboten wurde.
Auch dieser Marathon lässt sich als Beleg für die nach längerem
Siechtum in den letzten Jahren langsam doch wieder - im wahrsten Sinne des Wortes
- auf die Beine kommende Laufszene Norwegens anführen. Es ist durchaus
interessant zu sehen, dass sich die Verhältnisse damit genau umgekehrt
zum deutschsprachigen Raum entwickeln, wo in der jüngeren Vergangenheit
eigentlich hauptsächlich Rückschritte zu beobachten waren.
Doch selbst wenn die Zahl der Veranstaltungen genau wie die der Läufer in Norge inzwischen deutlich wächst, bewegt man sich in ganz anderen Größenordnungen als hierzulande. Denn der Nordmarka Maraton ist nach dem großen Bruder unten im Tal auch weiterhin der zweitgrößte seiner Zunft im Land.
Und das sogar recht unangefochten. In den nach Oslo nächstgrößeren Städten Bergen, Trondheim und Stavanger gibt es zwar auch Marathonrennen. Allerdings ist man bei diesen schon froh, bezüglich der Starterzahl überhaupt in die Nähe der Dreistelligkeit zu gelangen. Ein "ganz normaler" Marathon in Norwegen kommt sogar selten über den Wert fünfzig hinaus. Und für manche - wie die auch schon von LaufReport besuchten Veranstaltungen in Stokmarknes und Leknes auf den Lofoten - wären sogar zwanzig Marathonis schon ein Riesenerfolg.
Doch sind da eben keine Agenturen am Werk, die sich an möglichst hohem Gewinn orientieren, entsprechend groß die Trommel rühren und das Ganze schnell wieder sein lassen, wenn nicht wirklich viel dabei heraus kommt. Ausrichter sind ganz traditionelle Vereine mit ehrenamtlichen Helfern, bei denen es schon in Ordnung ist, wenn die Sache praktisch Null auf Null aufgeht und vielleicht am Ende sogar ein paar Kronen übrig bleiben.
Und außerdem bietet man in der Regel zusätzlich ein ziemlich breites Programm von Schülerrennen über kürzere Hobbyläufe bis zu Zehnern und Halbmarathons an, so dass zumindest die Gesamtteilnehmerzahlen sich in einem Rahmen bewegen, in dem der Aufwand lohnt. Da ist der Nordmarka Skogsmaraton, bei dem man nichts anderes als zweiundvierzig Kilometer laufen kann, eine ziemliche und vielleicht sogar wirklich die einzige Ausnahme.
Der ebenfalls Mitte Juni ausgetragene Marathon im nordnorwegischen Tromsø ist von der Streckenauswahl auch deutlich breiter aufgestellt. Doch immerhin absolvieren dort ebenfalls rund drei- bis vierhundert Teilnehmer die lange Distanz, so dass man ihn tatsächlich noch als so etwas wie einen Konkurrenten des Skogsmaraton von Oslo bezeichnen könnte und er in der Regel stets auf Platz drei der Größenrangliste einkam.
Allerdings wird diese Veranstaltung, die mit dem Laufen unter der Mitternachtssonne
wirbt, fast mehr von Ausländern als von den Einheimischen selbst frequentiert.
Beim Durchblättern der Ergebnisliste findet sich jedenfalls hinter kaum
einem Drittel der Einträge die Länderbezeichnung Norwegen. Viel zu
weit weg vom Rest des Landes befindet sich das Städtchen halt einfach.
Siebzehnhundert Straßenkilometer von Oslo, achtzehnhundert von Bergen und gar zweitausend von Stavanger liegt es keineswegs um die Ecke. Der Weg nach Hamburg oder Berlin wäre kürzer, der nach Stockholm oder Kopenhagen sowieso. Selbst von Trondheim der nördlichsten der norwegischen Großstädte sind es noch weit über tausend Kilometer bis zur Hauptstadt der Region Troms, die zwar ein ganzes Stück größer als Hessen ist, aber nur einhundertfünfzigtausend Einwohner hat.
 |
 |
| Schon kurz nachdem das Warten auf
den Start beendet ist ... |
… beginnt das stetige auf und ab durch die urwüchsigen norwegischen Wälder |
Da ist das Einzugsgebiet rund um Oslo - das von den Einheimischen eher wie "Uschluu" ausgesprochen wird - natürlich deutlich vielversprechender. Etwa die Hälfte aller Norweger kann es schließlich in ein oder zwei Fahrstunden erreichen. Und selbst wenn es sich beim Nordmarka Skogsmaraton um einen reinen Landschaftslauf handelt, ist sogar die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln problemlos möglich.
Es dürfte wohl ziemlich einzigartig sein, dass man zu einem Naturmarathon mit der U-Bahn - in Oslo "Tunnelbane" oder kurz "T-bane" genannt - kommt. Doch in der norwegischen Hauptstadt fährt man ja schließlich mit diesen Zügen sogar zum Skilaufen. Und wenn die Station nur wenige Schritte von der Startlinie entfernt liegt, bieten sich diese Form der Anreise nicht nur für auswärtige Besucher ohne fahrbaren Untersatz wirklich geradezu an.
Praktisch bis an den Waldrand fährt die T-bane-Linie 3 zur Endhaltestelle Sognsvann und bedient damit nicht nur den als Naherholungsgebiet dienenden See, der ihr den Namen gab, sondern auch die direkt nebenan gelegene Norwegische Sporthochschule. Die dort vorhandenen Anlagen bieten natürlich eine ideale Infrastruktur für einen Marathon dieser Größenordnung.
Alle U-Bahn-Strecken - und damit selbstverständlich auch die mit der Nummer drei - führen zudem durch den zentralen Innenstadttunnel, so dass man im Normalfall nicht nur am Bahnhof "Oslo sentralstasjon" sondern an sämtlichen Haltepunkten im Zentrum einsteigen und von dort aus dann direkt zum Marathon-Startplatz durchfahren kann.
Nun, im Normalfall wäre das so. Doch im Juni 2011 leuchten an den Eingängen zu den Stationen knallgelbe Schilder mit der Aufschrift "T-banetunnelen er stengt" - auf Deutsch "der U-Bahn-Tunnel ist geschlossen" - und zwar "lørdag og søndag", also samstags und sonntags, das gesamte Wochenende über. Nichts ist es also mit der schnellen direkten Anfahrt.
Allerdings gäbe es, wie auf den Tafeln ebenfalls zu lesen ist, als Alternative einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zur Station Majorstuen, wo die Züge den Tunnel ansonsten wieder verlassen und sich die Linien überirdisch in die verschiedenen Richtungen auseinander fädeln. Von dort würden die Bahnen dann wieder fahren. Zwischen einer viertel und einer halben Stunde kostet die Sperrung allerdings dennoch.
Wer etwas Puffer eingeplant hat, bekommt damit keine Probleme. Nur bei knapper Kalkulation könnte es doch etwas eng werden. Aber eigentlich wäre eine solche nicht unbedingt nötig. Eine hierzulande recht unübliche Startzeit von elf Uhr macht das rechzeitige Erscheinen zu einer durchaus lösbaren Aufgabe.
In Skandinavien ist es allerdings völlig normal, zu so einer Stunde mit einer Laufveranstaltung zu beginnen. Trotz der im Gegensatz zum dicht besiedelten Mitteleuropa doch eher großen Entfernungen sind so für viele Laufwillige auch aus dem weiteren Umfeld An- und Abreise am gleichen Tag möglich.
Dass der Normarka Skogsmaraton am "lørdag" stattfindet, ist in Norwegen genauso wenig etwas Besonders. Tendenziell finden sich die Wettkampftermine sogar häufiger an einem Samstag als am "søndag", wie ein Blick in den Kalender des Ausdauersportmagazins "Kondis" - die wohl beste Übersicht über die norwegischen Rennen - zeigt.
 |
 |
 |
| Mit viel Schwung geht es hinunter zum Skjersjø, an dessen kleinen Damm sich die erste Verpflegungsstelle befindet | ||
Und noch etwas lässt sich beim Stöbern in dieser sowohl in gedruckter Form vorliegenden als auch mit Suchfunktionen im Internet verfügbaren Liste erkennen. Auch unter der Woche ist nämlich in Norwegen eigentlich immer irgendwo etwas los. Nur kurz ist aufgrund der Witterungsverhältnisse die skandinavische Laufsaison. Sie beginnt im Mai und ist mit dem September praktisch schon wieder abgeschlossen. Denn in den letzten drei Monaten des Jahres zusammen bleibt die Gesamtzahl der Rennen landesweit im zweistelligen Bereich.
Doch dafür sind im Sommer die Tage eben auch nahezu endlos. Nördlich des Polarkreises sind sie das sowieso, schließlich geht dort eine Zeit lang die Sonne überhaupt nicht mehr unter. Es ist jene "Midnatsol", die dem Marathon in Tromsø den Namen gab und die jedes Jahr zigtausende von Touristen zur langen Fahrt in Richtung Nordkap aufbrechen lässt.
Aber im Süden des Landes wird es insbesondere im Juni und Juli ebenfalls kaum noch richtig dunkel. Selbst wenn sich das Zentralgestirn dort einige Stunden hinter den Horizont zurück zieht, folgt auf die Abenddämmerung dennoch fast übergangslos schon die Morgendämmerung. Runde neunzehn Stunden steht jedenfalls am längsten Tag des Jahres die Sonne in Oslo am Himmel.
So nutzt man die knappe Zeit, die zur Ausrichtung von Laufwettbewerben bleibt, bevor Kälte und Dunkelheit wieder zurück kommen, und veranstaltet auch an den langen hellen Abenden der Werktage immer wieder Rennen. In der Regel sind diese eher kurz, meist deutlich weniger als zehn Kilometer. Und oft gibt es gerade in den größeren Städten wie in Trondheim regelrechte Serien, die im Extremfall jede Woche stattfinden.
 |
 |
| Hinter dem Skjersjø führt die Strecke aber bald wieder bergauf | |
Auch am Sognsvann wird "hver onstag" - jeden Mittwoch - zwischen April und Oktober gelaufen. Eine, zwei oder drei Runden, zwischen gut drei und knapp zehn Kilometer sind bei der "Sognsvann rundt" im Angebot. "Karusell" heißt das ganze allerdings keineswegs, weil es dabei im Kreis herum geht. Es ist der in Norwegen allgemein übliche Begriff für Laufserien.
Wenn es einen auswärtigen Läufer während des Sommerhalbjahrs einmal unter der Woche nach Oslo verschlägt, findet er also noch problemloser eine Startgelegenheit als am Wochenende. Und zwar einerseits mitten in der Natur und andererseits dennoch mit direkter Nahverkehrsanbindung.
In einem großen Doppelbogen in Form eines Fragezeichens schraubt sich der Sognsvannsbane - die im Deutschen weibliche Bahn ist im Norwegischen männlich - den Berg hinauf. Innerhalb von sechs Kilometern gewinnt sie gut einhundertfünfzig Meter bis zur fast exakt zweihundert Meter über dem Meer liegenden Endstation. In kaum einem anderen Metronetz dürfte es ähnliches geben.
Wobei das noch lange nicht die höchstgelegene Station ist. Holmenkollbanen-Züge - man beachte die Stellung des "en" - bringen die Zuschauer auf ihrem Weg zu den Springen am Holmenkollbakke - wie man unter Einhaltung der grammatikalischen Regeln den im Deutschen gebräuchlichen, aber dennoch gleich doppelt fehlerbehafteten "Holmenkollen-Bakken" eigentlich schreiben müsste - auf zweihundertachtzig Meter hinauf.
Der eilige Umbau der Holmenkoll-Bahn für die Weltmeisterschaft hat dabei zu einigen Kuriosa geführt. Denn um die Kapazität zu erhöhen, wurde zwar die Station "Holmenkollen" in der Nähe des Stadions so umgebaut, dass dort neuere und vor allem längere Züge halten konnten. Viele andere Haltestellen haben aber noch kurze Bahnsteige. Deshalb müssen an ihnen einige der Türen verriegelt werden, damit niemand ins Leere aussteigt.
Und der Haltepunkt "Gulleråsen" liegt so unglücklich in einer engen Kurve, dass zwischen den neuen Waggons und der Plattform an einigen Stellen eine Lücke von fast einem halben Meter klafft. Als Ergebnis können stadteinwärts führende Züge dort nicht mehr halten und müssen durchfahren. Auch den als ziemlich gründlich und sorgfältig geltenden Skandinaviern können also ab und zu kleine Fehler unterlaufen.
Doch der Bahnhof Holmenkollen ist noch immer nicht die höchstgelegene im Netz der T-bane. Denn die Züge fahren von dort weiter in Richtung Frognerseteren, keine fünf Streckenkilometer entfernt aber noch einmal fast zweihundert höher. Erst auf vierhundertsiebzig Meter enden die Gleise, die in der Innenstadt nicht nur unter der Erde sondern auch unterhalb des Meeresspiegels verlaufen, nach beinahe einem halben Kilometer Höhengewinn.
Spätestens auf diesem letzten Teil der Strecke, der manchmal mitten durch dichten Wald oder auch einmal direkt an einer Felswand vorbei führt, könnte man den Eindruck gewinnen, nicht in einer Metrolinie zu sitzen sondern mit einer Bergbahn durch die Alpen zu rollen. Doch bereits auf dem kurvigen Weg vom Stadtzentrum zum Holmenkollen hinauf öffnen sich immer wieder weite Blicke über den nach jedem Bogen noch tiefer unten liegenden Fjord.
 |
 |
| Der Weg bringt die Läufer hinauf zur kleinen Häusergruppe Bjørnholt, wo es für sie zum zweiten Mal etwas zu trinken gibt | |
Oslo ist schließlich nicht nur von Bergen und Wäldern umgeben, sondern liegt auch noch am Meer, genauer am nach der Stadt benannten Oslofjord. Dieser trägt zwar die gleiche Bezeichnung wie seine bekannteren und meist auch noch deutlich spektakuläreren Vettern im Westen des Landes, hat allerdings trotzdem eine etwas andere Entstehungsgeschichte.
Denn nicht die eisigen Massen eines Gletschers haben ihn ins Gestein hinein gefräst. Es ist vielmehr das Ergebnis eine tektonischen Bruchzone, in der sein Ost- und sein Westufer immer weiter auseinander drifteten und schließlich mit Wasser voll liefen. Doch waren diese wissenschaftlichen Feinheiten natürlich noch nicht bekannt, als der Oslofjord seinen Namen bekam.
Rund hundert Kilometer tief dringt er ziemlich exakt von Süd nach Nord
ins Land hinein, verengt sich zwischendurch auf nur noch zwei Kilometer, um
sich zum Ende hin dann doch noch einmal deutlich zu weiten und in einer scharfen
Kehre um eine Halbinsel herum von Süd-Nord auf Nord-Süd-Richtung zu
drehen, wodurch er fast die Form eines Bischofsstabes erhält. Und genau
um diesen Bogen herum ist die Stadt Oslo gewachsen.
Im schmalen Norwegen ist eine Lage am Meer allerdings völlig normal. Von den zwanzig größten städtischen Zentren des Landes - man ist damit wohlgemerkt bereits in der Größenordnung von zwanzigtausend Bewohnern gelandet - befinden sich nur zwei im Landesinneren. Und selbst diese beiden, die von den Olympischen Spielen 1994 bekannten Lillehammer und Hamar kommen nicht ganz ohne Wasser aus. Sie haben sich nämlich am Ufer des größten norwegischen Sees Mjøsa breit gemacht.
Im zerrissenen Westen und noch mehr im Norden des Landes gibt es ohnehin kaum eine Siedlung, die nicht an irgendeinem Fjord liegt. Und oft ist der Wasserweg zwischen ihnen deutlich kürzer als die umständliche Verbindung über Land. So haben die berühmten Hurtigruten-Schiffe, die man hierzulande eher als Feriendampfer wahrnimmt, dort für die Einheimischen auch noch immer eine wichtige Transportfunktion.
Fast pathetisch nennt man "die schnelle Linie", zu der man in Norwegen eine ganz besondere Beziehung hat, dann auch "Reichsstraße Nummer eins". In den Junitagen des Jahres 2011, in denen nicht nur der Nordmarka Skogsmaraton stattfindet sondern auch die Sommersonnenwende ansteht, begleitet das norwegische Fernsehen eines der Schiffe auf der Reise zwischen den Städten Bergen und Kirkenes.
"Hurtigruten: Minutt for minutt" nennt sich diese Sendung, die zu den längsten jemals produzierten zählt. Denn tatsächlich wird im Kanal NRK2 sechs Tage lang ununterbrochen direkt von Bord übertragen, wie die "Nordnorge" zwischen Gebirgen und Inseln die Küste hinauf gleitet und in die jeweiligen Häfen ein- oder ausläuft. Beleuchtungsprobleme gibt es natürlich keine, denn für ausreichendes Licht sorgt ja selbst mitten in der Nacht die Midnatsol.
 |
 |
| In einem heftigen Gefälle gehen die gewonnen
Höhenmeter jedoch schnell wieder verloren … |
…doch dafür ist der Blick in der Serpentine wirklich imposant |
In den meisten anderen Ländern wäre ein solches Programm, bei dem ja eigentlich fast nichts passiert, wohl kaum denkbar. In Norwegen hat man in den Spitzenzeiten dagegen Anteile von rund einem Drittel. Und glaubt man den Auswertungen der Quotenermittler schaut weit über die Hälfte aller "nordmenn" zumindest zwischendurch immer mal wieder hinein.
Wie viele andere Städte im Land regelrecht eingekeilt zwischen Bergen und Wasser bietet Oslo allerdings auch eine Fülle von Freizeitmöglichkeiten. Und die Vielzahl der in etlichen Hafenbecken dümpelnden Boote zeigt, dass den Osloern der Sinn nicht nur nach Skilaufen oder Wandern sondern auch ab und zu nach Segeln steht. Da wundert es kaum noch, dass die norwegische Hauptstadt in den verschiedenen Ranglisten der lebenswertesten Metropolen meist ziemlich weit vorne landet.
Diese Verbindung macht sicher auch einen ganz besonderen Reiz, des Holmenkollen-Skistadions aus. Es dürfte wenige Schanzen geben, von denen die Springer ihre Flüge mit Blick aufs Meer unternehmen. Und auch von den Loipen der Langläufer und Biathleten ist der Fjord - wie zum Beispiel beim foto- und telegenen Anstieg an der Holmenkollen-Kapelle - immer wieder sichtbar.
Noch besser ist das Panorama - fast möchte man sagen "natürlich" - vom noch einmal deutlich höher gelegenen Ausflugslokal Frognerseteren in der Nähe der gleichnamigen Bahnstation. Zumindest aufmerksamen Beobachtern der WM-Übertragungen ist der Name dieser früheren Alm - der in Norwegen häufige norwegische Ortsnamensbestandteil "seter" bedeutet nichts anderes - vielleicht noch im Gedächtnis.
An dieser kleinen Holzhausgruppe befand sich nämlich nicht nur bei den meisten Rennen der vom Stadion am weitesten entfernte und gleichzeitig höchste Punkt der Strecke. Dort hatten auch Zehntausende den Läufern zugejubelt und das Ganze mit ihren Fahnen zu einer gigantischen Party in blau und rot gemacht.
Nicht ganz so beeindruckend wie die Fahrt in Richtung Holmenkollen und Frognerseteren ist allerdings die mit der Sognsvann-Linie. Trotz des beträchtlichen Anstieges führt sie meist durch dichter bebautes Gebiet. Und selbst wenn es zur Endstation hin doch schon recht grün im Umfeld wird, kann man sich kaum vorstellen, dass gleich nebenan weitgehend unberührte Wälder beginnen sollen. Der Startbereich wirkt jedenfalls erst einmal wie ein ganz normales, wenn auch recht großes Sportgelände. Das Jugendfußballturnier, das auf einem der Rasenplätze ausgetragen wird, verstärkt diesen Endruck nur noch.
 |
 |
| Der Abstieg endet am Bjørnsjø, dem nächsten See an der Strecke | Immer wieder führen Brücken über wild rauschende Bäche |
Über lange Wege kann man sich beim Nordmarka Skogsmaraton allerdings nun wahrlich nicht beklagen. Der Schilderbaum, der den Teilnehmern die Richtungen anzeigen soll, ist da eigentlich ziemlich unnötig. Denn die gesamte Organisation spielt sich in einem Radius von nicht einmal hundert Metern ab.
Eine Treppe führt hinunter ins Untergeschoss eines der Hochschulgebäude, wo in einem kleinen Vorraum die Startnummern verteilt werden. Das System, diese nach Altersklassen auszugeben, ist zwar nicht unbedingt weit verbreitet, macht es aber auch nicht unbedingt komplizierter. Die Angabe des Namens genügt und schon Sekunden später hat man ein ziemlich großes Stück Papier in der Hand.
Insbesondere für die wenigen gemeldeten Ausländer erübrigt sich so auch die Überlegung, wie ihre Startnummer denn nun auf Norwegisch lauten könnte. Kaum zwei Dutzend Namen lassen sich in der Startliste finden, die auf den ersten Blick nicht skandinavisch aussehen. Wobei jedoch zusätzlich ein paar Schweden ihre blau-gelben Trikots beim Nachbarn über die Strecke tragen, mit denen sie zumindest in sportlicher Hinsicht doch eine gewisse Rivalität verbindet.
Gerade im Skilanglauf gilt das natürlich seit vielen Jahrzehnten. Und das in Sverige als verhöhnende Geste für das Team der Tre Kronors aufgefasste - und vielleicht tatsächlich auch so gemeinte - Abdrehen des Norwegers Petter Nordhug vor dem Ziel während der Staffelentscheidung der WM goss da viel zusätzliches Öl ins Feuer. Der folgende Schlagabtausch in den Medien ging jedenfalls weit über das hinaus, was ansonsten zwischen den beiden Nationen üblich ist.
Der Versuch, die Zahlenkombination in der Landessprache zu nennen, hätte jedoch sowieso eher etwas mit freundlichem Entgegenkommen an den Gastgeber als - wie gelegentlich im Süden Europas - mit echter Notwendigkeit zu tun. Denn zumindest Englisch beherrschen fast alle Skandinavier ohnehin ziemlich fließend. Eigentlich sind sie es sogar absolut gewohnt, sich mit Fremden in dieser Sprache zu verständigen.
Aber auf ein "jeg er Tysker og snakker bare litt Norsk" - was man mit ein bisschen Phantasie und Sprachgefühl als "Ich bin Deutscher und spreche nur wenig Norwegisch" entschlüsseln kann - kramen etliche sogar augenblicklich einige Brocken auf Deutsch heraus, das sie zumeist ebenfalls in der Schule gelernt haben. Es erübrigt sich beinahe zu erwähnen, dass dieses in der Regel auch noch wesentlich besser ausfällt als das zuvor erwähnte "bisschen Norwegisch".
Direkt hinter der Startnummernausgabe befinden sich die Umkleidekabinen. An einem kleinen Zelt auf dem Grasstreifen vor dem Gebäude kann man seine Wertsachen abgeben, die man nach dem Rennen später auf dem Rückweg zu den Garderoben an den zu diesem Zeitpunkt nicht mehr benötigten Tischen der Startnummernausgabe zurück erhält. Und auch die Transparente für Start und Ziel hängen kaum fünfzig Meter entfernt über dem Weg.
 |
 |
| An manchen Stellen ragt statt dem sattem Grün der Bäume auch nur der blanke Fels am Wegesrand empor | |
Dahinter ist mit Holzböcken und Flatterband eine Art Startblock abgesperrt. Und tatsächlich kommt man kurz vor elf Uhr nur noch dann in diesen Aufstellungsbereich hinein, wenn man einen der beiden Abrisse an der Nummer bei den dort postierten Ordnern abgibt. Die Zettel, die anschließend in Umschlägen landen, werden später wohl zur Kontrolle darüber, wer überhaupt gestartet ist, benutzt.
Der andere Streifen wird dann wie üblich im Ziel abzugeben sein. Wenn man ihn auch wirklich wieder zurück bringen kann und nicht schon vorher verloren hat. Denn pünktlich zum Start fallen erste Tropfen vom Himmel. Nach einem völlig verregneten und mit nicht einmal fünfzehn Grad auch ziemlich kühlen "fredag" waren auch für den Samstag schließlich ebenfalls einige Schauer angedroht. Doch unterwegs wird es später zum Teil sogar regelrecht schütten und nicht nur die Läufer sondern eben auch die Startnummern ziemlich durchweichen.
Wenigstens die Temperaturen sind gegenüber dem Vortag aber wieder etwas höher. So herrschen zum Laufen nicht einmal die allerschlechtesten Bedingungen. Und dass man mit solchen Witterungsverhältnissen im skandinavischen Sommer ohnehin immer einmal rechnen muss, ist ja kein echtes Geheimnis. Ein wenig wie blanker Hohn wird es dann allerdings schon wirken, als nach dem Rennen zum Abend hin doch noch die Sonne am immer blauer werdenden Himmel erscheint.
Nur wenige Meter bleibt der Weg auf dem Sportgelände nach dem Start asphaltiert. Dann wechselt der Untergrund schon zu jenem Schotter, den er den größten Teil der Strecke in leichten Variationen beibehalten wird. Und nachdem man die kleine Kuppe hinter dem Rasenplatz, auf dem die kleinen Fußballer dem Ball hinterher jagen, überwunden hat, ist man tatsächlich fast schon in einer anderen Welt. Dabei hat man in diesem Moment noch nicht einmal die Markierung mit der "42" passiert, die auf dem Rückweg den Endspurt einleiten soll.
Vor den Läufer breitet sich das Sognsvann aus, einer jener wirklich unzähligen Seen, die der skandinavischen Landschaft vom Flugzeug aus das Aussehen eines grün-blauen Flickenteppichs geben. Wirkliche Wildnis ist das zwar noch nicht. Der Grillplatz und die hölzernen Toilettenhäuschen, die man passiert, sind untrügliche Belege dafür, dass es sich um ein beliebtes Ausflugsziel handelt.
Und dennoch entspricht er mit den bewaldeten Hängen rundherum, den gelegentlich am Ufer herum liegenden Felsbrocken und der kleinen Insel in der Mitte irgendwie schon genau dem Klischee. Es ist exakt jenes Bild, das man beim Gedanken an die ursprüngliche Natur im Norden Europas vor Augen hat.
Gleich mehrere Wege führen über das kleine Freizeitgelände an dieser Ecke des Sognsvann. Doch sowohl die Sägemahlpfeile am Boden als auch die kleine Markierungstafel - zusammen mit den an den Bäumen zusätzlich noch aufgehängten Flatterbändern ist die Strecke so gleich dreifach gekennzeichnet, man muss sich also wirklich anstrengen, wenn man sich unterwegs verlaufen möchte - zeigen direkt auf eine Wiese.
Die Grasfläche, die es da gleich zu Anfang zu überqueren gilt, dürfte sowieso ein wenig feuchter sein. Doch nach dem Regen des Vortages ist sie nun endgültig vollkommen durchgeweicht. So quietscht es dann doch ziemlich unter den Füßen der Marathonis. Und mancher aus dem auf der Suche nach einigermaßen trockenem Untergrund weit aufgefächerten Feld steht auch schon einmal fast bis zu den Knöcheln im Schlamm.
Für Skandinavier sind solche Bodenverhältnisse nicht wirklich ungewohnt. Schließlich sind Moore ein fester Bestandteil nordischer Ökosysteme. Und da abseits der Städte das Wanderwegenetz fast nichts mit dem gemein hat, was man hierzulande kennt, sondern man vielmehr im Stile eines Orientierungsläufers von Markierung zu Markierung seinen eigenen Weg finden muss, sagt man den Norwegern nicht zu unrecht nach, dass sie mit Gummistiefeln zum Wandern gehen.
Amüsant ist es allerdings zu sehen, dass sich dieses in der freien Natur vermutlich sogar ziemlich zweckmäßige Schuhwerk längst zu einem modisches Accessoire entwickelt hat. Denn auch in den Fußgängerzonen von Oslo kann man zuhauf jungen Damen begegnen, die ihre mit verschiedenen Farben und Mustern verzierten Gummistiefel auf dem Straßenpflaster spazieren tragen.
Hinter der kurzen Passage über die Wiese mündet die Marathonstrecke schnell wieder auf einen Waldweg, der die rund vierhundertfünfzig Köpfe umfassende Läuferschar vom See wegführt. Dass später eine Rekordzahl von 502 Zieleinläufen - womit man in diesem Jahr fast auf den Punkt genau gleichauf mit Tromsø liegt - verkündet werden kann, ist dazu nicht der geringste Widerspruch.
Denn wer glaubt, mehr als sechs Stunden zu benötigen, darf bei einem vorgezogenen Start bereits um neun Uhr auf die Strecke gehen. Als kleine Warnung steht dazu allerdings auch in der Ausschreibung, dass alle Frühstarter, die dann doch deutlich schneller wären, damit rechnen müssten unterwegs keine Getränke zu bekommen, da die Verpflegungsposten dann noch nicht besetzt sein würden.
Nur ganz langsam gewinnt man an Höhe. Aber wirklich flach ist der Weg deshalb trotzdem keineswegs. Ein stetiges Auf und Ab über kleine, aber oft recht steile Kuppen gibt dem Lauf ganz im Gegenteil fast schon den Charakter einer Achterbahnfahrt. Obwohl der Kurs vom Start bei zweihundert Metern nur auf etwas mehr über vierhundert Meter über dem Meer hinauf klettert, sorgen immer neue Buckel dafür, dass in der Summe ein Vielfaches an Höhemetern zusammen kommt.
 |
 |
| Der größte Teil der Wendestrecke führt am See Hakkloa entlang | |
Nach einiger Zeit mündet der Kurs in eine etwas breitere Schotterpiste ein. Während man bisher auf dem schmalen, kurvigen und welligen Weg wohl selbst mit einem Allradfahrzeug seine Mühe gehabt hätte, ist das jetzt schon eher einer jener "Skogsbilveier", von denen in der Streckenbeschreibung die Rede ist. "Wald-Autostraße" bedeutet das ungefähr, denn die Norweger haben sich ihre Abkürzung des ursprünglichen Wortes "Automobil" genau vom anderen Ende geholt.
Doch die Barriere, um die man wenig später am kleinen Gehöft "Nordseter" herum laufen muss, zeigt schnell, dass beileibe nicht jeder Osloer - ein Wort das es übrigens in der norwegischen Sprache im Gegensatz zum "Bergenser" aus Bergen und dem "Trondheimer" aus Trondheim gar nicht gibt, man muss vielmehr sagen "ich bin aus Oslo" - mit seinem Wagen im Wald herum kurven kann.
Das Gebiet steht schließlich weitgehend unter Naturschutz. Und nur wer eines der wenigen bereits bestehenden Häuser besitzt - Neubauten werden nicht mehr genehmigt - oder eine der mehr als dreißig Wanderhütten oder -lokale in der Region bzw. eben die Verpflegungsstände eines Marathons versorgen will, darf mit dem Fahrzeug hinein fahren. Ansonsten bleibt der Wald Radfahrern, Wanderern und Läufern mit oder ohne Ski vorbehalten.
Hinter der kleinen Lichtung am Bauernhof verschwindet die Forststraße, die nun recht gleichmäßig bergan führt, schnell wieder im dichten Gehölz. Rechts unten rauscht einer der unzähligen norwegischen Wildbäche zwischen Felsen dem Tal entgegen. Vom Hang auf der linken Seite kommen immer wieder kleine Wasserfälle oder Kaskaden herunter, die ihm nur noch weitere Flüssigkeit zuführen.
Auch diesen "elv", wie diese Flüsse in Norwegen heißen, während ihre schwedischen Verwandten "älv" genannt werden, zapft man wie so viele andere zur Stromerzeugung an. Nahezu ihren gesamten Energiebedarf erzeugen die Norweger nämlich durch Wasserkraftwerke. Selbst geheizt wird meist mit Strom. Gleichzeitig kann man dadurch die Förderung aus den großen Öl- und Gasvorräte in der Nordsee zu nahezu hundert Prozent exportieren, was dazu beiträgt das Land zu einem der reichsten der Welt zu machen.
Dabei ist Norwegen erst seit 1905 ein wirklich unabhängiger Staat. Denn im späten Mittelalter war das Land unter die Herrschaft der dänischen Könige gekommen. Formal handelte es sich zwar nur ein Staatenbund zweier gleichberechtigten, selbstständiger Reiche unter einem in Personalunion regierenden Herrscher. Doch immer stärker wurde er von Dänemark dominiert, während Norwegen mehr und mehr zu einer Kolonie ohne eigenen Einfluss absank.
Im Jahr 1814 musste das mit Napoleon verbündete Dänemark nach der Niederlage des französischen Kaisers Norwegen an das siegreiche Königreich Schweden, das mehrere Jahrhunderte lang immer wieder mit den Dänen um die Vorherrschaft im Norden Europas gekämpft hatte, abtreten.
Die norwegisch-schwedische Union wird von Historikern zwar als nicht ganz so einseitig angesehen. Norwegen konnte unter anderem seine eigene Verfassung, die in ihren Grundzügen noch heute gilt, durchsetzen, bekam ein eigenes Parlament und damit weitgehende innere Autonomie. Doch die wichtigen Entscheidungen fielen eben auch weiterhin im fernen Stockholm.
 |
 |
 |
| Heftiger Regen prasselt im Mittelteil des Rennens auf die Läufer nieder | ||
Nach langem zähem Ringen - das sich zwar oft in Details wie dem Streit um die jeweils zu hissenden Fahne drehte, bei dem es aber zum Beispiel auch gelang, das Vetorecht des schwedischen Herrschers gegen norwegische Gesetze abzuschaffen - löste sich Norwegen schließlich per Parlamentsbeschluss und anschließender Volksabstimmung einseitig aus dem Bund heraus.
Schweden akzeptierte die Entscheidung widerspruchslos und so ging die Trennung - zu einer Zeit, in der man solche Dinge eigentlich noch mit Hilfe von Waffen zu regeln pflegte, überraschend - völlig unblutig vonstatten. Die Norweger wählten sich daraufhin noch im gleichen Jahr ihren eigenen König.
Ein wenig Ironie der Geschichte ist es dann allerdings doch, dass es sich dabei ausgerechnet wieder um einen Prinzen handelte, der dem dänischen Herrscherhaus entstammte. Aus "Prins Carl" wurde so "Haakon VII. av Norge", der anschließend über ein halbes Jahrhundert die Krone seines neuen Landes trug.
Der zu diesem Zeitpunkt gerade geborene Thronfolger und spätere König Olav V war dann aber bereits endgültig ein richtiger Norweger. Denn als Kronprinz nahm er unter anderem an mehreren Skisprungkonkurrenzen am Holmenkollen teil. Und auch in späteren Jahren soll er mit seinen Brettern regelmäßig in der Bahn hinauf zum Osloer Hausberg gesichtet worden sein.
Seiner Popularität schadeten solche Aktionen natürlich keineswegs. Denn im ziemlich egalitär geprägten Norwegen kommen jegliche Standesdünkel eher schlecht an. Das im Holmenkollen-Stadion stehende Denkmal zeigt ihn dann auch nicht in einer der für solche Monumente typischen Posen sondern bei einer seiner Lieblingsbeschäftigungen, dem Skilaufen.
Ein Abzweig in Spitzkehrenform mit anschließendem Gefälle führt hinunter zum "Skjersjøen" genannten See. Der kleine Damm mit Holzbrücke, auf dem man ihn passiert, zeigt dass auch er nicht nur wegen der Stromgewinnung sondern auch als Trinkwasserreservoir für den Großraum Oslo in seinem Stand reguliert wird. Denn aus dem weiter unten gelegenen Maridalsvann, das nicht nur der Skjersjø sondern ein beträchtlicher Teil der Nordmarka-Region entwässert, deckt die Metropole fast ihren gesamten Bedarf.
Stets in Reichweite des Seeufers und doch meist durch etliche Baumreihen von ihm getrennt verläuft die Strecke immer weiter weg von der Stadt und immer weiter hinein in den norwegischen Skog. Ohne wirklichen Höhengewinn werden dabei die Schilder mit der "7" und der "8" passiert.
 |
 |
| Eine einfach Sägemehlmarkierung am Boden
zeigt den Umkehrpunkt an |
Sechs- bis siebenhundert Meter hoch sind die Berge, an denen der Marathon vorbei führt |
Wenn man ganz genau hinsieht, erkennt man, dass auch sie in einer norwegischen Variante von "corporate identity" konsequent in der verschnörkelten Schriftart "Mistral" gehalten sind, der man schon beim Logo, in der Ausschreibung und auf dem Schilderbaum begegnet war. Doch schon bei der neunten Markierung hat man den Skjersjø wieder verlassen und noch vor der zehnten beginnt ein lang gezogener Anstieg, der diesmal zudem eher ruppig ausfällt.
Selbst wenn es auf dem relativ breiten Forstweg optisch im ersten Moment gar nicht so wirkt, erreicht er in den steilsten Passagen nämlich durchaus zweistellige Prozentwerte. Spätestens als sich die Piste allerdings in mehreren Kurven den Hang hinauf windet, erinnert das Ganze dann doch ein wenig an eine Passstraße. Dafür ermöglicht das nun etwas offene Gelände aber auch einen Blick auf die gar nicht so niedrigen Berge ringsum.
Tatsächlich führt der Weg im Bogen über die Anhöhe hinweg und dahinter erst einmal wieder leicht bergab. Nach rund hundert innerhalb kürzester Zeit überwundenen Höhenmetern ist erst einmal wieder leichte Erholung möglich. Bald darauf taucht die kleine Häusergruppe mit dem Namen Bjørnholt auf, an der sich die zweite Versorgungsstelle befindet.
Da man bis dorthin bereits ungefähr zwölf Kilometer in den Beinen hat, sind Abstände zwischen den Verpflegungsposten zwar anfangs eher weit. Doch da man insgesamt neun von ihnen über die Distanz verteilt hat, wird das Netz dafür später umso dichter. Statt sich stur an die Fünf-Kilometer-Regel zu halten, wie man es im Süden Europas oft tut, hat man die eher pragmatische Lösung gewählt und die Tische an den jeweils günstigsten Stellen positioniert.
Im Gegensatz zur ersten am Skjersjø-Damm, die eine reine "Drikkestasjon" war, ist diese nach der feinen im Streckenplan gemachten Unterscheidung auch eine "Matstasjon", was nichts anderes heißt, als dass es nicht nur Wasser und Elektrolytgetränke sowie später auch noch Cola zu trinken sondern zusätzlich noch etwas zu Essen - genau das bedeutet "Mat" nämlich übersetzt - gibt.
Die angebotenen Bananen kennt man natürlich von fast überall auf der Welt. Bei den kleinen roten Pappschächtelchen auf den Tischen überlegt man im ersten Moment dann aber doch, was sich denn darin verbergen könnte. Es handelt sich um Rosinenpackungen, die einer der Sponsoren - ein Trockenobsthersteller - beigesteuert hat. Die unterschiedlichen Varianten der Wettkampfverpflegung sind halt immer wieder interessant.
Wie meist in Skandinavien sind die Häuser von Bjørnholt aus Holz errichtet. Dem traditionellen Baustoff begegnet man nicht nur in der Nordmarka sondern auch in den Außenbezirken der Hauptstadt noch immer recht häufig, wenn auch moderne Wohnblocks inzwischen meist aus Stein oder Beton errichtet werden.
Bis ins siebzehnte Jahrhundert bestand allerdings auch die Innenstadt Oslos weitgehend aus Holzbauten. In anderen größeren Städten Norwegens wie Stavanger oder Trondheim lassen sich davon auch heute noch etliche im Zentrum finden. Und die berühmte Brygge von Bergen, das alte Hanseviertel, hat es sogar auf die Weltkulturerbeliste geschafft. In Oslo sucht man sie dagegen vergeblich.
Gleich mehrfach war die Stadt nämlich während des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit nieder gebrannt. Nachdem sie zuvor jedes Mal wieder aufgebaut worden war, beschloss der dänische König Christian IV nach dem letzten großen Feuer 1624 eine Verlegung nach Westen und komplette Neuerrichtung mit Steingebäuden. Das rechteckige Muster dieser Planstadt lässt sich noch heute im Zentrum Oslos erkennen. "Kvadraturen" nennt man diese Straßenzüge.
Gleichzeitig mit dem Neubau wurde die Stadt auf Geheiß des Monarchen auch in "Christiania" umbenannt. Im neunzehnten Jahrhundert wurde die Bezeichnung zwar zu "Kristiania" norwegisiert. Doch erst 1924, also nach genau dreihundert Jahren, beschloss man, ihr den alten Namen Oslo zurück zu geben. Und so stößt man heute noch beim Bummel durch die Stadt an etlichen Stellen auf seltsame Schriftzüge wie "Christiania Sparebanken" oder "Christiania Teater".
Die Forststraße schlägt einen leichten Rechtsbogen und orientiert sich dabei weitgehend am Hang. Doch - man hat sich längst daran gewöhnt - völlig eben ist auch diese Passage nicht. Inzwischen hat sich der Himmel, der sich eine Zeit lang doch noch zu beruhigen schien, ziemlich verdüstert. Dunkle Wolken ziehen über und schließlich sogar in die bewaldete Hügellandschaft. Die Kuppen verschwinden erst im Dunst und anschließend im heftigen Regenguss.
Dennoch tauchen immer wieder einmal Wanderer und noch viel häufiger Radfahrer auf der Strecke auf. Und zwar keineswegs nur Erwachsene, auch Kinder im Grund- oder gar Vorschulalter strampeln oder marschieren da im strömenden Regen durch den Wald. Also unter Bedingungen, bei denen hierzulande längst nicht nur die Jüngeren sondern sogar Teenager wenige hundert Meter zur Schule gefahren würden, damit die Ärmsten auch ja nicht nass werden.
Aus Zucker scheinen die Norweger nun wahrlich nicht zu sein. Doch bei einem Volk, von dem wie bei den Olympischen Spielen in Lillehammer oder eben den Weltmeisterschaften in Oslo ganze Heerscharen im dicksten Winter in einfachsten Zelten übernachten, nur um am nächsten Tag gute Plätze an den Loipen zu haben, kann man es eigentlich auch kaum anders erwarten.
Und wann immer sich im kurzen nordischen Sommer mit seinen umso längeren Abenden auch nur halbwegs die Gelegenheit ergibt, sind die Straßencafés und die Außenbereiche der Restaurants praktisch bis auf den letzten Platz gefüllt, promenieren Tausende und Abertausende durch die Innenstädte. Schon bei Temperaturen von fünfzehn Grad kann so in skandinavischen Metropolen eine beinahe mediterrane Atmosphäre herrschen.
 |
 |
| Für zwei Kilometer wechselt die Strecke von breiten Schotterwegen auf einen schmalen Trampelpfad | |
Ein erneuter ruppiger Stich führt den Marathonkurs seinem ersten topographischen Höhepunkt entgegen. Denn in diesem Abschnitt ist ein deutlicher Ausschlag im ohnehin stark an eine EKG-Kurve erinnernden Profil eingezeichnet, der erstmals an der Vierhundert-Meter-Linie kratzt. Doch eine solche Spitze bedeutet halt auch, dass es auf der anderen Seite genauso steil bergab geht.
Und das Gefälle ist tatsächlich beinahe noch heftiger als der Anstieg. Mühsam erkämpfte Höhenmeter gehen so verloren, ohne dass man dies wirklich auskosten könnte. Statt "laufen lassen" ist "bremsen" angesagt. Und zwar spätestens in der engen Serpentine, die das Feld hinunter zum "Bjørnsjø" - dem "Bärensee" - bringt.
Schon von oben konnte man diese weitere der vielen Wasserflächen entlang der zweiundvierzig Kilometer dank des in der Nähe der Kehre nur mit niedrigen Sträuchern bewachsen Geländes erkennen. Und mit ihr die Läufer, die sie bereits fast erreicht hatten. Nun erlaubt dies auch den Blick zurück auf jene Marathonis, die einige hundert Meter zurück und noch ein ganzes Stück oberhalb unterwegs sind. Dass auch an dieser Stelle ein kleiner Wasserfall den Hang herunter rauscht, vervollständigt das herrliche Bild nur noch zusätzlich.
Eine Brücke führt über einen Engpass zwischen dem Hauptsee und einem kleinen Seitenarm, kurz darauf überspannt die nächste einen in einer kleinen Schlucht wild schäumenden Zufluss. Und direkt dahinter wird auch noch eine etliche Meter hohe Wand aus blankem Fels passiert. Man ist immer noch in Oslo, man ist mit der U-Bahn angereist. Aber das ist wohl doch ein Stadtmarathon der ganz speziellen Sorte.
Einer "i naturomgivelser" mit viel "frisk luft", wie es die "beskrivelse" unter der Rubrik "løypa" in der Ausschreibung so schön sagt. Allerdings steht da eben auch "Nordmarka gir løypa en toff profil". Und nicht nur die Ähnlichkeit zum englischen "tough" sondern auch das hinter dem See gleich wieder ansteigende Schottersträßchen lassen leicht erahnen, was damit gemeint sein könnte.
Plötzlich, kurz vor Kilometer siebzehn zeigen die Pfeile am Boden rechts in einen Weg hinein und direkt daneben auch wieder aus ihm heraus. Selbst wenn man sich die Streckenkarte nicht näher angesehen haben sollte, macht spätestens die kleine Markierungstafel klar, dass man sehr wohl nach rechts zu laufen hat und dort eine Wendepunktpassage den Kurs auf die passende Länge bringt.
Der Verpflegungspunkt wenig später kann deshalb doppelt genutzt werden, womit man mit acht zu bestückenden Posten dennoch auf die Anzahl von neun Getränkestellen kommt. Die im andauernden Regen trotz Wetterjacken schon ziemlich durchnässten Helfer, haben also mit der Versorgung gleich zweier Laufrichtungen wenigstens ordentlich zu tun, so dass ihnen nicht allzu kalt wird. "Tusen takk", wie man in Norwegen zu sagen pflegt. "Tausend Dank" für so einen Einsatz.
 |
 |
 |
| Der Regen der letzten Tage hat insbesondere auf diesem Pfad deutliche Spuren hinterlassen und macht das Belaufen dieser Passage noch schwieriger | ||
Die meisten Einheimischen scheinen einen Riecher für dieses Wetter gehabt zu haben. Oder sind die Norweger am Ende doch nicht so wetterfest. Denn fast alle sind trotz eigentlich akzeptabler Lufttemperaturen nicht im Trägerhemd sondern im T-Shirt unterwegs. Auf einer ganze Reihe von ihnen ist mit unterschiedlichen Jahreszahlen und auf verschiedenfarbigem Stoff das Logo des Nordmarka Skogsmaraton zu erkennen.
Auch aus dem aktuellen Jahr sieht man bereits einige Hemden. Sie haben einen doch eher ungewöhnlichen und recht auffälligen Farbton - nennen wir ihn einmal vorsichtig "flieder". Für alle Voranmelder bis Anfang März gehören "gratis T-skjorte" zum Leistungspaket dazu. Doch fährt man in diesem Fall mit dreihundert Kronen Startgebühr ohnehin ziemlich günstig. Bis auf sechshundert Kronen für Nachmeldungen im Juni steigt die Staffelung an.
Woraus sich bei einem Umrechnungskurs von nicht einmal mehr eins zu acht der stolze Betrag von fast achtzig Euro ergibt. Allerdings ist Norwegen eben nicht nur eines der reichsten Länder in Europa. Das Preisniveau - bei zugegeben auch nicht gerade niedrigen Einkommen - ist ebenfalls eines der höchsten. Und von allen Städten im Land gilt wiederum Oslo als die mit Abstand teuerste. Es soll sogar angeblich einige Ranglisten geben, bei denen die norwegische Hauptstadt in dieser Hinsicht mit London und Tokio mithalten könnte.
Vollkommen abschrecken lassen sollte man sich davon allerdings auch nicht. Abgesehen von Alkohol bewegen sich die Preise im Norden durchaus noch in einem halbwegs akzeptablen Bereich. Und es gibt sehr wohl bei vielem einigermaßen preisgünstige Alternativen. Der kleine Tipp, im Zweifelsfall statt eins zu acht dann doch lieber eins zu zehn umzurechnen, damit es nicht ganz so weh tut, sei aber trotzdem erlaubt.
Fast drei Kilometer lang läuft man im Begegnungsverkehr zwar größtenteils parallel zum nächsten See namens "Hakkloa" aber tendenziell trotzdem meist leicht bergauf. Und kurz vor der Wende dreht die Strecke auch noch einmal vom Wasser weg und macht dabei einen erneuten Knick nach oben. Die zweite auffallende Spitze im "høydeprofil" ist schließlich mit "vending" beschriftet.
Der Sägemehlpfeil beschreibt einen Halbkreis auf dem Weg. Ein Ordner signalisiert mit einem Handzeichen, dass man nun umkehren dürfte. Ein weiterer registriert noch schnell die Nummer. Ganz Aufmerksame bemerken bevor sie abdrehen vielleicht sogar noch, dass da wieder ein Haus am Rande steht. Das war dann allerdings schon fast alles, was man über den Wendepunkt berichten kann.
 |
 |
| An manchen Stellen kann man nur mit Mühe den riesigen Wasserlachen ausweichen … | … doch dort wo man laufen kann, ist dieser Abschnitt ein echter Genuss |
Erneut ziemlich pragmatisch und ohne viel Aufwand oder gar Brimborium. Aber irgendwie auch einem solchen Landschaftslauf und seiner Klientel völlig angemessen. Wer bei diesem Rennen startet, dürfte es kaum anders erwartet haben. Durch die Nordmarka läuft man definitiv nicht wegen den Zuschauermassen und der Stimmung am Streckenrand. Dass man trotzdem gerade beim zweitgrößten Marathon des Landes und in der Hauptstadt Oslo unterwegs ist, fällt dabei überhaupt nicht ins Gewicht.
An den Schildern mit der "20" und der "21" kommt man auf dem nun doch bereits ein wenig bekannten Rückweg vorbei. Auch die ebenfalls gekennzeichnete Halbmarathonmarke wird passiert. Und selbst die Tafel mit der "22" taucht in der Nähe der Verpflegungsstelle noch vor den Läufern auf, bevor sie für die abschließenden zwanzig Kilometer wieder Neuland betreten dürfen.
Zurück zum Bärensee führt die Strecke, doch diesmal an sein anderes Ende. Und dort gibt es bereits das nächste Mal zu trinken. Denn an der Wanderhütte "Kikutstua" bietet sich der Aufbau einer Verpflegungsstelle aufgrund der guten Logistik durchaus an. Ihren Namen hat die "Kikutstube" von einem Berg, der sich praktisch in direkter Nachbarschaft bis zu einer Höhe von über sechshundert Meter aufschwingt.
Im Gegensatz zu vielen anderen der zahlreichen Hütten, in denen man überall im Land Logis und - falls sie bewirtschaftet werden - auch Kost finden kann, wird sie von der Skiforening, dem norwegischen Skiverband betrieben. Die meisten dieser "hytter" - nämlich verteilt über ganz Norwegen weit über vierhundert - sind allerdings Eigentum der DNT.
Ausgeschrieben bedeutet dieses Kürzel "Den Norske Turistforening" und deren Mitglieder erhalten - aus welchen Gründen auch immer - bei der Anmeldung zum Nordmarka Skogsmaraton ausdrücklich fünfzig Kronen Rabatt. Es handelt sich um den norwegischen Wanderverein, der auch für die Markierung der meisten Routen verantwortlich ist. Rund fünf Prozent aller Norweger gehören ihm an.
In diesem Zusammenhang ist mit "turist" im Norwegischen also keineswegs der im ersten Moment so naheliegende und fast genauso ausgesprochene deutsche "Tourist" gemeint. Sprachforscher nennen solche Begriffe, die trotz großer Ähnlichkeit und gegebenenfalls auch tatsächlich gleicher Herkunft in verschiedenen Sprachen unterschiedliche Bedeutung haben, auch "falsche Freunde".
Selbst wenn man sich als Deutscher in den skandinavischen Sprachen mit wenig Mühe und nach kurzer Gewöhnungszeit zumindest bezüglich der wichtigsten Informationen ganz gut zurecht findet, kann es, wenn man nicht aufpasst, eben doch immer wieder auch einmal zu Missverständnissen kommen.
 |
 |
| Bei Kilometer 34 hat das Vergnügen über Stock und Stein ein Ende … | … und noch einmal geht es auf einer Forststraße spürbar bergan |
So hat das abschreckend aussehende "gammel" zum Beispiel keineswegs einen negativen Inhalt sondern heißt einfach nur "alt" - und zwar völlig wertneutral. Und wer trotz der extrem hohen Preise dennoch gerne ein Bier möchte, sollte - selbst wenn es sich ziemlich schmierig anhört - besser "øl" bestellen, denn "bier" ist auf Norwegisch die Mehrzahl von "bie" und bedeutet nichts anderes als "Bienen".
Die mit vielleicht dreißig Meter Höhenunterschied aufwartende Kuppe, die hinter der nächsten Kurve lauert, wäre bei einem "normalen" Stadtmarathon bestimmt in der Rubrik "erwähnenswert" gelandet und hätte im Profil deutliche Spuren hinterlassen. Auf der "høydeprofil" der großen Nordmarka-Runde muss man dagegen schon genau hinsehen, um sie mit Hilfe der Beschriftung "Kikutstua" überhaupt zu entdecken.
Doch auch die Macher des "großen" Osloer Marathons haben mit der Topographie der Stadt natürlich ihre Probleme. Zu einer Rekordpiste wie das legendäre Bislett-Stadion, in dem alleine über zehntausend Meter insgesamt sechs und über fünftausend Meter fünf Weltrekorde gelaufen wurden, wird er aus diesem Grund wohl nie werden.
Gleich viermal wurden in Oslo dabei Schallmauern geknackt. Der Australier Ron Clarke lief am 14.Juli 1965 mit 27:39 als erster Mensch zehn Kilometer unter achtundzwanzig Minuten. Im Jahr 1993 drückte Yobes Ondieki dann die inzwischen mehrfach weiter verbesserte Marke auf 26:58 und knackte damit die Siebenundzwanzig-Minuten-Grenze.
Und die Norwegerin Ingrid Kristiansen schaffte es zur Verzückung ihrer Landsleute, 1984 sowohl 14:58 über fünf Kilometer als auch im Jahr darauf 30:59 über zehn Kilometer hin zu legen. Zwei Marken, die sie selbst jeweils auch noch einmal unterbot. Kristiansen, die ja auch lange Zeit den Marathonrekord hielt, war übrigens ursprünglich Skilangläuferin und nahm in dieser Sportart sogar an einer WM teil.
Selbst das Bislett-Stadion, obwohl nur einen guten Kilometer vom Meer entfernt, befindet sich allerdings schon runde fünfzig Meter oberhalb desselben. Denn ziemlich schnell wird das Terrain in Oslo recht wellig. So ist es auch in der Innenstadt wirklich schwierig, eine einigermaßen flache Strecke für einen Stadtmarathon zusammen zu bekommen. Praktisch nur direkt an der Wasserlinie lässt sich ohne allzu viele Höhenmeter laufen.
Das aus vielen Städten bekannte Dilemma von Marathonorganisatoren, ob sie hauptsächlich einen schnellen oder doch eher einen abwechslungsreichen Kurs vorbei an möglichst vielen touristisch interessanten Punkten abstecken wollen, stellt sich in der norwegischen Metropole in besonderem Maße. Zumal man mit klassischen Sehenswürdigkeiten nicht unbedingt besonders reich bestückt ist.
Angesichts einer eher kurzen - oder genauer gesagt einer so lange unterbrochenen - Geschichte als Hauptstadt sowie der Tastsache, dass Oslo auch mehrfach nahezu komplett abbrannte, ist es auf der anderen Seite allerdings auch kaum verwunderlich, dass man kaum bedeutende Bauwerke aus der Zeit vor dem neunzehnten Jahrhundert entdecken kann.
Die Festung Akershus, die schon seit dem Mittelalter den Hafen bewacht und während der dänischen Zeit noch mehrfach um- und weiter ausgebaut wurde, stellt vielleicht die auffälligste und bemerkenswerteste Ausnahme dar. Die aus dem siebzehnten Jahrhundert stammende Domkirke ist eine andere.
 |
 |
 |
| Die Festung Akershus bewacht nicht nur den Hafen von Oslo sondern ist auch eine der wichtigsten Keimzellen der Hauptstadt | ||
Doch ansonsten würden Spötter behaupten, man habe in Oslo alles gesehen, wenn man einmal die "Karl Johans gate" hinauf gelaufen sei. Denn tatsächlich bündeln sich etliche der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt an diesem nicht einmal zwei Kilometer langen Straßenzug, der vom Hauptbahnhof zwar in gerader Linie aber leicht wellig zum königlichen Schloss führt.
Von der in den Achtzigern neu erbauten Sentralstasjon, in die man den alten Bahnhof "Østbanestasjonen" geschickt mit integriert hat, führt die Straße zuerst durch die Fußgängerzone und am Dom vorbei, um dessen Rückseite sich im Halbkreis die Arkaden der Basarhallen mit ihren Restaurants und kleinen Läden legen. Der Innenhof mit den im Sommer dort aufgebauten Tischen, stößt direkt an die rückwärtige Kirchenmauer. Eine im ersten Moment doch etwas seltsam anmutende Kombination.
Als nächstes passiert man das norwegische Parlament. Mit seinem halbrunden Vorbau in der Mitte kommt es bei weitem nicht so pompös und protzig daher wie viele seiner Gegenstücke in anderen Ländern. Was zum einen daran liegen kann, dass es erbaut wurde als Norwegen ein zwar aufstrebender, aber eben noch lange nicht völlig selbstständiger Staat war. Und zum anderen vielleicht auch einfach ein wenig der Ausdruck der nordischen Mentalität ist.
"Stortinget" werden dabei sowohl Gebäude wie auch Institution genannt. Auf Deutsch kann man das zwar in etwa mit "großer Rat" oder "große Versammlung" übersetzten. Allerdings ist der auch hierzulande bekannte, germanische "Thing" darin klar zu erkennen. Und der Begriff ist sogar ganz bewusst gewählt, um an die mittelalterlichen Zusammenkünfte im damals noch unabhängigen Norwegens zu erinnern. Denn die moderne norwegische Sprache kennt sehr wohl auch das Wort "forsamling".
 |
 |
 |
| Direkt hinter der Domkirke, der größten Kirche der Stadt, schließen sich die Arkaden der Basarhallen an | ||
Vom Storting aus kann man dann bereits am anderen Ende das königliche Schloss auf einem Hügel erkennen, das vom schwedischen König Karl XIV Johann - nach norwegische Zählung war er allerdings Karl III Johann - in Auftrag gegeben wurde. Wie auch das Parlament fällt es im internationalen Vergleich eher klein aus. Und so sehr sich die Wachmannschaften der Garde auch mühen, gegenüber der kalten Perfektion der britischen Kollegen wirkt ihre Ablösung eher menschlich und sympathisch.
Dass es sich beim königlichen Baumeister ausgerechnet um den früheren französischen Marschall Jean Bernadotte handelte, der von seinem kinderlosen Vorgänger Karl XIII adoptiert worden war, anschließend gegen seine frühere Heimat in den Krieg zog und damit Norwegen für die schwedische Krone sicherte, gehört jedoch auch wieder zu den vielen feinen Ironien, die sich in den Geschichtsbüchern entdecken lassen. Woher die Straße ihren Namen hat, dürfte damit aber wohl auch klar sein.
An ihr findet sich auch der alte Campus der Universität Oslo, die als
größte und wichtigste Hochschule des Landes natürlich längst
auch in Neubauten außerhalb der Innenstadt beheimatet ist. Während
man hinter den Mauern der Storting durchaus auch ein Forschungsinstitut vermuten
könnte, haben die um einen Platz herum gruppierten Universitätsgebäude
etwas ziemlich repräsentatives. Insbesondere hinter den Säulen des
Mittelbaus könnte man sich jedenfalls auch anderes vorstellen als Hörsäle.
Gegenüber der Uni in der Grünanlage "Studenterlunden" - dem "Studentenwäldchen" - steht das Nationaltheater. Nur einen Straßenblock entfernt von der Karl Johans gate erhebt sich in der anderen Richtung die Nationalgallerie. Wenig überraschend in einer Hauptstadt ist, dass so manches in Oslo die Bezeichnung "nasjonal" trägt.
Und die Luxusherberge Grand Hotel, in dem man traditionell den Gewinner des in Oslo verliehenen Friedensnobelpreises einquartiert, findet sich ebenfalls an dieser zentralen Meile, die damit in ihrer Bestückung und Bedeutung also sehr wohl - allerdings in wesentlich bescheidenerem Maßstab - dem Berliner Prachtboulevard "Unter den Linden" ähnelt.
Wirklich unverwechselbar ist allerdings hauptsächlich das wuchtige Rathaus mit seinen beiden Backsteintürmen direkt am Hafen. Eher zwiespältig sind die Meinungen dazu. Was für die einen eine bemerkenswerte Mischung zwischen den Architekturstilen Nationalromantik und Funktionalismus darstellt, wirkt für andere einfach nur wie ein grober Klotz. Doch ein weithin sichtbares Wahrzeichen von Oslo ist "Rådhuset" auf jeden Fall.
Eine Rolle, in die das neue Opernhaus erst noch hinein wachsen soll. Als leuchtendes Vorbild hat man dabei natürlich die Oper von Sydney vor Augen. Und tatsächlich hat auch der Neubau in Oslo einen ziemlichen Wiedererkennungswert, selbst wenn er aus jeder Blickrichtung ein wenig anders aussieht.
Wie ihre australische Schwester ragt die Oper in der Nähe des Hauptbahnhofes in den Oslofjord hinaus. Verkleidet mit italienischem Marmor soll sie nach den Ideen ihrer Erbauer an einen im Meer treibenden Eisberg erinnern. Große Glasfronten geben dem Bauwerk dennoch etwa Offenes. Am interessantesten für die Besucher ist vielleicht jedoch sogar, dass man aufgrund der geneigten, rampenartigen Dachkonstruktion auch auf ihm herum laufen kann.
 |
 |
 |
| Das neue Opernhaus von Oslo soll an einen Eisberg erinnern und wie ihr Gegenstück in Sydney ein eindeutiges Erkennungsmerkmal für die Stadt werden | ||
Der nach der Wiederbelebung anfangs auf einem Wendepunktkurs am Wasser ausgetragene Oslo Marathon nimmt die meisten der aufgezählten "attraksjoner" inzwischen auch wieder mit, was man natürlich im Gegenzug mit dem einen oder anderen Höhenmeter erkauft. Aber eine große Runde durch das Stadtgebiet ist dabei trotzdem nicht entstanden. Zwei Schleifen des gleichzeitig ausgetragenen Halbmarathons waren bisher zu absolvieren.
Für 2011 ist sogar angekündigt, beim Marathon zuerst zwei Runden à zehn Kilometer im Zentrum zurück legen zu lassen und dann auf der zweiten Hälfte die Halbmarathonstrecke anzuhängen. Natürlich bekommt man so das wichtigste gleich mehrfach zu Gesicht, doch gilt es dabei eben nicht nur viele Kurven und Ecken sondern sogar einige Wendepunkte zu passieren. Einen großen Stadtmarathon in der wichtigsten Metropole eines Landes stellt man sich dann vielleicht doch ein wenig anders vor.
Allerdings kann man im internationalen Vergleich mit zuletzt sechzehnhundert Marathonis auch nicht wirklich glänzen. Selbst gegen die skandinavische Konkurrenz fällt man damit ziemlich deutlich ab. Der Stockholm Marathon ist als Nummer eins im Norden seit Jahren fünfstellig. Kopenhagen nähert sich inzwischen auch mit Riesenschritten dieser Grenze. Und Helsinki vermeldet zumindest regelmäßig ungefähr fünftausend Starter.
In Oslo backt man da doch deutlich kleinere Brötchen. Trotzdem konnte man andererseits die Zahl der Marathonteilnehmer innerhalb der letzten beiden Jahre verdoppeln. Die Ausgangsbasis war nämlich so niedrig, dass selbst der kleine Bruder oben im Wald beinahe mithalten konnte.
 |
 |
| Direkt am Wasser gelegen und für die Öffentlichkeit begehbar ist die Oper bereits wenige Jahre nach ihrer Fertigstellung zu einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Oslos geworden | |
In der Nordmarka wächst man zwar auch, jedoch bei weitem nicht so stark. Allerdings nähert man sich dennoch langsam aber sicher der "maks antall deltakere" von sechshundert, die man in der aktuellen Ausschreibung ansetzt. Ob man jedoch bei weiter steigendem Interesse demnächst wirklich Meldewillige ablehnen wird, bleibt abzuwarten. Denn absolut ausgereizt scheinen die Kapazitäten noch nicht zu sein.
Bis zum See "Fyllingen", den man nach knapp fünfundzwanzig Kilometern erreicht hat, ist das Läuferfeld jedenfalls schon so weit auseinander gezogen, dass selbst kleinere Gruppen kaum noch zu sehen sind. Scharf links zweigt die Strecke vom weiter geradeaus führenden Hauptweg ab, über die Brücke zwischen den Wasserflächen von Østre Fyllingen und Vestre Fyllingen - also seinem östlichen und westlichen Teil - hinweg. Ein Weg, den auch der Holmenkollen-Skimarathon im Winter nimmt.
Doch nicht allzu lange verweilt der Kurs im Flachen. Bald nachdem man dem Doppelsee den Rücken zugedreht hat, beginnt der Anstieg zum höchsten Punkt des Marathons, der sich etwa nach zwei Dritteln der Distanz auf ungefähr vierhundertfünfzig Metern befindet. Rund drei Kilometer führt der Schotterweg bergauf. Stetig, aber von ganz wenigen kurzen Passagen abgesehen dieses Mal zumindest nicht übermäßig steil und zudem meist ziemlich gleichmäßig.
Kurz vor der Kuppe gibt es erneut zu trinken. Und auf der langen Gerade, auf der die Piste an dieser Stelle verläuft, bilden die weggeworfenen Becher links und rechts ein regelrechtes Spalier. Keine Frage, solange man ihnen folgt, ist man definitiv richtig. Man kann allerdings davon ausgehen, dass schon kurz nach dem Rennen alle wieder aufgesammelt sind und kein einziger davon mehr am Rand liegen wird.
 |
 |
| Ullevålseter ist sowohl für Wanderer wie auch für Skiläufer eines der beliebtesten Ziele in den riesigen, direkt am Stadtrand von Oslo beginnenden Nordmarka-Wäldern | |
Selbst bei längeren Aufenthalten im Norden Europas dürfte man in den dortigen Wäldern kaum irgendwo einmal Müll gesehen habe. Nicht mehr Benötigtes einfach auf den Boden fallen zu lassen oder gar irgendwelchen Schrott mit Absicht in der Natur zu deponieren, gehört nun wahrlich nicht unbedingt zur skandinavischen Lebensart.
Der Abstieg auf der anderen Seite der Kuppe ist dann allerdings wieder deutlich direkter. Und zwar trotz einiger Kurven, denn es geht mit ziemlich ordentlichen Prozentzahlen den Hang hinunter. In solchen Abschnitten fragt man sich schon, wie man diese oder ähnliche Passagen überhaupt auf zwei schmalen Latten bewältigen kann.
Doch beim "Langrenn" - Skilanglauf wird im Norwegischen irgendwie recht passend genannt - gehören sie wie selbstverständlich dazu, wie man sich rund um das Holmenkollen-Stadion leicht überzeugen kann. Die Damen mussten bei ihrem längsten Rennen während der Olsoer Weltmeisterschaften neben dreißig Kilometern zum Beispiel auch noch zwölfhundert Höhenmeter überwinden.
Die Männer hatten bei ihrem - aufgrund der Zusammensetzung der einzelnen Schleifen auch noch etwas zu lang geraten - Fünfziger kaum glaubliche zweitausend Meter zu klettern. Und Sieger Petter Nordhug benötigte dafür gerade einmal 2:08:09. Der Schweizer Dario Cologna kam als Zwanzigster immer noch unter 2:10 ins Ziel. Die Hochachtung vor den Leistungen der Bretterspezialisten wächst auf jeden Fall noch einmal deutlich, wenn man ihre Strecken nicht nur am Bildschirm sondern auch in Natura gesehen hat.
Kaum hat man sich jedoch an das Gefälle gewöhnt und den Rhythmus gefunden, ist es damit auch schon wieder vorbei. Denn nicht geradeaus weiter bergab soll man da nach dreißig Kilometern laufen sondern scharf links ab. Damit niemand trotz aller Markierungen vor lauter Schwung an diesem doch ein wenig kritischen, weil erst sehr spät erkennbaren Abzweig vorbei rauscht, hat man dort sogar einen Streckenposten installiert.
Es verwundert nach all dem bisherigen Auf und Ab kaum noch, dass es auf dem nun deutlich schmäleren Weg wieder einmal den Hang hinauf geht. Doch wohin und wie lange wird im Gegensatz zur letzten weit einsehbaren Steigung nicht wirklich klar. Der Wald ist dicht und dunkel. Da hilft der inzwischen wieder deutlich weniger trübe Himmel auch nur noch bedingt. Und zudem schlägt die Strecke dabei immer wieder neue Haken. Doch hinter keinem der ersten dieser kleinen Bögen geht es anders weiter als davor.
 |
 |
 |
| Meist leicht bergab führen die letzten Kilometer zurück zum Sognsvann | ||
Erst Verpflegungsstelle Nummer sieben markiert einen klaren Schnitt. Und es ist der deutlichste während des gesamten Rennens. Denn nicht die gesamte Distanz wird auf verschiedenen Arten von Schotter zurück gelegt. Zwei Kilometer führen auch über einen schmalen Trampelpfad, auf dem man endgültig einen Eindruck davon bekommt, was es heißt, in norwegischen Wäldern unterwegs zu sein.
Bereits der Einstieg direkt hinter der "matstasjon" führt nicht nur sprichwörtlich sondern auch wahrhaftig über Stock und Stein. Und zwischen Wurzeln und kleineren Gesteinsbrocken wie überall sonst stecken auf diesem sti" - die sprachliche Verwandtschaft mit "Steig" ist klar zu erkennen - manchmal auch mächtige Findlinge im Boden, zwischen denen man sich von Flatterband zu Flatterband den geeignetsten Weg selbst suchen muss.
Eben genau so wie Norweger durch ihre urwüchsige Natur zu wandern pflegen.
Was ohnehin schon kein leichtes Unterfangen wäre, wird durch den Regen der Vortage noch zusätzlich erschwert. Denn nicht immer ist klar, ob die braune Fläche, auf die man den nächsten Schritt setzen wird, denn nun ein nasser Fels oder doch eher schmieriger Boden ist. Dazwischen gilt es immer wieder Pfützen jeder Größe zu umkurven. Und manchmal dehnen sich diese auch über die komplette Breite des überhaupt denkbaren Weges aus. Ja, sogar ein kleiner Wasserlauf muss mit Hilfe einiger Steine übersprungen werden.
Der Pfad führt querfeldein, orientiert sich dann für einige Zeit an einer kleinen Stromleitungstrasse und verschwindet dann doch wieder im dichten Wald. Kaum hat man auf einem etwas längeren leichten Gefällestück wieder etwas Rhythmus gefunden, endet es schon am nächsten kurzen und ziemlich heftigen Stich zwischen den Felsen. Und geht es einmal für einen Moment einen Wurzelweg einigermaßen gleichmäßig hinauf, kann man fast sicher sein, bald darauf ein paar Meter richtig steil bergab zu müssen.
Fast ist man ein wenig enttäuscht, als der Weg hinaus auf eine Hangwiese führt. Denn von ihr aus kann man bereits sehen, dass er nur etwa zweihundert Meter später an einer kleinen Alm weiter unten in deren Zufahrtspiste einmünden wird. Es ist zwar das lauftechnisch definitiv anspruchsvollste, aber eben auch das mit Abstand abwechslungsreichste und schönste Stück der Strecke, was durchaus etwas heißen will.
Noch immer ist man fast vierhundert Meter hoch und hat doch schon rund vierunddreißig Kilometer hinter sich. Das Ziel liegt also auch weiterhin ein ganzes Stück unterhalb der aktuellen Position im Höhenprofil. So langsam müsste es also doch irgendwo endlich einmal spürbar bergab gehen.
Und das tut es dann auch tatsächlich. Zwei Kilometer später hat man nämlich fast einhundert Höhenmeter verloren. Das Gefälle ist - da außerdem ziemlich gleichmäßig und wieder auf einer Schotterpiste - deshalb ziemlich angenehm zu laufen. Man kann es einfach rollen lassen, so könnte man eigentlich noch eine Zeit lang weiter machen.
Aber eine kleine Überraschung haben die Streckenarchitekten - oder wohl eher die Straßenbauer - eben doch noch aufgehoben. Denn der Weg führt auch am Ullevålseter vorbei, der nicht nur ein beliebtes Ausflugslokal sondern auch einer der wichtigsten Knotenpunkte für Forststraßen, Wanderwege und Langlaufloipen in der Nordmarka ist - dafür allerdings wieder rund fünfzig Meter höher am Berg liegt. Noch einmal schlägt die in den Unterlagen zu findende "EKG-Kurve" deshalb deutlich nach oben aus.
 |
 |
 |
| Zum Abschluss führt der Kurs noch einmal einige hundert Meter am Sognsvann entlang | ||
Der Schilderbaum, der die verschiedenen vom ehemaligen Berghof aus erreichbaren Ziele anzeigt, ist wegen seiner Wegkreuzfunktion also recht gut bestückt. Einer der Holzpfeile trägt die Aufschrift "50km Holmenkollen", womit natürlich keineswegs gemeint ist, dass dieser so weit entfernt wäre. Bis zum Stadion sind es zu Fuß gerade einmal etwa sechs Kilometer.
Vielmehr ist "Ullevålseteren" einer der bekanntesten Streckenpunkte der klassischen 5-mil-Route. Spätestens jetzt bewegt man sich bei diesem Marathon zur Sommersonnenwende also endgültig mitten in der Heimat des nordischen Skisportes. Die Vorstellung, die kurze aber dennoch ziemlich steile Kuppe hinter dem Abzweig im Schlittschuhschritt hinauf stürmen zu müssen, ist jedoch auch nicht erfreulicher als sie per Pedes zu bezwingen.
Den ersten der abschließenden fünf Kilometer absolviert man auf dieser Skispur. Gelegentlich am Wegesrand stehende Lampen zeigen, dass es sich dabei um eine "Lysløype" handelt. Aufgrund der in der kalten Jahreszeit extrem kurzen Tage gibt es in Norwegen unzählige dieser "Lichtloipen". So kann man sich auch im dunklen Dezember im Freien bewegen und etwas gegen die in Skandinavien noch deutlich stärker als hierzulande verbreitete Winterdepression tun.
 |
 |
| Die flache Runde um den See ist auch ohne Marathon eine der beliebtesten Laufstrecken in Oslo | |
Und wegen des dafür benötigten Stromes macht man sich ohnehin keine großen Gedanken, Der ist dank praktisch kostenloser Wasserkraft in ausreichendem Maß vorhanden. Zu Hause je nach Bedarf das Licht an und aus zu machen, ist bei weitem nicht immer üblich. Oft lässt man es vielmehr einfach durchgängig brennen. Und es gibt sogar Geschichten über Häuser, in die man nicht einmal Schalter eingebaut hat. Die vermeintlich saubere Energie sorgt so indirekt auch für ihre Verschwendung.
Nur ganz langsam senkt sich die breite Forststraße, auf der sich im Winter die Skiläufer tummeln. Noch immer bewegt man sich rund hundertfünfzig Meter oberhalb der Ziellinie. Das ändert sich erst an der letzten Verpflegungsstelle. Denn diese ist wieder an einem Abzweig aufgebaut, an dem die Marathonis die lange leicht wellige Gerade verlassen dürfen. Den an dieser Stelle wohl ansonsten nötigen Streckenposten kann man so gleich mit einsparen.
Der deutlich schmälere Hangweg, der die Läufer aufnimmt, hat zwar bei weitem nicht so einen Querfeldcharakter wie bei der Passage einige Kilometer zuvor. Doch mit seinem kurvigen Verlauf und zudem immer leicht bergab führend gehört auch er sicher zu den schönsten Abschnitten eines sowieso alles andere als unansehnlichen Marathonkurses.
Auch nach der erneuten Einmündung in eine Schotterpiste verliert die Strecke weiter an Höhe. Das Schild mit der "40" ist längst passiert, da lässt sich ein wenig unterhalb zwischen den Bäumen erstmals das Sognsvann erahnen. Doch selbst die einundvierzigste Kilometermarkierung befindet sich noch mitten im dichten norwegischen Wald. Erst wenige hundert Meter vor dem Ende stößt man dann wirklich zum kleinen See vor.
Auf dem Uferweg sind tatsächlich noch einige Schritte auf Asphalt - abgesehen vom Start- und Zielbereich allerdings die einzigen im ganzen Rennen - zurück zu legen. Doch schon über den kleinen Wall zwischen Sognsvann und Sportgelände läuft man bekanntermaßen wieder auf Naturboden. Und erst als man diese letzten beiden Höhenmeter überwunden und die Sporthochschule vor sich hat, ist man - obwohl man doch während des kompletten Marathons in Oslo unterwegs war - wieder irgendwie in der Stadt zurück.
 |
 |
 |
| Erst kurz vor dem Ziel verlässt
man das Sognsvann wieder ... |
... doch selbst bei Kilometer 42 ist noch nichts davon zu sehen | |
Lars Lysbakken ist der Erste, der über die kleine Anhöhe läuft. Für ihn wird am Ende eine Zeit von 2:52:46 gestoppt, womit er sich bis kurz vor dem Ziel seines Sieges nicht absolut sicher sein kann. Denn nur siebenundvierzig Sekunden später wird mit Sven Arne Gylterud bereits der Zweite notiert. Und eine gute Minute darauf macht Jon Olsen mit 2:54:59 das Treppchen schon voll. Auch Gerhard Sletten (2:57:10) und Jan Halland (2:58:51) kommen trotz vieler hundert Höhenmeter noch unter drei Stunden an.
Bei den Damen ist der Abstand von Siegerin Line Foss auf ihre nächste Verfolgerin auch kaum größer. Am Ende hat sie in 3:17:49 nicht einmal eine Minute auf die 3:18:40 benötigenden Marit Karlsen heraus gelaufen. Die Dritte Malin Lundvik kann mit 3:23:48 in den Zweikampf an der Spitze allerdings nicht mehr eingreifen. Und ihrerseits muss sie nicht befürchten, dass Ingrid Skårer, die in 3:27:36 ebenfalls klar unter 3:30 bleibt, ihr noch gefährlich werden könnte.
Von ihnen muss sich natürlich niemand Gedanken machen, ob eine Ehrung für sie anfällt. Doch hat man sich ansonsten eine ziemlich interessante Variante dafür ausgedacht, wer von den Teilnehmern außerdem noch eine kleine Anerkennung bekommt. Die Zahl der ausgegebenen Sonderpreise ist nämlich abhängig davon, wie viele Läufer pro Altersklasse am Start sind. Jeweils ein Viertel davon wird hinterher bedacht. Und natürlich gibt es auch eine "Deltakerpremie til alle fullførende", eine Teilnahmeprämie für alle die den Marathon erfolgreich absolvieren.
Allerdings ist das keine Medaille wie üblich sondern eine Tasse mit dem Logo. Wer zum fünften, zehnten oder fünfzehnten Mal - die jeweilige Zahl der Läufe haben die Organisatoren ganz genau im Blick und lässt sich auch in Start- und Ergebnisliste nachvollziehen - dabei ist bekommt zudem auch noch einen Wandteller. Vom allgemeinen Einheitsbrei, dem man bei vielen Laufveranstaltungen begegnet, hebt man sich auch mit solchen Kleinigkeiten doch etwas ab.
Das wirklich außergewöhnliche am Nordmarka Skogsmaraton ist jedoch wohl eher, dass man mit ihm einen Lauf durch beinahe unberührt wirkende Natur vor sich hat und dennoch unterwegs stets nur wenige Kilometer von einer belebten Metropole entfernt ist. Eine Veranstaltung, zu der man wie zu jedem anderen Stadtmarathon in der Welt reisen kann und die trotzdem einen ganz anderen Charakter hat.
Dass die Wälder, durch die man da mitten im nordischen Sommer - auch wenn er sich nicht immer hochsommerlich anfühlen muss - läuft, in der kalten Jahreszeit auch noch ein Paradies für Skisportler sind, hat dazu ebenfalls einen gewissen Reiz. Denn selbst wenn man den Holmenkollen während des Rennens nicht zu Gesicht bekommt und ihn an einem anderen Tag besuchen muss, man ist eben doch irgendwie in der Heimat des Wintersports unterwegs.
 |
Bericht und Fotos von Ralf Klink Ergebnisse und Infos www.skogsmaraton.no Zurück zu REISEN + LAUFEN – aktuell im LaufReport HIER |
 |
© copyright
Die Verwertung von Texten und Fotos, insbesondere durch Vervielfältigung
oder Verbreitung auch in elektronischer Form, ist ohne Zustimmung der LaufReport.de
Redaktion (Adresse im IMPRESSUM)
unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes
ergibt.