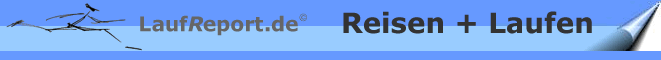

 |
 |
 |
 |
 |
 |
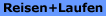 |
 |
 |
 |
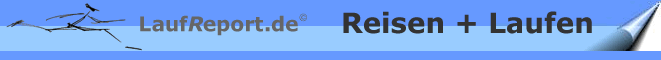 
|
3. Internationaler Jerusalem Marathon (1.3.13)Hügelig und heilig Eine alte Stadt glänzt mit einer jungen Veranstaltung |
|
von Michael Schardt
|
Noch vor einem halben Jahrzehnt war der Staat Israel auf dem Marathonglobus nahezu ein weißer Fleck. Denn einzig der Tiberius Marathon, der seit 1977 (erster Sieger Werner Dörrenbacher, BRD, 2:19) regelmäßig stattfindet und Anfang der achtziger Jahre mit Kerstin Preßler (2:36), Hans Pfisterer (2:20) und Ralf Salzmann (2:16) sogar drei deutsche Sieger sah, schaffte es zu einiger Bekanntheit. Der in der Läuferszene ebenfalls recht bekannte Ultra- und Marathon am Toten Meer findet hingegen nicht auf israelischem Boden statt, sondern im angrenzenden Jordanien.
Aber mit der Begründung des Marathons in Tel Aviv im Jahr 2009 - Anlass dafür war das 100jährige Stadtjubiläum - und dem Debüt des Jerusalem Marathons 2011 ist Israel nachhaltig in den Blick der internationalen Läuferschar gerückt. Tel Aviv vermeldet vierzehn Tage vor dem kleinen Jubiläum, des Fünfjährigen, die beeindruckende Zahl von 35.000 Anmeldungen; Jerusalem spricht nach der dritten Auflage von enormen 20.000 Teilnehmern.
Das sind - auch im Vergleich zu anderen Marathonmetropolen in Europa und den USA - fraglos beachtliche Zahlen. Im Lande selbst gehören die beiden Marathons zu den absoluten Top-Sportveranstaltungen überhaupt.
Zu dieser Entwicklung passt auch das selbstverordnete Image als Sportnation, dessen erste und augenfälligste Erscheinung dem Besucher schon von überdimensionierten Sportplakaten entgegenstrahlt, wenn er die langen Gänge des internationalen Flughafens Ben Gurion von Tel Aviv durchschreitet. Hier hängen hintereinander und beidseitig viele Dutzend großformatige Gemälde und Photographien mit Motiven aus nahezu allen Sportarten. Leichtathletik und Straßenlauf scheint dabei überrepräsentiert.
Hat der Tourist den Strand von Tel Aviv erreicht, wo er für die erste Nacht in eines der Luxushotels oder auch in einer bezahlbaren Unterkunft eincheckt, dann wird er unweigerlich auf die vielen hundert Jogger treffen, die die 20 km lange Promenade von Tel Aviv nach Jaffa und von Jaffa nach Tel Aviv entlanglaufen. Auch der berühmte, innerstädtische Rothschildboulevard, der beidseitig von belebten Cafés und Bars gesäumt wird, ist in ähnlicher weise beliebte Trainingsstrecke und hochfrequentierter Laufkurs wie die Strandpromenade.
Mit ein wenig Frust werden bis vor kurzem die laufbegeisterten Jogger aus Jerusalem zur quirligen Nightlifecity Tel Aviv geschaut haben, denn von solchen Trainingsmöglichkeiten kann man hier nur träumen. Aber die Situation hat sich zuletzt erheblich verbessert, denn zum Image einer Sportnation und Sportstadt gehören nicht nur große Veranstaltungen, sondern auch die Schaffung von Sportplätzen und Trainingsstrecken. So wurden in Jerusalem gerade zwei Sportplätze mit Leichtathletikanlagen für 11.000 bzw. 3.500 Zuschauerplätze sowie eine schmucke Fahrrad- und Laufstrecke fertig gestellt.
 |
 |
| Die Davidstadt gehört zu den touristischen Höhepunkten in Jerusalem ... | ... von außen betrachtet mit alter Stadtmauer |
Auf topographisch ungeheuer schwierigem innerstädtischem Terrain und bei angespannter Wirtschaftslage konnte Bürgermeister Nir Barkat und seine Leute eine fünf Kilometer lange, nahezu flache, asphaltierte Laufstrecke präsentieren, neben der eine vorbildliche und gelenkschonende, leicht schwingende Holzlaufbahn liegt. Alle paar hundert Meter säumen hochwertige Trimmgeräte und Fitnessapparate diesen Kurs, der von der Bevölkerung von Anfang an sehr gut angenommen wurde, obwohl (oder weil) die Anwohner dafür auch in die eigene Tasche greifen mussten. Über einen Teil des Trimmpfades führt neuerdings auch der Weg der Marathon- und Halbmarathonläufer.
Nun kommt weder der Jerusalem noch der Tel Aviv Marathon geradewegs aus dem Nichts, und die imposanten Teilnehmerzahlen halten einer genauen Prüfung auch nur bedingt stand.
Denn die Gründung des Tel Aviv Marathons im Jahre 2009 ist im Grunde eine Wiederaufnahme nach einer sehr langen Pause. Hier fand über fast zwei Jahrzehnte bis in die frühen neunziger Jahre bereits eine Laufveranstaltung statt, die einen Marathon integriert hatte. Dann allerdings setzte die Veranstaltung aus unbekannten Gründen für anderthalb Jahrzehnte aus. - In Jerusalem hatte es bis 2010 jährlich einen Halbmarathon gegeben, der insgesamt neunzehn Mal stattfand, bis der laufbegeisterte Bürgermeister Nir Barkat, der bis dahin bereits fünf Marathons gefinisht hatte, auf die mehr oder weniger naheliegende Idee kam, dem Halben auch einen Vollmarathon anzufügen und die Zählung wieder mit "1" zu beginnen.
Der Marathon, das ist unverkennbar, ist sein, des Stadtmajors, Baby. Er lädt ein, er läuft mit, er überreicht die Schecks bei der Siegerehrung, er beantwortet bei der Pressekonferenz die Fragen ausländischer Journalisten, die auf seine Initiative hin vom staatlichen Tourismusministerium auf Kosten belastungsfähiger Sponsoren und des Steuerzahlers zu einer einwöchigen Jerusalemreise eingeladen wurden. Rund 100 Journalisten aus zwölf Ländern, darunter Brasilien, Japan, Korea, die USA und die wichtigsten europäischen Staaten konnten am Lauf teilnehmen oder sich über den Lauf und die Stadt ausgiebig informieren.
 |
 |
| Die Davidstadt von innen betrachtet, wenn das alte Kanalsystem bewandert wird | Lasst Blumen sprechen, hier auf Hebräisch. Der Name der Stadt ist farblich eingepflanzt |
Bei so viel bürgermeisterlichem Marathonenthusiasmus mag es verzeihlich sein, dass bei den Teilnehmerzahlen auch etwas die Wünsche des Cheforganisators Pate gestanden haben mögen. Die Zahl 20.000 wurde schon vor dem Lauf in den weltweiten medialen Äther gegeben und danach bestätigt. Sofort griffen Portale und Zeitschriften diese Daten als existent auf und verbreiteten sie über den Globus. Zum Vergleich zur diesjährigen Teilnehmerzahl wurden den Reportern gleich die beiden Vorgängerzahlen angegeben, nach denen es beim ersten Start 2011 10.000 Starter gewesen sein sollen und 2012 schon 15.000.
Die letzte Voranmeldeliste weist allerdings für 2013 12.626 Teilnehmer aus, zu denen sich möglicherweise noch einige hundert Nachmelder gesellten. Die in den Ergebnislisten rubrizierten Läufer summieren sich für die drei Hauptläufe Marathon (knapp 900 Finisher), Halbmarathon (knapp 2800 Finisher) und 10 km (knapp 6000 Finisher) sowie 10 km Militärmeisterschaft (ca. 500 Finisher) auf etwas über 10.000 Finisher. Rechnet man noch ca. 1000 Läufer des ohne Zeitwertung durchgeführten Fun-Runs über 4,2 km und noch einmal 1000 Kinder im 800 Meterlauf hinzu, so entspricht die Finisherzahl der Voranmeldezahl und kann auf etwa 12.500 Läufer hochgerechnet werden.
Auch das ist ein überaus imponierender Wert, vor allem, wenn man die vielen Besonderheiten gerade dieser Veranstaltung in seine Überlegungen mit einbezieht. Der Veranstalter und auch der Bürgermeister können sich mit Recht auf die Brust schlagen und sich freuen, nicht nur, weil die Zahlen in den drei Jahren ständig gestiegen sind, sondern auch weil das Attribut "international" vollkommen erfüllt wurde. Denn fast 2000 Läufer, also ein Sechstel, kamen aus dem Ausland. Gesichtet wurden Läufer aus nicht weniger als 54 Ländern, darunter viele aus Übersee und auch viele Dutzend Deutsche.
Der Aufwand, den die Organisatoren einerseits freiwillig betreiben und andererseits betreiben müssen, ist enorm und übertrifft in vielem die Standards der ganz großen Marathons in aller Welt. Das große Problem, das in dieser Form nur der Jerusalem Marathon hat, betrifft die Sicherheit. Um diese für Läufer, Betreuer und Zuschauer zu gewährleisten, werden 1000 Sicherheitskräfte eingesetzt, manche Quellen sprechen sogar von 2000. Mindestens ebenso viele Helfer und Volontäre sind aber auch im Einsatz, um den Läufern ein größtmögliches Vergnügen zu bereiten und ein einmaliges Preis-Leistungs-Verhältnis zu erreichen.
Geradezu gigantisch auf 7000 Quadratmetern präsentiert sich nicht nur die Expo mit Wettkampfbüro und Pastatempel, sondern auch der Start-Ziel-Bereich auf der Ruppin Road, der Hazaz Avenue, der Bel Zvi Avenue und der Yitzhak Rabin Avenue, die ein Viereck um den Park Gan Havradim, den Park Gan Sacher Compound und das Parlament, der erhöht liegenden Knesset, bilden. Innerhalb dieses Vierecks liegen der für alle Läufe gleiche Startplatz, das für Marathon einerseits, und 10 km und HM andererseits, zu erreichende Ziel, des Weiteren zwei große Logistikzentren, das Pressezentrum sowie verschiedene Aktivitäts- und Vergnügungszonen.
Dies alles wird flankiert von Ver- und Entsorgungsbereichen und der Kleiderbeutelabgabe. Für die meisten Bereiche wurden großräumige Zelte aufgebaut, die Parks eignen sich bei schönem Wetter auch als Regenerationszonen unter freiem Himmel. Platz ist reichlich da, und ein Fahnenmeer nationaler und internationaler Flaggen entlang des gesamten Areals bedeuten auch dem letzten Unwissenden, dass hier etwas Großes im Gange ist.
Doch bevor der Sport am ersten Tag des Monats März, einem Freitag und damit Feiertag der hier lebenden arabischen Bevölkerung, ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, steht für den Marathontourist noch ein mehr oder weniger intensives Besichtigungsprogramm auf der To-do-list, zumal kaum eine andere Stadt so mit geschichtlichen und religiösen Zeugnissen wuchern kann, als eben Jerusalem.
Wer nun, wie die meisten Läufer, drei bis fünf Tage vor dem Marathon anreiste, um sich auf eine atemberaubende historische Spurensuche zu begeben, erlebte in Tel Aviv am Sonntag und in Jerusalem am Montag eine kleine Überraschung, denn in der Stadt wimmelte es von Kostümierten und Verkleideten, eine Art 24stündiger Karneval am 3. bzw. 4. März war im Gange. Anlass dazu war das alljährlich zelebrierte Purimfest, das an die Errettung des jüdischen Volkes aus drohender Gefahr in der persischen Diaspora erinnert. Es ist der einzige Tag, an dem selbst für Ultraorthodoxe Alkoholgenuss und Über-die-Stränge-Schlagen erlaubt ist und sogar Kinder schon Zigaretten rauchen und Wein trinken dürfen.
An Purim herrscht in Jerusalem Ausnahmezustand, aber auch an ganz normalen Tagen geht es in der Hauptstadt Israels keinesfalls staubtrocken und streng religiös zu. In den letzten Jahren haben Bars und einige Tanzkneipen aufgemacht, die Zahl der nichtkoscheren Restaurants stieg an, und im Viertel der deutschen Kolonie herrscht tagsüber ein reges Treiben in zahlreichen Cafés und Bistros. Überhaupt überrascht Jerusalem partiell mit einem fröhlichen und lebendigen Nachtleben, ohne allerdings mit Tel Aviv konkurrieren zu können.
Auch innerhalb der ultraorthodoxen Jugend hat sich bei geschätzten zehn Prozent heimlich ein Gesinnungswandel vollzogen und vollzieht sich auch weiterhin, denn nicht wenige sind nur unfreiwillig fromm und würden gerne ausbrechen, wenn sie damit nicht den Bruch mit der Familie riskieren würden. Wie Betroffene unter Verwendung falscher Namen etwas schüchtern berichten, gehen nicht wenige von ihnen heimlich in Bars, besitzen gleich zwei Handys, ein "koscheres", sprich reglementiertes und ein "unkoscheres", offenes. Sie wollen mehr Freiheit. Während die liberale jüdische Jugend ihre Freiheit offen auslebt, hat sich bei einigen jungen Orthodoxen, die im Alltag in ihrer schwarzen Kleidung, den schwarzen Hüten und den Bartlocken das Stadtbild mit dominieren, eine undercover gelebte Parallelwelt gebildet. Darüber aber lässt sich nur unter vorgehaltener Hand nur unter Gleichgesinnten sprechen.
 |
 |
| Der alte jüdische Friedhof am Ölberg | Von den Marathonveranstalter sah man niemand an der Klagemauer, denn die hatten allen Grund, sich zu freuen |
Zum Pflichtprogramm des Jerusalembesuchers gehört die Gedenkstätte Yad Vashem, die an die Verfolgung und Ermordung von sechs Millionen Juden im Holocaust erinnert. Die alte Gedenkstätte, die aufgrund von austretendem Felsenwasser abgerissen werden musste, konzentrierte sich in ihrer Konzeption ausschließlich auf die dunklen Seiten des Holocaust; bei der 2007 eingeweihten neuen Gedenkstätte wird auch der Überlebenden gedacht und jenen, denen selbstlos geholfen wurde, und auch den Helfern und Widerständlern. Ganz bewusst wollten die Planer des neuen Yad Vashem von der einseitigen Darstellung loskommen. Die neue Gedenkstätte gehört zu den meistbesuchten Orten in Jerusalem.
Eine ähnlich große Zahl von Israelreisenden besucht die Klagemauer, schaut sich die Davidstadt an und begibt sich in die Grabeskirche. Einen Ausflug wert sind zahllose Sehenswürdigkeiten und religiöse Gedenkstätten, Kirchen, Moscheen und Synagogen. Der Ölberg, der Tempelberg und der Berg Skopus werden aufgesucht, die Stadtmauer und die Altstadt besucht. Man wandelt durch das armenische, christliche und jüdische Viertel, schreitet durch das neue Tor, das Damaskus- oder Jaffator und bestaunt die arabischen und jüdischen Märkte. Zu den Höhepunkten einer Reise gehört auch der Felsendom, die Al Aqsa-Moschee, das Islamische Museum, Salomons Ställe und vieles mehr.
Geschichte auf Schritt und Tritt, das erlebt der Interessierte am besten zu Fuß. Dabei ist es nahezu unabdingbar, an geführten Stadtbesichtigungen teilzunehmen. Alleine, mit Reiseführer bewaffnet, erschließt sich einem die Stadt kaum. Zusätzlich sollte man den Besuch einiger der vielen beeindruckenden Museen und Ausstellungen in Erwägung ziehen. Zur Zeit des Marathons war die laufende Herodes-Ausstellung sicher eines der Highlights.
Der Begriff "alt" ist in einer der ältesten Städte der Welt relativ. Wenn davon gesprochen wird, dass die ein oder andere Maurer oder die ein oder andere Säule 1000 Jahre alt ist, dann ist das für Jerusalemer Verhältnisse eher neu. In so einem Fall kann die Reiseleiterin auf die Frage, aus welchem Jahrhundert denn das Gebäude stamme, die Gegenfrage stellen: "Vor oder nach Christus", oder gleich sagen: "Als ich gestern hier war, da stand es noch nicht hier ..."
Fraglos könnte sich der Besucher allein auf Jerusalem beschränken, und er könnte vier oder sechs Wochen verbringen, ohne alle Sehenswürdigkeiten auch nur einmal gesehen zu haben. Dennoch ist es empfehlenswert, die Stadt für wenigstens einen Tag zu verlassen. Eine solche Tagestour führt zu den nahe am Toten Meer gelegenen Höhlen von Qumran, wo der wohl bedeutendsten historische Fund des 20. Jahrhunderts getätigt wurde, als 1947 die biblischen Schriftrollen in Tonkrügen rein zufällig gefunden wurden. Ein Hirtenjunge hatte sie entdeckt, weil eine Ziege ausgebüxt war.
Weiter führt der Weg dann zum singulär stehenden Berg von Masada, auf dessen Plateau heute eine Seilbahn, aber auch der beschwerliche Weg über eine in Fels gehauene Treppe führt. Hier oben hatte Herodes einen Palast errichten lassen, der sehr viel Geld und Menschenleben gekostet hat, den der Herrscher vermutlich aber nie besuchte. Der Berg ist zum Symbol jüdischen Widerstandes geworden, denn eine rebellische Gruppe, die Zeloten, hatten sich hier oben verschanzt und leisteten dem mehrtausendköpfigen römischen Heer erbitterte Gegenwehr. Sie trotzten der Aushungerung und Belagerung über zwei Jahre, und als die Vernichtung durch den Feind drohte, da beschlossen die Rebellen, freiwillig in den Tod zu gehen. So geschah es auch, doch zuvor wurden zehn Mitglieder der Gemeinde gewählt, die den Suizid zu überwachen hatten, bevor sie sich selbst in den Tod stürzten. Dass der Geschichtsschreiber Josephus Flavius überhaupt darüber berichten konnte, ist den Aussagen einer kleinen Gruppe von Kindern und Frauen zu verdanken, die sich versteckt hatten und überlebten.
Auf dem Rückweg von Masada nach Jerusalem gehört es zum obligatorischen Ritual, am Toten Meer ein Erfrischungs- und ein Schlammbad zu nehmen. Kein Reiseführer kommt ohne ein Foto aus, das einen ganz in Fango geschwärzten Menschen zeigte, und/oder einen eifrigen Zeitungsleser, der seinem Lektürevergnügen schwimmend nachgeht. Bekanntlich ist der Salzgehalt des Toten Meeres, dem tiefsten Punkt der Erde, 33 Prozent hoch und trägt den menschlichen Körper. Manchmal schwierig ist es für den Zeitungsleser, wieder Boden unter die Füße zu bekommen, denn der Auftrieb ist zuweilen kräftiger als der eigene Schwung. Dann muss ein freundlicher Helfer her, der demjenigen die Füße nach unten drückt, bis er wieder einen festen Stand hat.
Früh muss der Marathoni aus den Federn, denn sein Start ist auf sieben Uhr terminiert. Da die Zeit fürs Frühstück ausreichend sein soll und der Weg zum Start zu Fuß etwas beschwerlich sein kann, zumal die Stadt für Fahrzeuge recht zeitig gesperrt wird, wird der Wecker bei den meisten schon vor vier oder halb fünf Uhr klingeln. Wer mag, kann sich auch zuvor noch die Sonderbeilage zum Marathon in der englischsprachigen "Jerusalem Post" zu Gemüte führen.
Was den Läufer der Königsdisziplin dann erwartet, ist alles andere als leicht, denn mit einem normalen und flachen Marathon hat die Strecke in Jerusalem nichts zu tun. Deshalb ist der Empfehlung des Bürgermeisters, die persönliche Rekordjagd zu vergessen und den Lauf mit den Augen zu genießen, unbedingt zuzustimmen. Mit einem ständigen Rauf und Runter, dem Fehlen nahezu jeglicher flachen Passagen und den rund 800 Höhenmetern gehört der Lauf zu den weltweit schwierigsten Citymarathons, ohne freilich ein Bergmarathon zu sein. Schwierig ist es vor allem, den geeigneten Laufrhythmus zu finden, was im Übrigen für den nicht minder schweren Halbmarathon (400 Höhenmeter) und Zehner (250 Höhenmeter) gilt.
Die Veranstalter werben nicht ohne Stolz damit, dass die Strecke an einer großen Zahl der Sehenswürdigkeiten vorbeiführt, doch wird nicht jeder ob der Anstrengungen auch wirklich einen Blick dafür haben. Der Marathonkurs, und das gilt eingeschränkt auch für die beiden anderen Hauptstrecken, ist so verwinkelt wie die Stadt selbst, allerdings nicht im Sinne von eckig und bremsend. Es gibt aber mehrere Wendepunkte, Gegeneinanderlauf-Passagen und Kreuzungen von Wegen, die man schon einmal lief. Auf dem Streckenplan ist daher die Wegeführung nicht sicher nachzuvollziehen, sie wirkt da eher etwas verwirrend. Deshalb sollte man sich lieber auf die Strecke gefühlsmäßig einlassen, auf sein Bauchgefühl hören und weniger eine Strategie ausarbeiten. Das wird kaum klappen.
Teilweise führen die drei Hauptstrecken auf den gleichen Wegen dem Ziel entgegen. Gestartet und gefinisht wird auf breiten Boulevards; überhaupt ist die sehr lange Startpassage auf den ersten sieben Kilometern so großzügig, dass keine Enge aufkommt. Bei deutlich mehr Startern in den Unterdisziplinen kann das nicht immer behauptet werden. Eng wird es auch später nicht, wenn die Wege schmaler und der Untergrund in der Altstadt etwas rau werden.
Der Weg durch den arabischen Ostteil der Stadt, insbesondere die kurze Passage durch die Altstadt, gehört zu den schönsten Abschnitten. Aber auch die Umrundung der Universität und der Durchlauf durch die deutsche Kolonie ist ein Augenschmaus. Hier und an einigen Wendepunkten sowie im Zielbereich stehen auch die meisten Zuschauer. Insgesamt allerdings ist das Publikumsaufkommen noch recht bescheiden, zumal die hier lebenden Palästinenser kaum Interesse am Lauf haben dürften. Zudem ist der Lauftag ein Freitag, der arbeitsfreie Tag der arabischen Bevölkerung, die dann lieber anderen Dingen nachgehen, als sich an eine Laufstrecke zu stellen.
Dem ungeachtet zogen die Schwarzafrikaner in bekannter Manier ihre Bahn. In drei Rennen gab es 2013 Streckenrekorde. Das mag zwar nicht so bedeutungsvoll erscheinen, wenn man berücksichtigt, wie jung die Veranstaltung noch ist, doch flößen die meisten gelaufenen Siegzeiten angesichts des Schwierigkeitsgrades durchaus Respekt ein, allein schon, wenn man die Steigerung der Marathonzeit der Männer betrachtet.
Nach 2:26 in 2011 und 2:19 in 2012 lief der überragende 26jährige Äthiopier Abraham Kabeto Ketla in 2:16:29 eine kaum für möglich gehaltene Siegerzeit. Der Mann, der auf der Zielgerade im Gegensatz zu den nachfolgenden Kenianern Luka Kipkemoi Chelimo (2:19:01) und Vincent Kiplagat Kiptoo (2:20:12) vollkommen frisch wirkte, war zunächst im Führungspulk gelaufen, konnte sich aber bald befreien und hatte schon nach zwei Dritteln der Strecke einen deutlichen Vorsprung von anderthalb Minuten erarbeitet. Mit 5000 Dollar Siegprämie und der gleichen Zusatzeinnahme für den Streckenrekord (und vermutlich einem Antrittsgeld in unbekannter Höhe) wurde er für die gut zweistündige Arbeit nicht schlecht honoriert.
Die gleiche Summe strich auch die Frauensiegerin und Landsfrau Mihiret Anamo Anotonios ein, die schon im Vorjahr den Lorbeer davongetragen hatte, seinerzeit noch eine gute Minute langsamer. Sie benötigte 2:47:27, war aber ohne ernste Konkurrenz, denn schon bei km 6 war sie sehr deutlich vorne gelegen, musste aber ab km 28 mächtig beißen. Ihr folgten die Äthiopierin Radiya Muhammad Roba in bescheidenen 3:05:58 und die US-Amerikanerin Elissa Ballas aus Ohio in 3:11:33. Sie hatte recht forciert begonnen, lag zunächst deutlich vor der Schwedin Frida Sodermark aus Norköpping, spürte aber dann zusehends deren Atem im Nacken. Sodermark holte über fünf Minuten auf, die sie bei Halbzeit noch zurückgelegen hatte, kam aber dennoch nur auf Rang vier und verpasste das Treppchen um nur drei Sekunden. Die gutgelaunten Blondine aus Europas hohem Norden wurde in 3:11:36 schnellste Europäerin.
Der schnellste Israeli im Marathon war Liran Raz vom Kibbutz Ayalot, der 2:55:37 benötigte. Der schnellste Europäer war auf Rang 6 hinter fünf Schwarzafrikanern der Portugiese Rose Monteiro in 2:47:25. Er war knapp hinter der Frauensiegerin als Gesamtsiebter eingelaufen.
Der Sieger des Halbmarathons war der Kenianer Stephen Kabari Njeri. Seine beeindruckende Siegerzeit lautet 1:06:51, reichte aber nicht für das Auslöschen des Streckenrekords aus dem Vorjahr. Über eine Minute fehlte. Ihm folgte der Äthiopier Gedamujziabher Mariam mit 1:10:55 und der Jerusalemer Asarat Mamo mit 1:10:59. Diese Angelegenheit war offensichtlich sehr eng. Bei den Frauen siegte Dagne Balcha Kalkidan in 1:22:34 vor Weldehawariat Ebereegzabehar in 1:26:35 und der Israelin Ya'arah Zangi-Redoshitzki in 1:28:04. Bei Kalkidan kann man nachvollziehen, wie viele Minuten die Schwierigkeit des Kurses kostete, denn sie läuft normalerweise immer locker unter 1:18.
Beim Lauf über zehn Kilometer enthielt die Teilnehmerliste einen in der Laufszene weltberühmten Namen: Ingrid Kristiansen. Die 1956 geborene Norwegerin war auf Einladung gekommen und hatte insbesondere in den achtziger Jahren mit zahlreichen Weltrekorden und Siegen bei internationalen Marathons für Furore gesorgt. Zusammen mit Landsfrau Grete Waitz hatte sie den Frauenlanglauf revolutioniert. Diesmal ließ sie es langsam angehen. Ihre Zeit erscheint zwar in der Siegerliste, da ihr Name allerdings auf Hebräisch eingetragen wurde, kann sie nur verifiziert werden von einem, der dieser Sprache mächtig ist. Der wird eine 44:15 finden.
Am Start des Zehners war es noch zum Sturz mehrerer Läufer gekommen, die einen Teilnehmer in einem Rollstuhl nicht sehen konnten, der von einem anderen Läufer geschoben wurde und ganz vorne an der Startlinie stand, zusammen mit der Laufelite. Soweit zu hören war, ist niemandem etwas Ernstliches passiert, und alle Gestürzten konnten wohl ihr Rennen mit kurzer Verzögerung aufnehmen.
Die israelischen Sieger des Zehners liefen bei den Frauen 38:52 und bei den Männern 31:26. Während damit bei den Frauen der Rekord aus dem Vorjahr deutlich verpasst wurde, bedeutet die Männerzeit Streckenrekord. "Kann ich kaum glauben, dass hier einer unter 32 Minuten läuft", kommentierte der frühere deutsche Meisterläufer Jörg Valentin den Spitzenwert. Er war selbst mitgelaufen und berichtete davon, wie schwer schon der Anfang des Rennens um die hebräische Universität gewesen war und wie sehr der finale Anstieg die letzten Kraftreserven beanspruchte. Immerhin wurde er in 41:08 schnellster M50er und schnellster Europäer. Tatsächlich war Valentin 40:33 gelaufen, doch wurde seine Zeit einem direkt vor ihm in der Siegerliste stehenden Israeli zugewiesen. Schnellste Deutsche über 10 km wurde Mirjam Meyer aus Aalen in 58:45.
Im Marathon konnten sich Sonja Goll aus Kleinmalchow in 3:52:35 und Thobias Scharte aus Heidelberg in 3:24:14 als schnellste Deutsche in die Liste eintragen. Goll wurde 14. bei den Frauen und Scharte 64. in der Gesamtwertung. Im Halbmarathon waren die meisten Deutschen am Start. Hier konnte sich Andreas Wieser aus Meiselburg in 1:33:35 als flottester erweisen, und bei den Frauen war es Sonja Landwehr aus Böblingen in 1:56:07.
Die meisten waren mit zwei Laufreiseunternehmen aus Deutschland angereist, doch waren es weniger Mitfahrende als gedacht. Denn zur Hauptanmeldezeit für die Laufreise nach Jerusalem im späten Herbst tobten die militärisch ausgetragenen Auseinandersetzungen zwischen den Israelis und den Palästinensern.
Der Jerusalem Marathon war von Anfang an umstritten. Während der davor regelmäßig ausgetragene Halbmarathon keinerlei politische Aufmerksamkeit erzeugte, änderte sich das schlagartig, als Bürgermeister Nir Barkat für 2011 die Austragung eines ganzen Marathons ankündigte. Es war weniger die Tatsache selbst, dass ein Marathon kommen würde, als die geplante Streckenführung, die die Gemüter erhitzte. Barkat legte dar, dass der Marathon auch durch das arabische Ostjerusalem und sogar teils durch die Altstadt führen sollte. Das rief die palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) auf den Plan, die schon 2011 zum Boykott der Veranstaltung und seiner Hauptsponsoren, darunter der Sportschuhhersteller adidas, aufrief. Parallel zu allen drei bisher ausgetragenen Marathons organisierte die PLO eine Demonstration gegen den Lauf, dem 2013 lediglich etwa sechzig Palästinenser gefolgt sein sollen, die sich am Eingang zur Altstadt positioniert hatten.
Barkat ließ sich jedoch nicht einschüchtern, trotz der internationalen Aufmerksamkeit, den der PLO-Aufruf schon 2011 erreichte. Der deutsche "Spiegel" widmete der Debütveranstaltung sogar einen großen Artikel. Unter besonderen Vorzeichen stand die Premiere auch deshalb, weil zwei Tage vor dem Start eine Bombe explodierte, gerade einmal ein Kilometer entfernt von der Marathonexpo. Das Bombenattentat forderte den Tod einer 39 Jahre alten britischen Touristin und verletzte weitere vierzig Menschen.
Die Palästinenser empfanden den Marathon von Anfang als Provokation und nutzen ihn zur politischen Propaganda; die Israelis demonstrierten mit der Durchführung ihre Entschlossenheit und Willenskraft, bei der ersten, bei der zweiten und auch dritten Durchführung.
 |
 |
| Läufer, die unter 3:15 Stunden blieben, hatten den Zielkanal für sich alleine ... | Unter männlichem Kommando kümmerten sich gleich fünf Masseurinnen um die geschundene Muskulatur - Fotos (2) T.H. |
So war es nicht verwunderlich, dass bei der am Vortag durchgeführten Pressekonferenz die erste Frage der aus 12 Ländern angereisten Journalisten eine politische Motivation hatte. Doch Bürgermeister Barkat machte deutlich, dass der Marathon keinen politischen Hintergrund habe, sondern einzig aus sportlichen und touristischen Gründen veranstaltet würde. Der Streckenverlauf sei weitgehend nach Gesichtspunkten gestaltet, ihn nicht noch hügeliger zu machen, als er ohnehin schon sei. Die Sicherheit der Beteiligten sei aber das Wichtigste der Veranstaltung, und hierfür sei alles getan. Denn, wenn sich eine Nation mit der Bekämpfung des Terrors auskenne, dann Israel, hatte er schon bei der ersten Durchführung verlauten lassen. Tatsächlich war die dritte Auflage die erste, die ohne Zwischenfälle vonstatten ging.
Männer mit Maschinengewehr gehören in Israel nicht nur während des Marathons, sondern auch sonst zum Straßenbild. Während des Marathons treten sie nur deutlich nachhaltiger in Erscheinung. Das hat aber nicht unbedingt immer etwas mit den Sicherheitsbestrebungen zu tun. Denn wenn ein junger Militär mitlaufen möchte, muss er zwangsläufig das Gewehr am Mann haben, denn es irgendwo abzustellen, ist undenkbar und verboten, auch zu Hause nicht. Da dem Jerusalem Marathon auch eine Art Militärmeisterschaft über 10 km angegliedert ist, die fünfzehn Minuten vor dem allgemeinen Zehner startet, sind noch viel mehr Gewehre unterwegs, als ohnehin schon. Die schnellsten dieses Rennens liefen bei den Männern 38 Minuten, bei den Frauen 44.
Die allgemein spürbare Gelassenheit der Veranstalter in den brisanten Sicherheitsfragen überträgt sich auch auf die Läufer und Begleiter. Der PLO-Boykottaufruf konnte in Israel kaum noch jemand hinter dem Ofen hervorlocken, lediglich die internationale Presse nahm 2013 davon noch in kleinen Meldungen Notiz. Die Mehrheit der Läufer sprach sich schon immer und spricht sich auch heute noch gegen eine politische Instrumentalisierung des Sports aus.
 |
 |
| Die Marathonsiegerehrung der Frauen - Foto T.H. | Das äthiopische Siegerpaar im Marathon Mihiret Anamo Anotonius (2:47:25) und Abraham Kabeto Ketla (2:16:28) |
Das war schon bei den weitreichenden Olympiaboykotts in der Vergangenheit der Fall, und ist so geblieben, auch wenn der Jerusalem Marathon eine geeignete Plattform bietet, Dinge zu thematisieren, die mit dem Lauf nichts zu tun haben. Schon beim Ausfall des letzten Marathons in New York, der bekanntlich einer Naturkatastrophe und damit höherer Gewalt zum Opfer fiel, gab es nicht wenige Stimmen, die meinten, gerade jetzt sollte mit der Durchführung ein Zeichen gesetzt werden. Der Sportler möchte Sport treiben, was nicht automatisch heißt, dass er für gesellschaftliche oder politische Dinge kein Interesse hat. Das Gegenteil ist der Fall.
In Israel wussten offenbar viele gar nichts vom Boykottaufruf, so nebensächlich erscheint er. Hier rückten schon kurz nach dem Marathon andere Meldungen verstärkt ins Bewusstsein, beispielsweise die Ankündigung einer aus Ägypten herüberkommende Heuschreckenplage im Süden des Landes, oder auch die Veröffentlichung des ersten "Playboy" in hebräischer Sprache.
Diese Pressemitteilungen zeigen weniger an, dass man nach dem Marathon wieder zum Alltag übergangen ist. Der Alltag war durch denselben erst gar nicht unterbrochen worden, zumindest nicht in der Stadt und in dem Land, in dem er ausgetragen wurde.
 |
Bericht und Fotos Michael Schardt Info und Ergebnisse unter www.jerusalem-marathon.com Zu aktuellen Inhalten im LaufReport HIER |
 |
© copyright
Die Verwertung von Texten und Fotos, insbesondere durch Vervielfältigung
oder Verbreitung auch in elektronischer Form, ist ohne Zustimmung der LaufReport.de
Redaktion (Adresse im IMPRESSUM)
unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes
ergibt.