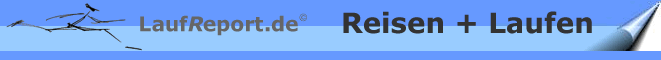

 |
 |
 |
 |
 |
 |
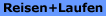 |
 |
 |
 |
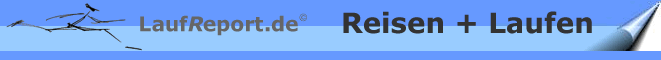 
|
 |
Comrades Marathon HistorieComrades Marathon - der ultimative Lauf |
|
von Ralf Klink
|
Zum Reisen+Laufen-Beitrag von Ralf Klink im LaufReport über den Comrades Marathon 2011 HIER
Es gibt im internationalen Laufzirkus Rennen, die kommen als Klassiker daher, verkaufen sich sogar als solche. Und es gibt andere, die sind tatsächliche absolute Klassiker. Wenn es darum geht, die Mutter aller Marathons zu finden, führt eben kein Weg am seit 1897 ausgetragenen Boston Marathon vorbei. Bei all der Katalysatorwirkung, die man der Veranstaltung in New York für die weltweite Entwicklung des Laufens sicher zugestehen muss, gibt es schließlich auch in Deutschland mit dem Schwarzwald-Marathon von Bräunlingen und dem Baldeneysee-Marathon von Essen, Rennen mit längerer Tradition.
In der Hauptstadt von Massachusetts wird dagegen praktisch schon über diese Distanz gelaufen, seit sie für die ersten Olympischen Spiele von Athen erfunden wurde. Nur wenige Veranstaltungen im Bereich des Sportes sind noch älter. Und das auch nicht wirklich viel, denn die in eine ähnliche Preisklasse fallenden Radrennen Lüttich-Bastogne-Lüttich und Paris-Roubaix wurden zum Beispiel 1896 und 1892 ins Leben gerufen.
Und weil diese während der beiden Weltkriege aus nahe liegenden Gründen mehrfach ausfielen, gibt es sogar mehr Boston Marathon Sieger als Gewinner der beiden Radklassiker. Denn nur ein einziges Mal seit der Premiere wurde im Jahr 1918 an der amerikanischen Ostküste keiner gekürt. Da damals allerdings – nach dem Kriegseintritt der USA in den ersten Weltkrieg – mehrere Militärstaffeln die schon seit mehr als zwei Dekaden übliche Strecke unter die Füße nahmen, wird dieser Lauf in der offiziellen Zählung ebenfalls mitgerechnet.
Auch im Ultralauf gibt es eine Veranstaltung, die man in der Bedeutung und langen Geschichte fast mit dem Boston Marathon vergleichen könnte. „Biel“ werden jetzt die meisten sofort ausrufen. Ja sicher, der Hunderter im Seeland hat schon mehr als fünf Jahrzehnte auf dem Buckel. Und ohne seine Pionierleistung wären Strecken jenseits der zweiundvierzig Kilometer in Mitteleuropa vielleicht noch immer nicht salonfähig.
Doch muss man in den Chroniken noch viel, viel weiter – nämlich bis 1921 – zurück blättern, um die Premiere jenes Ultrarennens zu finden, das als das älteste seiner Gattung gelten darf. „Comrades Marathon“ wird es in dezenter Untertreibung der zu laufenden Distanz genannt. Schließlich muss man dabei jedes Jahr eine Strecke von knapp neunzig Kilometern zurück legen.
Und längst ist es nicht nur die geschichtsreichste sondern auch die größte Veranstaltung im Ultramarathonbereich. Seit mehr als zwanzig Jahren erreicht das Starterfeld nämlich konstante Werte von deutlich über zehntausend Menschen. Eine Größenordnung, in die zu jener Zeit gerade einmal ein halbes Dutzend Marathons vorstießen. Inzwischen ist dieser Wert zwar auf gut zwanzig Veranstaltungen angewachsen, dennoch fällt eine solche Teilnehmerzahl bei einem über doppelt so langen Lauf noch einmal in eine ganz andere Kategorie.
Allerdings zucken selbst altgediente Ultra-Haudegen und Biel-Veteranen trotzdem oft nur mit den Schultern, wenn der Name der Veranstaltung fällt. Vom „Comrades Marathon“ haben wirklich viele von ihnen noch nie etwas gehört. Denn dieses Rennen wird eben zwölf Flugstunden entfernt in Südafrika, den beiden Städten Pietermaritzburg und Durban ausgetragen. Also in einem Land, das für viele erst in dem Moment überhaupt einen Platz auf der Landkarte bekam, als es mit der Ausrichtung einer Fußball-Weltmeisterschaft beauftragt wurde.
Und ein Ultralauf ist eben für die hiesigen Medien – im Gegensatz zu den ganz großen Marathons, die meist zumindest eine kurze Meldung wert sind – auch völlig uninteressant. Viel zu exotisch ist das Ganze. Selbst fast vor der Haustür stattfindende Wettkämpfe mit vierstelligen Teilnehmerzahlen wie Biel oder der Rennsteiglauf finden ja außerhalb von Fachzeitschriften und der Lokalpresse im Allgemeinen nicht die geringste Beachtung. Wen kümmert da schon ein Lauf am anderen Ende der Welt?
Das ist in Südafrika dann doch ein wenig anders. Denn dort wird von diesem Rennen nicht nur im Fernsehen berichtet. Man tut das beim Comrades Marathon sogar live und in voller Länge. Kein Wunder also, dass er auch beim nicht laufenden Bevölkerungsteil einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Und nirgendwo sonst auf der Welt hat Laufen jenseits der Marathondistanz einen ähnlichen Stellenwert.
Der Comrades ist nämlich bei weitem nicht der einzige Ultralauf mit vierstelligen Feldern. Beim sechsundfünfzig Kilometer langen Two Oceans Marathon von Kapstadt werden jährlich zwischen sechs- bis achttausend Läufer im Ziel gezählt. Die Fünfziger „Om die Dam“ und „Loskop“ knacken in schöner Regelmäßigkeit die Dreitausendermarke. Aber König der Ultras ist und bleibt eben doch unbestreitbar der Comrades Marathon.
Wer sich als Besucher des Landes am Kap irgendwo als Läufer zu erkennen gibt oder erkannt wird, landet fast unvermeidlich in einer Diskussion über dieses Rennen. „Warst du dort auch schon dabei? Da must du unbedingt einmal mitmachen.“ Kann man sich vorstellen in einem europäischen Hotel oder Restaurant hunderte Kilometer vom Austragungsort entfernt ähnliches zu Biel oder dem Rennsteiglauf gefragt zu werden?
Doch nicht nur wegen unglaublicher Teilnehmerzahlen und riesigen Medieninteresses ist Südafrika das El Dorado des Ultralangstreckenlaufens. Nirgendwo sonst sind die Rennen auch ähnlich gut dotiert. Umgerechnet werden beim Comrades in Summe nämlich weit über hunderttausend Euro Preisgeld ausgeschüttet.
Alleine die Ersten bei Männern und Frauen werden mit jeweils zweihundertfünfzigtausend südafrikanischen Rand bedacht, was zum aktuellen Wechselkurs ziemlich genau fünfundzwanzigtausend Euro entspricht. Im Falle eines Streckenrekordes ist sogar noch einmal die gleiche Summe als Bonus fällig. Beträge, die auch im Marathongeschäft nur bei ganz wenigen großen und bedeutenden Rennen übertroffen werden.
Und selbst wenn es beim Two Oceans fast ähnlich viel zu verdienen gibt, auch in dieser Hinsicht dürfte der Comrades Marathon die Nummer eins der weltweiten Ultraszene sein. Trotz aller Rekorde wirkt der selbstgewählte Beiname „The ultimate human race“ allerdings bei nüchterner Betrachtung und aus dem europäischen Blickwinkel vielleicht dann doch etwas zu großspurig.
Aber wie viele „schönste“, „größte“, „beste“, „einzige“ oder „einzigartige“ Veranstaltungen gibt es nach dem Bekunden der jeweiligen Veranstalter sonst noch in der Laufwelt? Rennen, die oft deutlich weniger zu bieten haben. Marketingsprüche gehören im enger gewordenen Markt inzwischen eben dazu. Und wer wenn nicht der Comrades Marathon dürfte Superlative denn wirklich benutzen? Zumal er für die meisten südafrikanischen Läufer eben tatsächlich auch das „ultimative Rennen“ ist.
Ob sich Vic Clapham, der Gründer der Veranstaltung, bei der Premiere erträumt haben dürfte, welche Ausmaße seine Idee einmal annehmen würde? Vermutlich eher nicht. Er war wohl erst einmal froh und zufrieden, dass der von ihm erdachte Lauf zwischen seiner Heimatstadt Pietermaritzburg und der Hafenstadt Durban überhaupt endlich in die Tat umgesetzt werden konnte.
Denn bereits zwei Jahre lang hatte er sich bei verschiedenen Institutionen um die Genehmigung zur und die Mithilfe bei der Organisation bemüht, war aber immer wieder abgelehnt, ja für verrückt erklärt worden. Clapham, in London geboren aber bereits im Kindesalter mit seinen Eltern nach Südafrika ausgewandert, wollte das Rennen allerdings keineswegs als sportlichen Selbstzweck.
Er hatte während des kurz zuvor zu Ende gegangenen ersten Weltkriegs im südöstlichen Teil des afrikanischen Kontinents jahrelang gegen die deutschen Truppen von General Paul von Lettow-Vorbeck gekämpft und dabei in der Verfolgung des immer wieder ausweichenden Gegners Tausende von Kilometern marschierend zurück gelegt. Wenn das bei sengender Sonne, durch weglose Savannen und bei oft nur spärlicher Wasserversorgung mit zwanzig oder dreißig Kilogramm Gepäck auf dem Buckel möglich war, warum sollte dann nicht auch ein Lauf von ungefähr fünfundfünfzig Meilen denkbar sein?
Vor allem hatte Clapham bei diesen Feldzügen etliche Kameraden – auf Englisch „Comrades“ – verloren. Und noch viel, viel mehr Südafrikaner waren aus den Schützengräben Frankreichs und Belgiens, in denen sie als Bewohner des britischen Empires dienten, nicht nach Hause zurück gekehrt. An all diese Männer wollte er mit seinem überlangen Marathon hauptsächlich erinnern.
Aus heutiger – und insbesondere aus deutscher Sicht – wirkt da vielleicht etwas zu pathetisch. Zumal nur zwei Jahrzehnte später ein zweiter Krieg ausbrach, der noch viel mehr – auch südafrikanische – Opfer kostete. Und viele, die heutzutage am Comrades Marathon teilnehmen, denken sicher nicht mehr im Geringsten an diese Entstehungsgeschichte. Doch die Formulierung, dass sie „keinen Gedanken daran verschwenden“ wäre unter diesen Umständen sicher fehl am Platz.
Ganz im Gegenteil, „verschwendet“ ist er bestimmt nicht. Denn vielleicht könnte eine gelegentliche Erinnerung an die gigantischen, menschenverachtenden Ausmaße dieser Konflikte gar nicht schaden, um die friedlichen Entwicklungen, die sich gerade Europa in den letzten Dekaden ergeben haben, wirklich schätzen zu lernen. Der Name „Comrades Marathon“ hat jedenfalls auch bei der fünfundachtzigsten Austragung noch immer Bestand. Und niemand käme auf die Idee, daran etwas ändern zu wollen.
Selbst die Funktionäre des seit der Abschaffung der Apartheid das Land regierenden ANC, die sonst überall versuchen, Benennungen europäischen Ursprungs durch afrikanische zu ersetzen, haben sich an diese nationale Ikone noch nicht heran getraut. Durban allerdings ist mit einigen Umlandgemeinden verwaltungsmäßig zur Metropolregion „eThekwini“ zusammen gelegt worden. Und um Pietermaritzburg, das nach den Burenführern Pieter Retief und Gerrit Maritz benannt ist, toben alleine schon aus diesem Grund heftige Debatten.
Im Jahr 1921 hatten die stetigen Bemühungen von Clapham bei der Veteranenvereinigung „League of Comrades of the Great War“ – die Sportverbände hatten seine Anfragen immer wieder abgelehnt – jedenfalls endlich Erfolg. Nach mehreren Absagen sicherte sie ihre Unterstützung zu. Dass die finanzielle Hilfe aus gerade einmal einem einzigen Pfund bestand, das als Darlehen auch noch zurück zu zahlen war, scheint aus heutigem Blickwinkel eigentlich unvorstellbar.
Am 24. Mai, dem Empire Day, um sieben Uhr morgens machten sich jene vierunddreißig Läufer, die den in der lokalen Presse veröffentlichten Einladungen zum Rennen gefolgt waren, auf den Weg vom sechshundert Meter hoch gelegenen Pietermaritzburg hinunter ans Meer. Nun ja, eigentlich war es erst um zehn Minuten nach sieben, denn aufgrund technischer Probleme musste der Start um einige Minuten verschoben werden. Nicht alles lief damals schon so perfektioniert wie heute.
An Verpflegungsstellen unterwegs war zum Beispiel noch nicht zu denken. Den Teilnehmern wurde in den ersten Jahren geraten, sich in einigen an der Straße gelegenen Hotels zu versorgen. Heutzutage beläuft sich die Zahl der Posten dagegen auf inzwischen weit über vierzig. Im Schnitt gibt es beim Comrades also etwa nach jedem zweiten Kilometer wieder etwas zu trinken.
Zwölf Stunden waren für das erste Rennen als Limit ausgegeben. Sechzehn Starter schafften es in der vorgegebenen Zeit, zehn von ihnen allerdings erst in den letzten sechzig Minuten des Zeitfensters. Schnellster und damit Erster in der inzwischen ziemlich langen Reihe von Comrades-Siegern war William „Bill“ Rowan, der das Rennen in 8:59 Stunden gute vierzig Minuten vor Harry Phillips beendete.
Ein Jahr später, beim zweiten Comrades Marathon hatten bereits 114 Athleten ihre Meldung abgegeben. Schon um sechs Uhr wurde dieser gestartet, weil man gemerkt hatte, dass die Letzten ansonsten wie bei der Premiere wieder in der Dunkelheit ins Ziel kommen würden. Was aus Sicht der Nordhalbkugel ein Datum im späten Frühling oder beginnenden Sommer zu sein scheint, ist in Wahrheit nämlich ein später Herbsttermin.
Nun zählt Natal, die Region, in der Durban und Pietermaritzburg zu finden sind, gerade in dieser Jahreszeit eher zu den wärmeren Gegenden Südafrikas. Tagsüber muss man durchaus mit Temperaturen jenseits der zwanzig Grad rechnen. Die Nächte können allerdings doch recht frisch werden. Vor allem aber sind sie jedoch deutlich länger als die Tage und um sieben Uhr am Abend ist die Sonne längst vom Himmel verschwunden.
Inzwischen wird übrigens bereits um halb sechs gestartet. Die ersten Kilometer läuft man deshalb noch in die gerade erst beginnende Morgendämmerung hinein. Dafür sind dann allerdings auch garantiert alle im Ziel, bevor deren abendliches Gegenstück einsetzt.
Eine viel gravierendere Änderung als die Verschiebung der Startzeit um eine Stunde gab es allerdings auch noch. Diesmal galt es nämlich nicht von Pietermaritzburg nach Durban zu laufen sondern in umgekehrter Richtung von Durban nach Pietermaritzburg. Wie so vieles, was sich in den Anfangsjahren des Laufes eher zufällig ergeben hatte, wurde daraus eine feste Tradition.
Eine der Eigenwilligkeiten des ältesten bestehenden Ultralaufes ist der jährliche Wechsel zwischen sogenannten „Down Runs“ und „Up Runs“, einem Bergab- und einem Bergauf-Rennen. Bisher nur dreimal wurde dieser Rhythmus durchbrochen. 1974 und 1975 sowie 1987 und 1988 ging es aus unterschiedlichen Gründen zweimal hintereinander „up“. Und nach 2009 ist auch 2010 eine „Down-Variante“ ausgeschrieben.
Ansonsten – und auch das ist eine Besonderheit – ist die Strecke über all die Jahre jedoch nahezu unverändert geblieben. Nicht nur in der Auslegung als Punkt-zu-Punkt-Kurs ist man sich da mit der Entsprechung im Marathonbereich aus Boston ziemlich einig. Denn während fast alle anderen Rennen auf der Welt immer wieder einmal an ihren Streckenplänen herumbasteln, um den Lauf schneller, interessanter oder was auch immer zu machen, haben das die wahren Klassiker nicht nötig.
So wie man seit der Festlegung der 42,195 Kilometer als Marathondistanz eben stets von Hopkinton – vorher, als ein Marathon nur ungefähr vierzig Kilometer lang sein musste, startete man im Nachbarort Ashland – in die Hauptstadt von Massachusetts läuft, wird der Comrades eben immer auf der gleichen Straße, der Route 103, zwischen Durban und Pietermaritzburg ausgetragen.
Kleinere Streckenänderungen zum Beispiel wegen Bauarbeiten lassen die genaue Distanz allerdings immer wieder um einige hundert Meter schwanken. Rekorde führt man dennoch. Natürlich jeweils eigene für das Up- und das aufgrund traditionell unterschiedlicher Start und Zielpunkte immer etwa zwei bis drei Kilometer längere Down-Rennen. Wirklich konstant halten kann man das Ganze über die Jahre ja sowieso nicht.
Wieder einmal sei da der Verwandte aus Boston erwähnt. Denn dort musste man irgendwann, als nach einer im Vergleich zu den Rekordlisten eigentlich viel zu guten Siegerzeit die Streckenlänge kontrolliert wurde, erkennen, dass obwohl Start- und Zielpunkt sich nicht verschoben hatten und auch die frühere – allerdings schon ziemlich alte – Messung als durchaus glaubhaft galt, unterwegs rund ein Kilometer verloren gegangen war. Des Rätsels Lösung fand man in Kurvenbegradigungen und Straßenausbauten, wegen denen an etlichen Stellen eben ganz anders gelaufen wurden als Jahrzehnte zuvor beim letzten Ausmessen der Distanz.
Seitdem überprüft man – wenig überraschend – an der amerikanischen Ostküste jährlich. Und auch beim Comrades Marathon wird die exakte Streckenlänge in jedem Jahr immer wieder neu festgestellt und den Läufern bekannt gegeben. Zwischen guten sechsundachtzig und deutlich über neunzig Kilometern kamen dabei heraus. Eine für die Teilnehmer nicht ganz unwichtige Information. Denn bei der Einhaltung des Zeitlimits kann ein Kilometer mehr oder weniger enorm wichtig sein.
Schließlich nimmt man es dabei nun wirklich ganz genau. Zwölf Stunden sind zwölf Stunden und keine Sekunde mehr. Es gibt da nicht die geringste Toleranz. Wer auch nur einen einzigen Schritt zu spät kommt, steht vor dem geschlossenen Ziel und hat das Rennen offiziell nicht beendet. Gnadenloser geht es eigentlich kaum noch. Doch was hierzulande zu einem lauten Aufschrei der Entrüstung führen würde, gehört zum Mythos Comrades einfach dazu, macht vielleicht auch gerade sogar einen der großen Reize des Laufes aus.
Geschenkt bekommt man jedenfalls nichts. Eine gewisse sportliche Leistung wird erwartet. Und jeder der sich anmeldet, kennt die Regeln im Vorfeld und kann genau abschätzen, auf was er sich da einlässt. Untrainiert und nur aus einer Laune heraus kann man sowieso nicht an den Start gehen. Denn ohne den Beleg von in den letzten Monaten erzielten Ergebnissen wie zum Beispiel einem Marathon unter fünf Stunden, wird eine eingegangene Meldung gar nicht akzeptiert.
Übrigens wieder eine Parallele zu Boston, denn auch dort kennt man Qualifikationsnormen. Abstufungen für höhere Altersklassen oder Frauen, wie es bei der Mutter aller Marathons der Fall ist, gibt es beim Comrades dabei allerdings nicht. Für alle gelten die gleichen Vorgaben. Der siebzigjährige Seniorenläufer muss genauso seine Zeiten bringen wie der voll im Saft stehende Dreißigjährige. Nur das Mindestalter für die Teilnahme ist festgelegt. Mit weniger als zwanzig Jahren gibt es keine Starterlaubnis.
So wird L.H. Templeton, der 1922 das Rennen in 11:40 beendete, wohl weiterhin der jüngste Comrades-Läufer bleiben. Denn er war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal sechzehn. Zusammen mit seinem Vater hatte er den größten Teil der Strecke bereits zurück gelegt, als dieser aufgeben musste. Der Junior lief alleine weiter und schaffte es tatsächlich im Zeitlimit. Auch wegen seiner Leistung wurde schon im nächsten Jahr eine untere Altersgrenze von achtzehn Jahren eingeführt, die man später sogar noch einmal anhob.
Trotz einer dreimal so hohen Starterzahl kamen bei der zweiten Auflage nur unwesentlich mehr Teilnehmer rechtzeitig ins Ziel als bei der Premiere. Gerade einmal sechsundzwanzig schafften das Limit. Und bis in die Fünfzigerjahre sollte sich an dieser Größenordnung auch nichts ändern. Werte von zwanzig bis dreißig waren absolut üblich. Manchmal sogar etwas weniger, nur ganz selten auch einmal mehr. Von einer Massenveranstaltung wie in der Gegenwart konnte keine Rede sein.
Aber schnell war der Comrades Marathon dennoch in den Maßstäben der damaligen Zeit und für südafrikanische Verhältnisse zu einem Medienereignis geworden. Praktisch keine Zeitung der Region, die nicht über die Premiere berichtet hatte. Die Resonanz bei der Leserschaft war enorm. Aus diesem Grund kam die Presse dann auch noch viel weniger an der zweiten Austragung vorbei.
Wohl deshalb standen da auch viele an der Startlinie, die dort eigentlich nichts verloren hatten. Selbstdarsteller, die allen zeigen wollten, dass sie so etwas auch konnten und am Ende einsehen mussten, dass sie dazu vielleicht doch nicht in der Lage waren. Denn bei weitem nicht alle unter ihnen hatten sich solide und über einen längeren Zeitraum auf die Bewältigung einer solchen Distanz vorbereitet. Der Vergleich mit den ominösen Stammtischwetten oder Fernsehsender-Aktionen aus der heutigen Zeit lässt sich kaum vermeiden.
Der Sieger der ersten Up-Variante gehörte sicher nicht in die Kategorie der im Englischen recht treffend „Joker“ – ein Begriff, der eben weit mehr als nur eine Spielkarte bezeichnet, sondern viel eher als „Witzbold“, „Possenreißer“ oder „Narr“ übersetzt werden müsste – genannten Pseudo-Helden. Denn er wurde in den nächsten Jahren zu einem der größten Heroen der Comrades-Geschichte.
Arthur Newton war bereits achtunddreißig, als er das Rennen zum ersten Mal für sich entschied. Doch noch vier weitere Erfolge sollten sich in der Folgezeit anschließen. Bei seinem fünften und letzten Sieg 1927 hatte Newton also immerhin schon dreiundvierzig Jahre auf dem Buckel und vor allen Dingen in den Beinen. Und trotzdem blieb er in den Chroniken des Rennens nicht der älteste Gewinner.
Mit 8:40 absolvierte er die eigentlich schwerere Bergaufvariante der Strecke auch in einem höheren Tempo als Bill Rowan, der immerhin noch Dritter werden konnte, im Jahr zuvor in die Gegenrichtung gelaufen war. Harry Phillips, der später auch Südafrika bei den Olympischen Spielen von Paris 1924 im Marathon vertrat, landete wieder auf Rang zwei. Eine Platzierung, die er auch drei Jahre danach noch einmal erreichte, bevor es ihm 1926 endlich gelang, die Siegesserie von Newton einmal zu durchbrechen.
Dieser Arthur Newton vollbrachte mit seinem zweiten Sieg beim dritten ausgetragenen Comrades Marathon allerdings erst sein wahres sportliches Husarenstück. Denn er war bei seiner Titelverteidigung nicht nur fast eine Stunde vor dem Zweiten in Durban. Er legte die Distanz zudem mehr als zwei Stunden schneller zurück als Bill Rowan bei der Premiere. Nach gerade einmal 6:56 Stunden wurde Newton im Ziel notiert.
Und das – so erzählt es eine schöne Anekdote – eigentlich nur zufällig. Denn so schnell hatte von den Organisatoren des Rennens eigentlich überhaupt niemand mit dem Sieger gerechnet. Nur aufgrund des Umstandes, dass einer der Offiziellen gerade am Ziel vorbei ging, als Newton die Straße herunter kam, und die Siegerzeit von der Uhr des nahegelegenen Postamtes ablesen konnte, wurde die Leistung überhaupt beurkundet.
Danach waren die Verantwortlichen besser auf mögliche Bravourleistungen Newtons vorbereitet. Sie taten gut daran, denn auch die Marke für den Up Run drückte er 1924 mit 6:58 unter sieben Stunden. Und ein Jahr darauf zwackte er noch einmal über eine halbe Stunde von seiner Rekordzeit und kam nach 6:24 in Durban an. Eine Leistung, die erst 1937, also ein Dutzend Jahre später von Johnny Coleman um eine Minute unterboten werden konnte.
Frauen waren zu jener Zeit – fast möchte man sagen „natürlich“ – nicht zugelassen. Schließlich dauerte es bis zum Ende der Sechzigerjahre bis weibliche Teilnehmerinnen bei „normalen“ Marathons an den Start gehen durften. Als sich Frances Hayward 1923 zum Comrades anmelden wollte, wurde sie deshalb auch abgelehnt. Doch die Schreibkraft einer Bank in Durban ließ sich dadurch von ihrem Vorhaben nicht abhalten, sondern lief dem gerade gestarteten Feld einfach auf eigene Faust hinterher.
Sie bewältigte die knapp neunzig Kilometer immerhin in 11:35 und zeigte am Ende mehreren der offiziellen Läufer die Hacken. Eine Medaille, die es für alle, die das Rennen im Zeitlimit beendeten, schon seit der ersten Austragung gab, bekam sie allerdings nicht. Deshalb wurde eine Sammlung unter Zuschauern und ihren Mitläufern abgehalten, um auch ihr einen Preis besorgen zu können.
Dass sie die Distanz ohne Probleme überstand, konnte die Verantwortlichen allerdings nicht von ihrer Auffassung abbringen, Frauen hätten beim Comrades Marathon nichts verloren. Auch Geraldine Watson, die Anfang der Dreißiger gleich dreimal außer Konkurrenz mitlief und nach der die Trophäe für den letzten Läufer, der das Ziel im Zeitlimit erreicht, benannt ist, oder Mavis Hutchinson und Maureen Holland, die in den Sechzigern und frühen Siebzigern dafür sorgten, dass kaum noch eine Auflage ohne weibliche Beteiligung stattfand, erhielten keine offizielle Anerkennung.
Erst mehr als fünf Jahrzehnte nachdem die erste Frau von Pietermaritzburg nach Durban gelaufen war, wurde das Rennen 1975 auch für Läuferinnen geöffnet. Elizabeth Cavanagh, die ebenfalls schon einmal ohne Wertung auf die Strecke gegangenen und auch im Zeitlimit angekommen war, bekam nun als Erste die so begehrte Medaille ausgehändigt.
Dass diese seit der ersten Austragung in Größe, Form und Aufschrift praktisch unverändert ist, gehört ebenfalls zu den vielen sorgsam gepflegten Traditionen des Comrades Marathons. Neben dem Namen des Rennens und dem Schriftzug „MARITZBURG – DURBAN“ am äußeren Rand trägt sie in der Mitte den griechischen Götterboten Hermes, der auch das Logo der Veranstaltung ziert. Das mögen manche vielleicht nicht mehr ganz auf Höhe der Zeit finden. Doch bei einer solch langen Geschichte muss man nun wahrlich nicht mehr jeden Trend hinterher hecheln.
Auch um die Medaillen ist ein gewisser Kult entstanden. Denn an ihrer Farbe lässt sich die jeweilige sportliche Leistung ungefähr ablesen. Inzwischen gibt es sechs verschiedene Abstufungen, die anfangs nach Plätzen und dann nach erzielten Zeiten vergeben werden. Wer sich noch an die längst vergangene Periode der ersten Volksläufe erinnern kann, dem kommt bei diesen Worten vielleicht wieder in den Sinn, dass ähnliches auch hierzulande einmal üblich war.
Jedenfalls entsteht so nicht nur beim Kampf um den Sieg und am Ende beim Ringen um die Einhaltung des Zeitlimits große Dramatik. Auch zwischendurch bauen sich immer wieder neue Spannungsbögen auf, was den Zuschauern am Ziel und vor den Bildschirmen sicher nicht unrecht ist. Und für die Athleten ergeben sich so interessante sportliche Anreize für die Feststellung der eigenen Leistungsfähigkeit.
Die ersten zehn Jahre waren die Auszeichnungen nur in einer Farbe, nämlich silbern. Erst 1931 erfolgte dann die erste Abstufung. Denn seit der elften Auflage bekamen die ersten sechs Läufer goldene Medaillen überreicht. Später wurde das auf die ersten zehn Plätze erweitert. Eine feine Ironie ist, dass ausgerechnet nach dem letzten Sieger, der „nur“ eine silberne Plakette – die damals allerdings wirklich noch vollständig aus Silber war – erhielt, die sechste und letzte eingeführte Abstufung benannt ist. Wally Hayward gehört nämlich ebenfalls zu den großen Heroen der Comrades Marathons.
Doch sollte seine große Zeit erst noch kommen. Bei seinem ersten Erfolg war er nämlich gerade einmal einundzwanzig. Und fast hätte es sogar einen noch jüngeren Sieger gegeben. Denn Phil Masterson-Smith, der auf den letzten zwanzig Kilometern über eine Viertelstunde aufgeholt hatte und gerade einmal siebenunddreißig Sekunden hinter dem völlig erschöpften Hayward die Ziellinie überquerte, war sogar erst achtzehn.
Dafür erhielt der knapp geschlagene Verfolger im Jahr darauf die erste Goldmedaille. Doch wenn die zehnte Auflage schon ein echter Krimi war, die elfte setzte im Hinblick auf die Dramatik noch einen drauf. Denn nach mehreren Führungswechseln auf den letzten Kilometern spurteten Masterson-Smith und Noel Buree im Stadion um den Sieg. Der neunzehnjährige Pietermaritzburger hatte schließlich gerade einmal einen guten Meter Vorsprung.
Bis zum heutigen Tag ist er damit der jüngste Sieger in den Comrades-Büchern. Weitere Erfolge konnte er danach jedoch nicht verbuchen. Und den zweiten Weltkrieg überlebte er genauso wenig wie Frank Sutton, der 1929 den ersten Platz belegte. Dass ausgerechnet die Gewinner eines Rennens, mit dem die in einem großen Krieg gefallene Kameraden geehrt werden sollten, im nächsten, noch größeren Krieg ihr Leben ließen, entbehrt sicher nicht einer gewissen Tragik.
Die Dreißiger gehörten jedenfalls erst einmal Hardy Ballington, der zwischen 1933 und 1938 viermal gewinnen konnte und einmal Zweiter wurde. Nach der durch den Krieg bedingten Pause in den Jahren 1941 bis 1945 siegte er 1947 noch ein fünftes Mal und zog dadurch mit Arthur Newton gleich.
Inzwischen – genau genommen seit 1928 – war das Zeitlimit auch auf elf Stunden abgesenkt worden. Eine Tradition, die auch nicht gebrochen wurde, als bei der Wiederaufnahme des Rennens 1946 gerade einmal acht Läufer vor dem Zielschluss ankamen. Es blieb aber der niedrigste Wert in der Geschichte. In den Jahren darauf stiegen die Teilnehmerzahlen langsam aber praktisch kontinuierlich an.
Erst 2000 zum fünfundsiebzigsten Rennen wurde die ursprüngliche Grenze von zwölf Stunden wieder ausgeschrieben. Eigentlich sollte es nur eine einmalige Aktion zum Jubiläum sein. Doch seit 2003 ist das Limit dauerhaft angehoben. Wer in der letzten Stunde ins Ziel kommt erhält allerdings nur eine kupferne, die nach dem Gründer benannte Vic-Clapham-Medaille.
Eine andere Medaillenstufe, die Bronzene mit einem Silberrand trägt den Namen des ersten Siegers Bill Rowan. Sie wird für Zeiten zwischen siebeneinhalb und neun Stunden vergeben. Das Ganze hat durchaus einen tieferen Sinn. Denn Rowans Zeit lautete ja 8:59. So hätte also jeder, der diese Medaille um den Hals trägt, mit dem Premierengewinner mithalten können.
Die dritte Person nach der eine Medaille benannt wurde, ist wie schon erwähnt, Wally Hayward. Es ist nach dem Gold für die ersten zehn auch die sportlich wertvollste Auszeichnung. Denn nur wer an den Top Ten vorbei schrammt, aber trotzdem unter sechs Stunden bleibt, erhält diese silberne Plakette mit Goldrand. Auch bei ihr hat das Zeitlimit einen Bezug zum Namensgeber. Hayward war nämlich der erste Läufer, der zwischen Pietermaritzburg und Durban unter jenen sechs Stunden blieb.
Nach zwanzigjähriger Pause trat der Sieger von 1930 im Alter von einundvierzig zum zweiten Mal zum Comrades Marathon an. Und er beendete das Rennen erneut auf dem ersten Platz. Auch der Down Run des Jahres 1951 sah Hayward auf dem obersten Treppchen. Dabei verbesserte er den 1937 von Johnny Coleman auf 6:23:11 gedrückten Rekord um volle neun Minuten auf 6:14:08 Stunden.
Bei der nächsten Auflage fehlte Hayward allerdings wieder. Denn er hatte sich entschieden, für Südafrika bei den Olympischen Spielen von Helsinki anzutreten. Gerade vierundvierzig Jahre alt geworden lief er dort in jenem Marathon, bei dem Emil Zatopek nach den Siegen über fünf- und zehntausend Meter seine dritte Goldmedaille innerhalb weniger Tage holte und damit endgültig zur Legende wurde, auf Rang zehn.
Doch 1953 war Wally Hayward erneut beim Comrades dabei und erzielte seinen zweiten Rekord. Denjenigen, der für den Namen der Medaille verantwortlich ist. Noch einmal mehr als zwanzig Minuten schneller als zwei Jahre zuvor rannte er von Pietermaritzburg nach Durban. Bei 5:52:30 blieb die Uhr des Zeitnehmers stehen.
Und auch bei der nächste Up-Variante pulverisierte der am Renntag bereits fast Sechsundvierzigjährige die alte Bestmarke mit 6:12:55 regelrecht. Hardy Ballington, der alte Rekordmann hatte auch da zwanzig Minuten mehr benötigt. Dass Hayward beim gleichen Lauf auch den Ehrenpreis für den ältesten Teilnehmer entgegen nehmen konnte, war eine zusätzliche Demütigung der Konkurrenz.
Eine Reise nach Großbritannien, bei der man ihm einen kleinen Spesenzuschuss gewährte, wurde zum Verhängnis des Rekordläufers und verhinderte weitere Siege. Denn die zu dieser Zeit rigorosen Amateurregeln verboten die Entgegennahme jeglicher finanzieller Zuwendungen. Hayward wurde vom südafrikanischen Verband zum Profi erklärt und für alle Veranstaltungen inklusive des Comrades gesperrt.
Aus heutiger Sicht, wo man ganz andere Summen gewohnt ist, absolut unverständlich. Auch beim Comrades Marathon werden schließlich üppige Prämien bezahlt. Doch damals ein vollkommen normaler Vorgang. Selbst der große Paavo Nurmi, mit neun olympischen Goldmedaillen noch immer erfolgreichster Langstreckenläufer aller Zeiten, wurde aus dem gleichen Grund von den Spielen 1932, bei denen er seine Karriere mit einem Sieg beim Marathon krönen wollte, ausgeschlossen.
Erst 1974 wurde Haywards Sperre für beendet erklärt. Tatsächlich kehrte er 1988 als inzwischen fast Achtzigjähriger noch einmal zum Comrades zurück. Ein weiteres Mal wurde er mit der Founders Trophy für den ältesten Teilnehmer geehrt. Und zeigte dennoch in 9:44:15 fast der Hälfte des Feldes erneut die Hacken. Auch im Jahr darauf, fast sechs Jahrzehnte nach seinem ersten Sieg, trat Wally Hayward an, hatte zwar deutlich mehr Mühe und kam nicht einmal zwei Minuten vor dem Zielschluss ins Ziel. Doch in höherem Alter hat weder vor noch nach ihm irgendjemand sonst eine Comrades-Medaille in Empfang nehmen dürfen.
Übertroffen wird das vielleicht nur noch durch den nur wenige Monate früher geborenen Johnny Kelley, dessen läuferische Karriere sich ziemlich genau über den gleichen Zeitraum erstreckt. Kelley stammte – man hätte es angesichts der ständig auftauchenden Vergleiche fast schon erwarten können – aus Boston.
Unglaubliche einundsechzig Mal startete er bei seinem Heimmarathon, kam achtundfünfzig Mal ins Ziel, siegte dabei zweimal – im Abstand von zehn Jahren – und wurde siebenmal Zweiter. Dass er die USA auch 1936 und 1948 – als Einundvierzigjähriger – bei Olympischen Spielen vertrat, sei nur noch am Rande erwähnt. Man muss schon wirklich eine Traditionsveranstaltung mit unglaublich langer Historie sein, um solche Geschichten produzieren zu können.
Mit so vielen Teilnahmen hätte Kelley – gäbe es ihn wie beim Comrades auch in Boston – natürlich kein Problem die grüne Nummer des Jubiläumsklubs zu erhalten. Denn wer zehn erfolgreiche Rennen absolviert hat, erhält für alle Zeiten eine feste Startnummer. Diese ist immer grün, was ein ziemlich nettes Wortspiel mit der doppelten Bedeutung des englischen „evergreen“ darstellt.
Längst erreicht die Zahl der vergebenen grünen Nummern praktisch die Größenordnung eines durchschnittlichen Starterfeldes, sind die Ziffernfolgen in fünfstellige Bereiche vorgestoßen. Ein weiterer Beleg für den absoluten Kultstatus, den der Comrades Marathon in Südafrika genießt. Um überhaupt als richtiger Läufer zu gelten, muss man sowieso einfach einmal den Comrades mitgemacht haben. Doch erst mit einer grünen Nummer hat man wirklich einen Ritterschlag erhalten. Die vier Läufer, die bereits vierzig oder mehr erfolgreiche Teilnahmen vorzeigen können, spielen dann noch einmal in einer anderen Liga.
Wer zum zehnten Mal antritt, ist schon am Start an einer gelben Startnummer zu erkennen. Direkt nach dem Zieleinlauf innerhalb des Zeitlimits wird diesen Jubilaren dann ihre lebenslange Nummer überreicht. Damit sind sie in den „exklusiven“ Club aufgenommen, der angesichts seiner Größe so exklusiv nun auch wieder nicht ist. Dass man sich die Mitgliedschaft allerdings hart und ehrlich erarbeiten muss, lässt sich dennoch kaum bestreiten.
Selbst wenn es bei einigen deutschen Marathons inzwischen ähnliche Sonderbehandlungen für Stammgäste gibt, in die Dimensionen des Green Number Clubs sind sie noch lange nicht vorgedrungen. Und ob sie es jemals tun werden, erscheint fraglich. Am ehesten vergleichbar in der Wertigkeit sind sowieso noch die Sondermedaillen, die man zum Beispiel für zehn oder zwanzig Teilnahmen in Biel bekommt und die in den Sammlungen etlicher alter Haudegen einen Ehrenplatz einnehmen.
Die Fünfziger brachten nicht nur dem Comrades die Ära von Wally Hayward sondern Südafrika auch politische Umbrüche. Denn in den Wahlen von 1948 hatte erstmals die fundamentalistische Nationalpartei gesiegt, mit deren Regentschaft die bisher eher unterschwellig vorhandene Rassentrennung instrumentalisiert wurde und im System der Apartheid endete. Auch vom britischen Mutterland entfernte man sich nicht zuletzt aufgrund dieser Politik immer mehr.
Ein beim Comrades sichtbares Zeichen dieser Veränderung war die Verschiebung des Lauftermins vom Empire Day am 24. Mai auf den 31. Mai, den Jahrestag des Friedens von Vereeniging. Mit diesem Abkommen wurde 1902 der sogenannte Burenkrieg zwischen dem britischen Königreich und den unabhängigen Republiken Oranje-Freistaat und Transvaal beendet. Zusammen mit der Kapkolonie und der Provinz Natal entstand damals die Südafrikanische Union.
Nachdem das Land hauptsächlich wegen der Kritik an seiner Apartheidspolitik das Commonwealth verlassen und die Republik Südafrika ausgerufen hatte, wurde der 31. Mai zum „Republic Day“ erklärt. Und fast vier Jahrzehnte war dieser Feiertag von nun an der klassische Termin für den Comrades. Abgesehen von den Ausnahmen, an denen der letzte Tag im Mai auf einen Sonntag fiel und der Feiertag nach bester angelsächsischer Manier deshalb auf den folgenden Montag verschoben wurde, das Rennen also am 1. Juni stattfand.
Übrigens – auch auf die Gefahr hin, dass es langsam langweilig wird oder gar nervt – trägt man auch den Boston Marathon traditionell an einem Feiertag aus. Nämlich am Patriots Day, der in den USA bis in die Sechziger – einmal abgesehen von der auch dort gültigen Sonntag-Montag-Regelung – stets am 19. April begangen wurde und seitdem immer am dritten Montag im April im Kalender steht.
Doch schon bevor die Apartheidspolitik zur Staatsdoktrin erhoben wurde, gab es beim Comrades die Rassentrennung. Schwarze Läufer waren offiziell nicht zugelassen. Für sie wurde mit dem Suncrush Marathon sogar einige Jahre lang eine eigene ähnliche Veranstaltung organisiert. Doch genau wie bei den Frauen gab es auch hier Läufer, die sich darüber hinwegsetzten und dann eben ohne Startnummer beim Original antraten.
Robert Mtshali, für den 1935 eine Zeit von 9:30 notiert wurde, war der Erste von ihnen. Andere wie Zwelitsha Gono oder Simon Mkhize, die anfangs gleich mehrfach ohne offizielle Anerkennung liefen, haben inzwischen allerdings längst ebenfalls ihre grüne Startnummer und können auf dreiundreißig (Gono) und zwanzig (Mkhize) erfolgreiche Teilnahmen zurück blicken.
Rückwirkend wurden ihnen dabei zwar – als später Akt der Gerechtigkeit – auch ihre ersten inoffiziellen Starts anerkannt. Und es gibt durchaus auch anrührende Geschichten von Läufern, die ihre mühsam erarbeiteten Medaillen an ihre nicht damit ausgezeichneten Begleiter anderer Hautfarbe weitergaben. Doch erst 1975 – andererseits allerdings auch fast zwanzig Jahre vor dem endgültigen Ende der Apartheid – erhielten schwarze, farbige und asiatische Läufer endlich die Zulassung zum Comrades.
Noch etwas anderes begann sich in den späten Fünfzigern und frühen Sechzigern langsam zu ändern. Denn gerade durch das Medieninteresse, das insbesondere die Rennen von Wally Hayward hervorgerufen hatten, stiegen die Meldungen an und übertrafen bald regelmäßig die Marke von einhundert. Und auch die Zahlen für die im Ziel ausgegebenen Medaillen wuchsen innerhalb weniger Jahre deutlich und näherten sich bald ebenfalls der Dreistelligkeit.
Zum Nachfolger von Wally Hayward, der zwar keine zehn Rennen absolviert hatte, wegen seiner fünf Siege allerdings bei seinen letzten beiden Läufen dennoch die grüne Nummer mit der „2“ – die „1“ gehört Clive Crawley, der zwischen 1957 und 2000 insgesamt zweiundvierzig Comrades Marathons beendete – tragen durfte, in dieser Periode wurde Jackie Mekler. Und wie der gute zwanzig Jahre ältere Hayward startete er für die Germiston Callies Harriers.
1951 und 1953 bei den Erfolgen seines Vereinskameraden noch Siebter und Fünfter – wie sich in den praktisch lückenlos im Internet abrufbaren Ergebnislisten des Rennens nachvollziehen lässt – begann er seine Serie 1958 mit einem Sieg. Bis 1969 folgten vier weitere erste, zwei zweite und zwei dritte Plätze. 1963 verbesserte er dabei auch den Down-Rekord auf 5:51:20. Und schon drei Jahre zuvor hatte er in der Gegenrichtung mit 5:56:32 die Bestmarke unter sechs Stunden gedrückt.
Den ersten Lauf bei dem mit 109 Läufern eine dreistellige Zahl von Teilnehmer – rechtzeitig – ins Ziel kam und mit zweihundert auch ein neuer Starterrekord aufgestellt wurde, gewann er allerdings nicht, sondern wurde „nur“ Zweiter. Die oberste Treppchenstufe bestieg 1962 nämlich mit John Smith zum ersten Mal ein Ausländer. Ein englisches Team war beim Comrades angetreten und hatte bis auf Mekler, der seinen Up-Rekord bei einer Siegerzeit von 5:57:05 nur ganz knapp behielt, alle Einheimischen alt aussehen lassen. Vier der ersten fünf Plätze gingen an die Briten.
Bis allerdings der wegen der Rassentrennungspolitik ausgerufene Sportboykott das Land endgültig isolierte, konnten nur zwei weitere nicht aus Südafrika stammende Läufer den Comrades gewinnen. Beide ebenfalls aus dem Vereinigten Königreich. Im Jahr 1965 war es Bernard Gomersall, der Meklers Bestzeit beim Down Run um elf Sekunden unterbot. Und 1972 erzielte Mick Orton mit 5:48:57 ebenfalls eine neue Bestmarke.
Dass es bei Gomersalls Sieg im eigentlich um diese Jahreszeit recht trockenen Natal den ganzen Tag über ununterbrochen regnete, war für den Briten sicher kein Nachteil. Während die südafrikanischen Läufer über die unangenehmen, nassen und kalten Bedingungen bei einem der wenigen völlig verregneten Comrades Marathons klagten, sprach der von zu Hause ähnliches gewohnte Sieger von „perfect weather“. Alles hat eben zwei Seiten und ist nur eine Frage des Blickwinkels.
Auch Mekler, der nach seinem Rücktritt vom Rücktritt 1968 erneut gewinnen konnte, schaffte es nicht einen sechsten Comrades-Sieg heraus zu laufen. Bei seinem endgültig letzten Start im Jahr darauf kam er als Dritter an. Es blieb bei fünf Erfolgen. Damit stand er zwar auf einer Stufe mit Arthur Newton, Hardy Ballington und Wally Hayward. Übertreffen konnte er sie aber nicht.
Waren es beim ersten Sieg von Jackie Mekler – übrigens die immergrüne Nummer „9“ - gerade einmal 34 Läufer, die im Ziel eine Medaille ausgehändigt bekamen, wurden zehn Jahre später bei seinem letzten Erfolg schon 435 gezählt. Und bei der nächsten Austragung wurden noch einmal über hundertfünfzig Zieleinläufe mehr registriert. Und sogar fast achthundert Meldungen waren eingegangen.
Ausgerechnet dieses fast explosionsartige Wachstum brachte den Comrades allerdings fast zu Fall. Denn die Verkehrsbehörden taten sich immer schwerer mit der Genehmigung. Schließlich wurde der Lauf auf einer nicht gesperrten und auch kaum völlig zu sperrenden Straße absolviert. Die Behinderungen waren deshalb auf einer so langen Distanz schon beträchtlich.
Auf das drohende Aus reagierten die Organisatoren mit der Einführung von sogenannten „cut off points“ auf der Strecke, an denen Läufer schon vorzeitig aus dem Rennen genommen werden konnten, wenn sie keine Chance mehr auf das Zeitlimit hatten. Und sie schränkten das sogenannte „seconding“, also die Betreuung der Läufer durch Helfer in mitfahrenden Autos drastisch ein. Dafür allerdings wurde die Zahl der Verpflegungsstellen deutlich erhöht und erreichte fast schon die heutige Dichte.
Doch vor allem stellte man irgendwann auch bei den amtlichen Stellen fest, dass kaum jemand der vom Rennen gestörten Autofahrer wirklich verärgert reagierte. Ganz im Gegenteil, die meisten jubelten den Läufern zu. Der Comrades war nach fast fünf Jahrzehnten längst so sehr akzeptiert und in der Bevölkerung verwurzelt, dass es sogar schwer sein würde, ein Verbot überhaupt zu begründen.
Und noch war kein Ende der Begeisterung abzusehen. Schon 1973 wurde die Tausendermarke durchbrochen. Am Ende der Dekade kratzte man bereits an den dreitausend. Ein Jahr darauf wurden sogar viertausend Zieleinläufe nur knapp verpasst. Zum Vergleich sei erwähnt, dass der größte Marathon Anfang und Mitte der Siebziger in Bräunlingen im Schwarzwald stattfand und zwischen tausend und zweitausend Läufer zählte.
In New York, wo der Marathon dann bis zum Ende des Jahrzehnts allerdings schon fünfstellig war, wagte man sich erst 1976 mit gerade einmal fünfzehnhundert Teilnehmern aus dem Central Park hinaus in die Stadt. Das Bieler Feld hatte, was man am Rande durchaus einmal anmerken kann, im gleichen Jahr dagegen fast die doppelte Größe wie das im Big Apple.
Und – der Vergleich ist natürlich fällig – das Pendant in Boston nahm während des ersten großen Laufbooms eine fast identische Entwicklung wie der Comrades. Von gut achtzig 1960 im Ziel angekommenen Marathonis stiegen die Werte innerhalb von knapp zwanzig Jahren bis 1979 auf fast sechstausend an. Aus Rennen für ein paar Leistungssportler und „Verrückte“ waren innerhalb kürzester Zeit Massenveranstaltungen geworden.
Ein Rennen dieser Dimension konnte man nun eigentlich nicht mehr absagen. Zumal Südafrika sportpolitisch völlig isoliert im eigenen Saft schmorte. Von den Olympischen Spielen war man inzwischen ausgeschlossen. Selbst internationale Spiele in der Lieblingsportart der Buren, dem Rugby, fanden nicht mehr statt. Später äußerte Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu einmal, der Sportboykott sei eines der wirksamsten Druckmittel gegen die Rassentrennungspolitik gewesen.
Dem Comrades Marathon kam dies jedoch eher zugute. Denn man war ja regelrecht auf der Suche nach herausragenden Ereignissen und Athleten. Nahtlos übernahm als Erster Dave Bagshaw diesen Staffelstab von Jackie Mekler. Denn er war es, der bei dessen letzten Comrades Marathon das Rennen gewann. Und zwar in einem neuen Down-Rekord von 5:45:35. Auch die nächsten beiden Läufe gingen an Bagshaw, dem damit erst der zweite Hat-Trick nach Arthur Newton gelang, der allerdings sogar viermal hintereinander erfolgreich war.
Von Bagshaw erzählt man sich eine nette Anekdote, die sich nach seinem ersten Sieg angeblich während eines Besuches bei einem Schneider zugetragen hat. Beim Vermessen für einen neuen Anzug hätte der Handwerker nämlich festgestellt: „Mensch, sind Sie dünn. Sie hätten beim Marathon mitlaufen sollen.“ „Hab ich“, soll Bagshaw trocken geantwortet haben. „Tatsächlich? Und sind Sie angekommen?“ – „Ja, bin ich“ – „Wirklich? Was hatten Sie denn für eine Zeit?“ – „Fünf-fünfundvierzig“ – „Dann müssen Sie das Ding ja gewonnen haben?“ – „Hab ich“. Die zum Anzug passende Krawatte musste er nach diesem Dialog nicht mehr bezahlen.
Mit den steigenden Teilnehmerzahlen wurde auch der Wunsch nach geeigneten Vorbereitungsläufen größer. Im Jahr 1970 entstand deshalb in Kapstadt ein Lauf, der sich inzwischen zur Nummer zwei im Land und in der gesamten Ultrawelt entwickelt hat, der Two Oceans Marathon. Genau wie beim Comrades geht man dabei mit dem Begriff „Marathon“ ziemlich großzügig um.
Und zwar keineswegs im Hinblick auf eine Verwässerung, die man hierzulande in den letzten Jahren immer öfter beobachten kann, wenn auch Starter über nur halb oder ein Drittel so lange Distanzen gleich zu „Marathonläufern“ gemacht werden. Der Two Oceans ist mit seinen sechsundfünfzig Kilometern eben auch ein – wenn auch etwas kürzerer – Ultralauf.
Die auf den ersten Blick etwas seltsame Streckenlänge lässt sich dabei gleich doppelt begründen. Denn zum einen sind das umgerechnet fünfunddreißig englische Meilen. Schließlich war bei der ersten Auflage das metrische System in Südafrika noch nicht eingeführt und man rechnete noch in den alten „imperialen“ britischen Einheiten.
Zum anderen entsprechen die knapp neunzig Kilometer des Comrades Marathons eben auch ziemlich genau sechsundfünfzig Meilen. Angesichts der Zahlengleichheit könnte man – zumindest mit der angelsächsischen Brille auf der Nase – den Two Oceans deshalb durchaus als so etwas wie den „metrischen Comrades“ betrachten.
Der Erste, dem es gelang, in einem Jahr beide großen Ultraläufe zu gewinnen, war 1974 Derek Preiss. Und er ist auch der bisher einzige Mann, der dieses Kunststück vollbrachte. Bei den Frauen waren in späteren Jahren noch Frith van der Merwe und die Russin Elena Nurgalyeva doppelt erfolgreich. Allerdings glückte Preiss das Ganze im Jahr darauf gleich noch einmal. Und gerade sein zweiter Comrades Sieg hatte eine besondere Bedeutung.
Denn 1975, als man in New York den gerade erst ins Leben gerufenen Marathon noch mit gut dreihundert Läufern auf einem Rundkurs im Park absolvierte, beging man in Natal schon das fünfzigste Jubiläum des Comrades. Eigentlich wäre wie immer in einem ungeraden Jahr wieder ein Down Run fällig gewesen. Doch weil das Rennen eben eher mit Pietermaritzburg als mit der Metropole Durban verbunden war, entschied man sich erneut bergauf zu laufen, um das Ziel am Sitz der Organisation zu haben.
Der Druck – unter anderem von vielen Presseorganen – war inzwischen so stark geworden, dass die Verantwortlichen nicht mehr um die Zulassung von Frauen und – was einigen von ihnen wohl viel schwerer fiel – Schwarzen herum kamen. Als erster unter ihnen erhielt Vincent Rakabele auf Gesamtrang zwanzig die begehrte Medaille.
Die Öffnung des Rennens führte aufgrund der damals gültigen gesetzlichen Regelungen allerdings auch zu zusätzlichen logistischen Anstrengungen. Denn von nun an mussten zum Beispiel verschiedene Umkleideräume und Toiletten bereitgestellt werden. Und zwar nicht nur getrennt nach Geschlechtern, wie man es als selbstverständlich betrachten würde, sondern auch getrennt nach Hautfarben.
Nachdem er im Jahr darauf den Two Oceans gewonnen hatte, zählte der ursprünglich aus Lesotho, einem vollständig von Südafrika umgebenen kleinen Nachbarstaat, stammende Rakabele sogar zu den Favoriten für die einundfünfzigste Austragung, die nun wieder ein Down Run war. Doch weder er – dessen beste Platzierung schließlich 1977 ein vierter Platz wurde – noch Titelverteidiger Preiss standen schließlich ganz oben, sondern Alan Robb.
Nach einem dritten und einem fünften Platz in den beiden Vorjahren siegte er in 5:40:53 und verpasste den 1973 von Dave Levick auf 5:39:09 gedrückten Rekord nur knapp. Hauptsächlich deswegen, weil die Strecke verglichen mit Levicks Lauf rund zwei Kilometer länger war. Aber auch, da er sich schon klar in Führung liegend in Durban an einem Abzweig verlaufen hatte.
Robb, wie Hayward und Mekler für die Germiston Callies Harriers aus dem Nähe von Johannesburg startend, holte sich diese Bestmarke zwei Jahre später, als er bei seinem dritten Sieg hintereinander 5:29:14 und damit als Erster unter fünfeinhalb Stunden lief. Die andere, die für den Up Run, nannte er da schon 365 Tage sein Eigen. Den zweiten Erfolg hatte er nämlich in 5:47:09 heraus gelaufen. Weibliches Gegenstück – nun endlich auch offiziell – war Lettie van Zyl, der parallel zu Robb ebenfalls drei Siege nacheinander gelangen.
Ein Jahr später war Robb den Rekord aber schon wieder los, denn Piet Vorster benötigte nur 5:45:02 für den Weg von Durban nach Pietermaritzburg. Favorit Alan Robb wurde in einem spannenden, beinahe dramatischen Rennen überraschend nur Fünfter. Denn lange hatte Comrades-Neuling Johnny Halberstadt an der Spitze ein irres Tempo vorgelegt, einen großen Vorsprung herausgelaufen und die Halbzeitmarke in Drummond, wo man neben fünfundvierzig Kilometern auch bereits sechshundert Höhenmeter hinter sich hat, mit 2:45 so schnell passiert, wie nie jemand zuvor.
Doch hatte er dabei selbstverständlich überzogen. Und das sprichwörtliche „Hochmut kommt vor dem Fall“ fand fast eine bildliche Entsprechung, als er in der Nähe des höchsten Punktes etwa zwanzig Kilometer vor dem Ziel erst gehen und sich schließlich sogar entkräftet hinlegen musste. Vom Streckenrand blieb ihm nichts anderes übrig, als hilflos zuzusehen wie Vorster vorbei zog. Doch berappelte sich Halberstadt noch einmal, begann wieder zu laufen und wurde fünf Minuten hinter dem Sieger tatsächlich noch Zweiter. Ein Platz, auf den er auch zwei Jahre später noch einmal kam.
Der erste Comrades Marathon in den Achtzigern ging allerdings wieder an Alan Robb, der damit endgültig zum nächsten Anwärter für einen Ehrenplatz in der Riege der Fünffachsieger geworden zu sein schien. Dass Robb diesen am Ende nicht bekam, lag an jenem Mittzwanziger, der im Rennen von 1980 zwei Minuten hinter ihm als Zweiter ins Ziel lief und in den Folgejahren trotz aller Newtons, Ballingtons, Haywards und Meklers zu dem absoluten Superstar des Comrades werden sollte. Sein Name ist Bruce Fordyce.
Auch die inzwischen nahezu umfassende Fernsehberichterstattung über das Rennen trug dazu bei ihn in der ganzen Nation bekannt und fast schon zu einer lebenden Legende zu machen. Denn längst wurde der Comrades vom Start bis zum Zielschluss in voller Länge live übertragen. Viele Millionen Südafrikaner verfolgten die Veranstaltung jedes Jahr an den Bildschirmen. Und praktisch landesweit war es üblich, den Republic Day, was immer man auch sonst tat, auf jeden Fall mit laufendem Fernseher zu verbringen.
Doch vor allen Dingen sind eben die neun Siege, davon acht in ununterbrochene Reihenfolge und fünf mit neuen Streckenrekorden, von Fordyce unübertroffen und werden aller Wahrscheinlichkeit nach auch kaum jemals in Gefahr geraten, noch überboten zu werden. Und seine Bestmarken, die am Ende der zehnjährigen Regentschaft von „König Bruce“ bei 5:27:42 für den Up und 5:24:07 für den Down Run standen, hielten zehn bzw. sogar dreiundzwanzig Jahre.
Eine Parallele, diesmal wieder aus dem Radsport, drängt sich fast auf. Auch bei der Tour de France gab es mit Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain vier Fünffachsieger, bevor mit dem siebenmal erfolgreichen Lance Armstrong jemand diese Marke durchbrechen konnte. Doch ganz im Gegensatz zum ziemlich umstrittenen Texaner gilt Bruce Fordyce als untadeliger Sportsmann.
Bei seinem ersten Sieg 1981 trug er zum Beispiel ein schwarzes Armband, um gegen die Feierlichkeiten zum zwanzigsten Jahrestag des Republic Day und damit des Apartheidstaates zu protestieren. Das verschaffte ihm zwar die Anfeindungen einiger burischer Sturköpfe, aber auch den Jubel der schwarzen Zuschauer an der inzwischen vollkommen autofreien Strecke. Mit 5:37:28 unterbot der in Hongkong geborene und erst als Jugendlicher nach Südafrika gekommene Fordyce dabei Vorsters bisherige Bestzeit um fast acht Minuten.
Den nächsten Erfolg beim Down Run 1982 musste er sich in einem harten Duell gegen Alan Robb erkämpfen. Nachdem sie ihre letzten Begleiter abgeschüttelt hatten, liefen beide kilometerlang Brust an Brust und trieben sich dabei zu einer immer höheren Geschwindigkeit. Am Fields Hill, dem vorletzten Hügel, konnte Robb dann allerdings der erneuten Tempoverschärfung nicht mehr folgen und musste abreißen lassen.
Entgegen einer ersten oberflächlichen Interpretation der Begriffes Down Run führt auch die Comrades-Variante von Pietermaritzburg nach Durban keineswegs nur bergab. Vom Start zum höchsten Punkt gilt es erst einmal zweihundert Meter zu klettern, bevor man erst auf dem letzten Streckendrittel dann wirklich an Höhe verliert. Doch weder An- noch Abstieg verlaufen absolut stetig. Immer wieder stellen sich kleine Hügel in den Weg, von denen fünf einen ganz besonderen Ruf haben.
Wie das einst von Großwildjägern definierten Tierquintett Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard, das in Südafrika heutzutage eher mit den Kameras der Touristen gejagt wird, nennt man sie auch „Big Five“. Praktisch jeder südafrikanische Läufer kann sie ohne Probleme aufzählen. Von Pietermaritzburg aus gesehen lautet die richtige Reihenfolge Polly Shortts, Inchanga, Botha’s Hill, Fields Hill und Cowie’s Hill.
Wobei gerade die letzten beiden, die sich beim Down Run in den langen Bergabpassagen hinunter nach Durban als Rhythmusbrecher in den Weg stellen, den zweiten Beinamen „Notorious Five“, also ungefähr „die berüchtigten Fünf“ begründen. Umgekehrt fallen die Entscheidungen – der inzwischen fast schon unvermeidbare Vergleich mit Boston fördert übrigens dort an ähnlicher Position den ebenso legendären Heartbreak Hill zu Tage – im Up Run oft an der nur rund zehn Kilometer vor dem Ziel liegenden Steigung von Polly Shortts.
Alan Robb, der den Kontakt zu Fordyce endgültig verloren hatte, fiel bald darauf auf Rang vier zurück. Allerdings konnte er sich noch einmal ins Rennen zurück kämpfen und am Ende doch wieder auf den zweiten Platz vorarbeiten. Weiter nach vorne kam er nicht mehr. Aber zwischen 1974 und 1991 lief er beindruckende sechzehn Mal in die Top Ten. Seit seinem Debüt hat er bis heute noch jeden Comrades beendet und steht deshalb mit insgesamt sechsunddreißig Medaillen in den Rekordbüchern.
Auch für 2010 hat er natürlich wieder gemeldet. Und nachdem er mit Jahrgang 1953 erst Mitte Fünfzig ist und im vergangenen Jahr noch immer knapp über acht Stunden lief, ist ein Ende der Serie nicht abzusehen. Sollte er so weitermachen könnte er tatsächlich irgendwann in die Dimensionen eines Johnny Kelley vorstoßen, was beim Comrades sportlich fast noch einen höheren Stellenwert haben dürfte.
Einer der größten Konkurrenten von Bruce Fordyce in den Achtzigern war Hoseah Tjale, dem es als ersten schwarzen Läufer gelang, beim Comrades aufs Treppchen zu kommen. Zwei zweite, zwei dritte und zwei vierte Plätze stehen für ihn zu Buche, insgesamt neun Goldmedaillen holte er sich. Doch wer darauf gesetzt hatte, ihn auch als ersten Sieger schwarzer Hautfarbe feiern zu können, sah sich getäuscht.
Nachdem der jährliche Wechsel der Laufrichtung 1988 zum zweiten Mal durchbrochen wurde, um die Gründung von Pietermaritzburg hundertfünfzig Jahre zuvor mit dem Zieleinlauf in der Stadt entsprechend zu begehen und Fordyce seinen achten Sieg in Serie feiern konnte, entschied er sich auf den nächsten Lauf zu verzichten. Hoseah Tjale wurde auf den Favoritenschild gehoben.
Doch mit der Meldung von Willie Mtolo, einem 2:08-Marathoner, der drei Jahre später dann in New York siegreich sein sollte, wurde die Rollen neu verteilt. Am Ende war es keiner von beiden, der nach 5:35:51 in Durban den Ruhm für sich beanspruchen durfte, sondern als lachender Dritter Sam Tshabalala, mit dem im Vorfeld des Rennens praktisch niemand gerechnet hatte. Mtolo lief immerhin auf Rang zwei, Tjale wurde dagegen ziemlich enttäuscht nur Zehnter.
Auch bei den Frauen gab es eine Premiere, denn mit Frith van der Merwe blieb eine Frau unter sechs Stunden. Wie stark diese Leistung war, zeigt die Tatsache, dass gerade einmal vierzehn Männer an diesem Tag schneller als die auch 1991 bergab noch einmal siegreiche van der Merwe liefen. Noch immer steht ihr Rekord von 5:54:43 als Bestmarke. Und nur zwei weiteren Siegerinnen gelang es seitdem überhaupt noch mit einer fünf als erster Ziffer einzulaufen. Ihre Up-Zeit von 6:32:56 von 1988 konnte ebenfalls immerhin acht Jahre lang nicht unterboten werden.
Mit 10.507 Zieleinläufen wurde zum zweiten Mal nach den 10.363 aus dem Vorjahr auch die Zehntausendergrenze geknackt. Um einmal die Dimensionen aufzuzeigen, soll nicht unerwähnt bleiben, dass mit New York, London, Berlin und Los Angeles gerade vier Marathons im gleichen Jahr mehr Teilnehmer registrieren konnten als der über doppelt so lange Ultra im Süden Afrikas. Nur noch dreimal wurde die Fünfstelligkeit beim Comrades seitdem verfehlt.
Dessen fünfundsechzigste Auflage, die den neunten Fordyce-Sieg – wieder vor Hoseah Tjale – brachte, fand auf einmal unter einem ganz anderen Stern statt. Denn nach langem internationalem Druck hatte die Regierung von Frederik Willem de Klerk wenige Monate zuvor Nelson Mandela aus seiner jahrzehntelangen Haft entlassen. Und dieser hatte zur Versöhnung und zur Schaffung eines vereinten, demokratischen Südafrika aufgerufen. In die festgefahrenen Verhältnisse der Republik am Kap war plötzlich Bewegung gekommen. Die Zeit der politischen und sportlichen Isolation neigte sich dem Ende zu.
Und auch die Ära Fordyce endete. Denn ein Jahr darauf versuchte der Läufer, der eine komplette Dekade des Comrades dominiert hatte und inzwischen fast als unschlagbar galt, noch einmal das Rennen für sich zu entscheiden und mit seinem zehnten Sieg endgültig Sportgeschichte zu schreiben. Doch diesmal lief es anders.
Schon zur Halbzeitmarke bei Drummond war er mit einem Rückstand von sieben Minuten auf die enteilte Spitze ausgestattet. Dass Fordyce nicht führte, war zwar nicht ungewöhnlich. Viele seiner Siege hatte er schließlich erst im letzten Streckenteil entschieden, als die ungeduldig vorneweg laufenden Heißsporne Lehrgeld bezahlten, einbrachen und von ihm eingesammelt wurden.
Der Abstand war allerdings schon ziemlich groß. Und dass er nicht kleiner wurde sondern sich in der Folge noch vergrößerte, ließ bei Zuschauern und Kommentatoren die Warnlampen angehen. Wenig später fiel Fordyce aus seiner Gruppe zurück, blieb irgendwann stehen und gab noch während des Wettkampfes ein Interview. „Es ist vorbei“, war die prägnante Aussage, „es ist nicht mein Tag“. Zusammen mit einem Freund, auf den er dann wartete, beendete der abgesetzte König den Lauf auf Rang 328.
Der neue Herrscher war Nick Bester, der sich von seinem Fluchtgefährten Shaun Meiklejohn lösen konnte und einen denkwürdigen Wettkampf in 5:40:53 gewann. Meiklejohn musste noch vier Jahre auf seinen Comrades Sieg warten. Aber 1995 stand auch er nach 5:40:53 ganz oben auf dem Treppchen.
Auch Fordyce lief wie Alan Robb weiter beim Comrades und war sich nicht zu schade auch Zeiten von zuletzt neun oder zehn Stunden ins Ziel zu bringen. Ein Zacken ist ihm deshalb nicht aus der Krone gebrochen. Ganz im Gegenteil, sie sitzt dadurch nur umso fester. Fordyce hat inzwischen ebenfalls immerhin siebenundzwanzig Medaillen angesammelt. Und auch er ist für den Lauf 2010 wieder gemeldet.
Alleine die Tatsache, dass frühere Sieger Jahr für Jahr zurück kehren und sich mitten im Feld über die gewiss nicht leichte und kurze Strecke begeben, zeigt deutlich welchen Wert der Comrades Marathon in Südafrika hat. Und wohl auch welcher ganz besondere Geist bei diesem Rennen herrscht. Kaum eine andere Großveranstaltung aus der Welt des Laufens – sieht man einmal von Boston und Johnny Kelley ab – kann ähnliches vorzeigen.
Mit Jetman Msutu geht 1992 in den Chroniken des Comrades dann auch die lange Reihe von fast ununterbrochenen südafrikanischen Siegen in Folge zu Ende. Die mit der Abschaffung der Rassentrennung verbundene Öffnung des Landes sorgte dafür, dass seitdem die Siegerlisten bezüglich der Nationalitäten wesentlich abwechslungsreicher wurden. Den Organisatoren gelang es innerhalb weniger Jahre, aus einem rein nationalen Ereignis eine Veranstaltung zu machen, die viele der besten Ultraläufer der Welt anzog.
Doch nicht nur deshalb ist der Erfolg von Msutu ungewöhnlich. Denn er war keineswegs als Erster in das Stadion eingelaufen – traditionell enden praktisch alle südafrikanischen Rennen auf einem Sportplatz, der Comrades natürlich auch – und erhielt ihn erst sechs Wochen später zuerkannt. Der vier Minuten vor Msutu ankommende Charl Mattheus wurde aufgrund einer positiven Dopingprobe disqualifiziert. Eine der unrühmlichsten Episoden in der ruhmreichen Historie der Veranstaltung.
Die Verwendung des in einem Erkältungsmittel enthaltenen Wirkstoffes Pseudoephedrin wurde ihm vorgeworfen. Wilde Debatten zwischen Befürwortern und Gegnern des Ausschlusses – Mattheus hatte die Einnahme des Medikamentes schon vor dem Rennen angegeben – folgten und endeten erst nachdem der vermeintliche Sieger von 1992 den Comrades fünf Jahre später erneut gewann und seinen Titel diesmal auch nach dem Dopingtest behalten durfte.
Und woher kam denn nun der erste Sieger des traditionsreichen Rennens, der nicht im früheren britischen Imperium geboren worden war? Nun er kam – nur wenige werden sich auch hierzulande noch daran erinnern – aus dem Schwarzwald. Sein Name ist nämlich Charly Doll.
Der neben einigen anderen Europäern von den Veranstaltern zum ersten großen Sportereignis mit ausländischer Beteiligung nach dem offiziellen Ende der Sanktionen eingeladene Deutsche setzte sich bei seinem Down Run schon bei Halbzeit an die Spitze des Feldes. Und nur Theophilus Rafiri setzte von den Einheimischen nach, lief vorbei und baute seinerseits nun einen deutlichen Vorsprung auf.
Am Cowie’s Hill, dem letzten der Big Five, war der müder werdende Südafrikaner aber von Doll wieder gestellt. Bald darauf löste sich der Schwarzwälder endgültig von Rafiri, der am Ende noch Mühe hatte, seinen zweiten Platz über die Linie zu retten, und wurde nach 5:39:41 im Ziel in Durban gestoppt.
Bei den Damen blieb der Sieg durch Tilda Tearle noch einmal in Südafrika, doch schon im Jahr darauf wurde mit Valentina Lyakhova eine Frau aus jenem Land geehrt, dessen Läufer in der Folge den Comrades Marathon mitbestimmen sollten. Über die Hälfte der Gewinnerinnen und ein Drittel der Gewinner würden seitdem aus Russland kommen. Dazu kommen noch ein Pole und ein sogar dreimal erfolgreicher Belorusse.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass viele der osteuropäischen Topläufer, die durch die immer größer werdende afrikanische Dominanz von den Prämien-Fleischtöpfen der Marathons ihres Heimatkontinents ferngehalten wurden, ausgerechnet in den Ultras im Süden Afrikas einen halbwegs adäquaten Ersatz fanden. Seit 1995 kam nämlich auch der Comrades Marathon nicht mehr umhin, ganz offen Preisgelder auszuschreiben.
Lyakhovas männliches Gegenstück im Jahr 1994 ist der – zumindest außerhalb Südafrikas – vielleicht größte Name in der langen Geschichte des Comrades. Denn mit Alberto Salazar, dem in Kuba geborenen Amerikaner, gab ein früherer Boston und dreifacher New York Marathon Sieger, der Veranstaltung die Ehre. Zwar war dessen beste Zeit bereit ein Jahrzehnt vorbei und auch sein Ausrüster hatte bei der Meldung die Hände maßgeblich im Spiel.
Doch Salazar – mit fünfunddreißig eigentlich noch im besten Langstreckenalter – setzte die Erwartungen um und siegte in 5:38:39 fast mit Ansage. Nur Bruce Fordyce hatte bisher bei seinen Up-Siegen den Weg von Durban nach Pietermaritzburg schneller zurück gelegt. Das aber gleich bei allen fünf. Es blieb trotz erneuter Meldung für den nächsten Comrades allerdings der einzige Ausflug von Salazar auf die Ultrastrecke.
Das Folgejahr sah wieder einen deutschen Erfolg, nämlich den von Maria Bak. Nicht nur 1995 sondern auch 2000 und 2002 stand sie beim südafrikanischen Traditionslauf ganz oben. Zwei zweite Plätze hinter der 1996 und 1997 siegreichen Amerikanerin Ann Trason und insgesamt elf Goldmedaillen für Platzierungen unter den ersten Zehn vervollständigen die Erfolgsbilanz. Aber der scheinbare Stern am deutschen Ultrahimmel hat sich nach einer zweijährigen Dopingsperre Ende der Neunziger eben doch ziemlich verdunkelt.
Wie für ihren Landsmann Salazar war auch für Ann Trason der Comrades Marathon eine eher ungewohnte Distanz. Doch war dieser aus ihrer Sicht eher zu kurz. Schließlich dominierte sie in jenen Jahren die in den USA recht populären Läufe über einhundert Meilen fast nach Belieben. Gleich vierzehn Mal gelang es ihr zum Beispiel, den Western States 100 zu gewinnen, in zwei Fällen sogar jeweils nur zwei Wochen nach ihren Comrades-Erfolgen.
Während in der Down-Variante Frith van der Merwes 5:54:43 von 1989 auch zwanzig Jahre später noch immer Bestand haben, wurde sie den Up-Rekord bei Trasons erstem Sieg an die Amerikanerin los. Bei 6:13:23 stand nun die neue Bestmarke. Doch auch 1997 blieb der Rekord zumindest nicht völlig außer Reichweite. Trasons 5:58:24 sind jedenfalls die zweitbeste Bergabzeit bei den Damen.
Ein Jahr später 1998 entführte der Russe Dmitri Grischin bei seinem zweiten Sieg – beim ersten wird er übrigens noch als Ukrainer geführt – mit 5:26:25 auch den anderen Rekord im Up Run ins Ausland. Doch wenigstens blieb der Sieg bei den Frauen durch Rae Bisschoff noch einmal im Land. Zum letzten Mal, denn seitdem wurden nur noch Deutsche und Russinnen als Erste notiert.
Eine davon ist Birgit Lennartz, die sich 1999 mit 6:31:03 in die Siegerlisten eintragen konnte. Damit ist die Rheinländerin die Einzige, der es gelang, sowohl den südafrikanischen wie auch den mitteleuropäischen Ultraklassiker in Biel – dort immerhin siebenmal – zu gewinnen. Dass dazu auch noch etliche Siege auf dem Rennsteig und in Davos kommen, lässt ihre Erfolgsliste noch deutlich eindrucksvoller aussehen.
Auch der Männer-Gewinner jenes Jahres ist aufgrund etlicher Siege in Deutschland bekannt. Der Pole Jaroslaw Janicki taucht bei vielen der mittelgroßen Marathons im Land mit schöner Regelmäßigkeit in den vorderen Platzierungen auf. Doch natürlich dürfte auch er den Comrades als seinen wertvollsten Erfolg bezeichnen. Fünfmal lief Janicki, der inzwischen auch Stammgast – seine „permanent number“ ist 4889 – in Natal ist, insgesamt unter die ersten Zehn. Noch zweimal 2004 und 2008 war er Zweiter.
Allerdings war der vierundsiebzigste Comrades Marathon einer, der am Ende hauptsächlich negative Schlagzeilen produzierte. Wieder gab es positive Dopingtest und gleich zwei der ersten zehn Männer wurden nachträglich disqualifiziert. Dem Ganzen die Krone setzte allerdings eine Geschichte auf, die man fast als Räuberpistole abtun möchte.
Denn ein weiterer Ausschluss eines Läufers in den Top Ten gab es, weil er sich die Strecke mit seinem Bruder geteilt hatte. Aufgefallen war der Betrug unter anderem, weil er die Uhr auf Fotos einmal am linken und bald darauf am rechten Arm trug. Die beiden hatten ein sorgsam geplantes Staffelrennen hingelegt, bei dem sie den Zeitmesschip, der genau solches erschweren sollte, während vermeintlicher Toilettenbesuche übergaben.
Obwohl sich die Siegerlisten nun ziemlich international lasen, blieb der Comrades auch weiterhin und bis heute in der Breite eine fast ausschließlich südafrikanische Angelegenheit. Kaum zehn Prozent der Teilnehmer kommt auch nach Öffnung des Landes aus dem Ausland. Wenn man diese Zahlen mit denen der großen Marathons vergleicht, gibt es da noch deutliche Steigerungsmöglichkeiten.
Im Umkehrschluss bedeuten diese Zahlen allerdings auch, dass kein Staat auf der Welt eine ähnliche Masse an Ultraläufern besitzt wie Südafrika. Schließlich schreiben sich noch immer jedes Jahr ungefähr zehntausend Einheimische in die Startlisten ein. Im gesamten deutschsprachigen Raum dürfte es wohl insgesamt nicht annähernd so viele Läufer geben, die sich einmal im Jahr über die Marathondistanz hinaus wagen. Und der Wert wird umso bemerkenswerter, wenn man berücksichtigt, dass in Südafrika nicht einmal fünfzig Millionen Menschen leben.
Noch einmal deutlich gesteigert wurde das Ganze zum sogenannten „Millenium Marathon“, der ja gleichzeitig auch die fünfundsiebzigste Auflage des Comrades war. Auf fast unglaubliche knapp fünfundzwanzigtausend schnellten die Meldungen nach oben. Und gut zwanzigtausend der Jubiläumsläufer kamen dann auch im Zeitlimit ins Ziel.
Das war wie ja schon erwähnt auf die zuletzt in den Zwanzigern gültigen zwölf Stunden angehoben worden. Einige Jahre später schrieb man es dann endgültig fest, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass auch in Südafrika die Felder ähnlich wie in Europa und Nordamerika in der Breite zunehmend langsamer wurden.
Es war nicht die einzige Änderung am traditionsreichen Comrades. Denn auch die gravierenden Umwälzungen, die dazu führten, dass 1994 Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt werden konnte, gingen an der Veranstaltung nicht spurlos vorüber. Den Republic Day gab es nicht mehr. Als Austragungstermin des Rennens legte man deshalb Mitte der Neunziger den neu eingeführten Youth Day ein. Jener 16. Juni, der an den Beginn der Unruhen im Township Soweto erinnert.
Die Verschiebung fand nicht nur Beifall unter den Läufern. Denn für viele bedeutete es ein umso längeres Training in der Dunkelheit während des späten Herbstes und frühen Winters der Südhalbkugel. Und selbst wenn es in Durban um diese Jahreszeit in der Regel noch angenehm warm ist, kann es im Hochland mit den Metropolen Johannesburg, Pretoria oder Bloemfontein empfindlich kühl bis hin zu Nachtfrösten werden.
Im Jahr 2007 musste der Lauf erneut auf einen anderen Tag gelegt werden. Auslöser dafür war ausgerechnet die Jugendorganisation des ANC, die angesichts des großen Interesses am Comrades um die Aufmerksamkeit für ihre eigenen Gedenkveranstaltungen fürchtete. Das Interesse des neuen Südafrika hatte sich schnell wieder den profanen Dingen des Lebens zugewandt. Doch der Ausweichtermin an dem Sonntag, der am nächsten zum Youth Day lag, rief sofort wieder neuen Protest hervor, diesmal von christlichen Gruppen, die darin eine Bedrohung der Sonntagsruhe sahen.
Weitere Diskussionen nicht nur in sondern auch außerhalb der Läuferschaft folgten. In der selbsterklärten Regenbogennation ist es noch immer gar nicht so einfach, selbst bei solchen Dingen eine für alle verschiedenen Teile der Bevölkerung akzeptable Lösung zu finden. Andererseits zeigt das Ganze aber auch wieder, welche Bedeutung der Comrades Marathon in Südafrika hat. Oder könnte man sich ernsthaft vorstellen, dass die Politik in die Terminwahl einer deutschen Laufveranstaltung eingreift?
Noch ein weiteres Mal wurde der Lauf verschoben. Denn nun kollidierte er mit der Fußball-Weltmeisterschaft und deren Generalprobe, dem Confederation Cup. Um den beiden ebenfalls für Juni angesetzten Turnieren aus dem Weg zu gehen, wich man zuletzt wieder auf Ende Mai aus, allerdings noch immer auf Sonntage. Vielen Läufern war es durchaus Recht. Doch ob es nun dabei bleibt, muss man wohl erst einmal abwarten.
Der neben Maria Bak zweite großer Sieger der Jubiläumsausgabe war der Belorusse Wladimir Kotow, der erneut eine Minute vom bestehende Bergaufrekord abzwackte und die Marke auf 5:25:33 drückte. Der inzwischen endgültig in Südafrika beheimatete Osteuropäer zeigte sich auch bei den beiden folgenden Up Runs als Spezialist für diese Variante und siegte 2002 genau wie 2004 erneut. Bei seinem dritten Erfolg war er bereits sechsundvierzig und damit ein halbes Jahr älter als Wally Hayward, der bis dahin den Titel des ältesten Comrades Gewinners inne hatte.
Den Up-Rekord war Kotow allerdings 2008 wieder los, denn Leonid Schwezow unterbot die vorgelegte Zeit noch einmal knapp und legte eine 5:24:49 hin. Damit hält nach Bruce Fordyce wieder ein Läufer beide Bestzeiten, denn im Jahr zuvor hatte der Russe bergab bereits eine 5:20:49 erzielt und König Bruce damit klar unterboten.
Den Dreifacherfolg Schwezows vereitelte 2009 dann allerdings Stephen Muzhingi aus Zimbabwe, mit dem erstmals ein Läufer des verarmten Nachbarlandes den Comrades gewann. Bei anderen südafrikanischen Rennen lässt sich allerdings schon länger die Tendenz beobachten, dass mehr und mehr Läufer aus Zimbabwe oder Lesotho nach vorne kommen, während die Einheimischen immer öfter leer ausgehen. Armut scheint auch dort ein großer Antrieb für sportliche Höchstleistungen zu sein.
Während bei den Männern in den letzten Jahren ständig Bewegung im Spitzenfeld herrschte und kaum ein Läufer eine wirklich für längere Zeit dominierende Rolle einnehmen konnte, lesen sich die Ergebnisse im Frauenbereich regelrecht eintönig. Meist lautet der Einlauf im neuen Jahrtausend Jelena Nurgalijewa vor Olesja Nurgalijewa. Oder er lautet eben umgekehrt.
Die beiden Zwillinge, die durch ihren Doppelsieg in Frankfurt auch in Deutschland bekannt sind, teilen sich die Prämien regelmäßig untereinander auf. Und zwar nicht nur beim Comrades, wo Jelena viermal und Olesja zweimal gewinnen konnte. Auch beim Two Oceans stehen sie bereits drei- bzw. zweimal in den Siegerlisten. Jelena hält seit 2006 mit 6:09:24 auch den Up-Rekord beim Comrades. Es verwundert wenig, dass beide auch für 2010 wieder gemeldet sind.
Und dieser Lauf wird wieder ein ganz besonderer. Denn die Euphorie, die das Land wegen der Fußball-WM erfasst hat, verpasste auch dem Comrades einen erneuten Schub. Dass dies auch noch mit dem fünfundachtzigsten Jubiläum zusammenfällt, ließ das Interesse schon im Vorfeld immens erscheinen. Die Organisatoren versuchten die Notbremse zu ziehen und das Feld bei zwanzigtausend zu begrenzen. Mit dem Erfolg, nur noch mehr Nachfrage nach Startplätzen auszulösen.
Zwei Meldeblöcke waren vorgesehen. Die ersten fünfzehntausend Nummern sollten ab September für Wiederholungstäter ausgegeben werden. Sie waren Mitte Oktober vergriffen. Ab November sollten fünftausend weitere für sogenannte Novizen bereit liegen. Sie lagen ganze siebenundzwanzig Stunden. Bereits am Mittag des zweiten November war das Meldeportal wieder dicht und alle noch freien Plätze vergriffen.
Noch zweimal wurden wegen der weiter vorhandenen Masse von Anfragen neue kleinere Pakete nachgeschoben, bevor man bei weit über dreiundzwanzigtausend endgültig den Schlussstrich zog. Der eigentlich kaum zu übertreffende Rekord des Millenium Comrades als größter Ultra aller Zeiten wackelt auf einmal bedenklich.
Auch wegen der gesteigerten Teilnehmerzahlen entschied man sich zudem, den Lauf erneut als Down-Variante von Pietermaritzburg nach Durban auszutragen. Doch damit kam eine der jüngsten Comrades-Traditionen in Bedrängnis. Denn seit 2005 gibt es nämlich für Neulinge, die zwei Läufe nacheinander absolvieren die sogenannte Back-to-back-Medaille, auf der zwei Hermes-Figuren Rücken an Rücken abgebildet sind.
Das ist nämlich die offensichtliche Bedeutung des Englischen „back to back“. Doch in einem nur schwer zu übersetzenden Wortspiel, kann man eben auch „zurück kehren um zurück zu laufen“ hinein interpretieren. Eigentlich nur als Innovation für zukünftige Veranstaltungen vorgesehen, wurde die Idee so begeistert aufgenommen, dass die Comrades Marathon Association nicht anders konnte, als allen Läufern, die in der Vergangenheit die Bedingungen erfüllt hatten, zumindest den Kauf zu ermöglichen.
Nun wird ja 2010 nicht „zurück“ sondern erneut „hin“ gelaufen. Also gibt es diesmal eine "Back-to-Back Double-Down medal”. Ordnung muss schließlich sein. Ob die Läufer, die dann in ihrem dritten Comrades dann endlich auch einen Up Run bewältigen, wieder eine Besonderheit zu erwarten haben, ist zwar noch nicht bekannt, lässt sich aber bei einer solchen Kreativität fast vermuten.
Es sind all diese vielen Kleinigkeiten, die dazu beitragen den Comrades Marathon zu einem absoluten Kultereignis zu machen. Einiges davon ist sicher – wie zum Beispiel der Club der Immergrünen – durchaus auch auf europäische Veranstaltungen übertragbar und einige haben es auch schon nachgemacht. Wie das hiesige Läufervolk auf so rigoros umgesetzte Zielschlusszeiten wie in Südafrika reagieren würde, steht dagegen auf einem anderen Blatt. Doch auch sie gehören eben dazu.
Vor allem aber ist es eine unglaublich lange Tradition, die dafür sorgt, dass dieser Lauf mit kaum einem anderen zu vergleichen ist. Eine wechselvolle Historie, in der sich auch in kleinen Dingen – wie zum Beispiel dem Renntermin – die Geschichte des Landes spiegelt. Von den großen Umwälzungen, wie der Zulassung aller Startwilligen lange vor dem offiziellen Ende der Rassentrennung, ganz zu schweigen.
Auch in Südafrika hat Sport eine einigende Wirkung. Er schweißt unterschiedliche Völker, die ansonsten eher nebeneinander her leben, zu einer Nation zusammen. Und der Comrades Marathon gehört auch weiterhin zu den wichtigsten Ereignissen in diesem Bereich. Vielleicht gibt es weltweit wirklich keine andere Laufveranstaltung, die ein ganzes Land so in ihren Bann zieht.
Und in keinem anderen Land hat das Laufen über die Marathondistanz hinaus auch nur annähernd diesen Stellenwert. Denn es gibt ja den Comrades. Er ist eben einfach DIE südafrikanische Laufveranstaltung. Ein „Standard Marathon“ über zweiundvierzig Kilometer kann dagegen wahrlich nicht bestehen. Zumindest für Südafrika und die Südafrikaner trifft deshalb wohl eine Aussage tatsächlich zu: „Comrades Marathon - the ultimate human race“.
| Weitere Reisen+Laufen-Beiträge im LaufReport zu Südafrika: | |
|---|---|
| Teil 1: Bloemfontein Marathon HIER Teil 2: Peninsula Marathon Kapstadt HIER Teil 3: Pretoria Marathon HIER |
Johannesburg Marathon HIER Kapstadt Two Oceans Marathon HIER Comrades Marathon 2010 HIER Comrades Marathon 2011 HIER |
 |
Bericht von Ralf Klink Ergebnisse und Infos unter www.comrades.com Zurück zu REISEN + LAUFEN – aktuell im LaufReport HIER |
 |
© copyright
Die Verwertung von Texten und Fotos, insbesondere durch Vervielfältigung
oder Verbreitung auch in elektronischer Form, ist ohne Zustimmung der LaufReport.de
Redaktion (Adresse im IMPRESSUM)
unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes
ergibt.