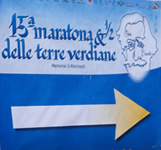 |
15. Verdi-Marathon (26.2.12)
|
 |
|
von Ralf Klink
|
Bevor jetzt jemand nach dem Lesen der Überschrift eine Karte zur Hand nimmt und sich auf die Suche nach einem Ort namens "Verdi" macht, sei gleich gesagt, dass es nicht lohnt. Den gibt es nämlich gar nicht. Genauso wenig wie eine Gegend, die so heißt. Die Laufveranstaltung, um die es in der Folge gehen soll, ist vielmehr nach Giuseppe Verdi benannt, durch dessen Heimat sie führt.
Dass es sich bei diesem Herren um einen der wichtigsten Opernkomponisten aller Zeiten handelt, kann man durchaus einmal erwähnen. Schließlich ist dies heute längst nicht mehr jedem bekannt. Doch selbst wer diesen gesungenen Theaterstücken ansonsten ziemlich wenig abgewinnen kann, kennt trotzdem meist einige der Melodien Verdis - in der Regel allerdings ohne überhaupt zu ahnen, dass sie ursprünglich aus einer Oper stammen.
Viele noch heute immer wieder einmal verwendete Ohrwürmer stammen jedenfalls aus seiner Feder. Vermutlich sogar mehr als von jedem anderen klassischen Musiker. Und da während seiner über fünf Jahrzehnte währenden Schaffensperiode die Vereinigung Italiens aus einem Flickenteppich unterschiedlicher Fürstentümer zu einem gemeinsamen Königreich stattfand, kann man Verdi nicht nur als den vielleicht größten sondern auch definitiv als den ersten wirklich italienischen Komponisten bezeichnen.
 |
 |
 |
| Vor dem Rathaus seiner Heimatstadt thront der Komponist in Überlebensgröße | ||
Ein wenig ungewöhnlich scheint es auf den ersten Blick trotzdem, ihm zu Ehren einen Marathon zu veranstalten. Doch auch hierzulande gibt es ja zum Beispiel den Einstein-Marathon in Ulm. Der Lauf in Mainz wurde einst zum sechshundersten Geburtstag des berühmten Druckers als "Gutenberg-Marathon" gegründet. Und selbst wenn ihn im Normalfall niemand so umständlich bezeichnet, heißt der größte deutsche Ultra nach einem Begründer der Turnbewegung offiziell "GutsMuths-Rennsteiglauf".
Allerdings ist der Verdi-Marathon dann doch ein wenig anders konzipiert. Denn während bei den aufgezählten Rennen eigentlich nur der Name eine Verbindung zu der bekannten Persönlichkeit herstellt, es sich ansonsten aber um eine ganz normale Veranstaltung handelt, ist die italienische Variante tatsächlich stark auf den berühmtesten Komponisten ausgerichtet. Gleich mehrere mit Verdis Leben und Wirken eng verknüpfte Orte werden unterwegs passiert, unter anderem sein Geburtshaus.
Natürlich erklingen aus den Lautsprechern als musikalische Untermalung an der Strecke keineswegs irgendwelche Rock- oder Popsongs wie sonst üblich sondern ausschließlich Opernarien. Zugegebenermaßen dürfte es allerdings auch deutlich leichter sein, Marathonis während des Rennens mit der Musik Giuseppe Verdis in Kontakt zu bringen als mit Albert Einsteins Relativitätstheorie.
 |
 |
 |
| In der Villa Pallavicino von Busseto befindet sich das Museo nazionale Giuseppe Verdi | ||
Und der Zieleinlauf befindet sich praktisch genau zu Füßen eines überlebensgroßen Denkmals für den Komponisten in seinem Heimatstädtchen Busseto. Geradezu perfekt für die Fotografen der Presse, denen so im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen wirklich unverwechselbare Bilder mit dem Namensgeber im Hintergrund gelingen können.
Doch zeigt die Erwähnung des spätestens außerhalb der italienischen Grenzen - und vermutlich sogar bereits jenseits seiner direkten Umgebung - nahezu unbekannten Busseto, dass es sich beim Verdi-Marathon keineswegs um einen Stadtlauf handeln kann. Ganz im Gegenteil, die Gegend, in der Giuseppe Verdi nicht nur geboren wurde sondern auch den größten Teil seines siebenundachtzigjährigen Lebens verbrachte, ist sogar ziemlich ländlich.
Etwa auf halbem Weg zwischen den beiden Metropolen Mailand und Bologna findet man die gerade einmal einige tausend Einwohner zählende Gemeinde in der weiten Ebene des Flusses Po, die den größten Teil des nördlichen Italiens einnimmt. Bis zu den nächsten größeren Städten Parma und Piacenza muss man von Busseto aus jeweils ungefähr die Distanz eines Marathons zurück legen.
Emilia-Romagna heißt diese Region, die ebenfalls nicht unbedingt zu den bekanntesten der insgesamt zwanzig italienischen Landesteilen gehört. Klar, man macht Urlaub in der Toskana. Vielleicht kennt man auch das Piemont oder die Lombardei. Und dass Venetien als Hinterland der Lagunenstadt eindeutig mit Venedig verknüpft ist, leuchtet selbst denjenigen ein, die noch nicht dort waren.
Aber die Emilia-Romagna könnten wohl nur die wenigsten auf Anhieb lokalisieren. Dabei zählt sie sowohl bezüglich der Fläche wie auch hinsichtlich der Einwohner eher zu den größeren der ungefähr mit deutschen und österreichischen Bundesländern oder den Kantonen der Schweiz vergleichbaren, allerdings mit etwas weniger Befugnissen ausgestatteten "Regioni".
 |
 |
| In der Kirche von Roncole gegenüber seines Geburtshauses wurde Giuseppe Verdi getauft | |
Quer über fast die komplette Stiefelhalbinsel erstreckt sie sich ungefähr in Form eines lang gezogenen Dreiecks. Dessen - in der Realität dann doch ein wenig abgerundete - westliche Spitze befindet sich nur wenige Kilometer vom Ligurischen Meer entfernt. Die östliche Kante bildet dagegen die Adriaküste mit so bekannten Badeorten wie Riccione und Rimini. Dadurch schließt die Emilia-Romagna den Großraum "Oberitalien" nahezu vollständig nach unten ab.
Die südlichen Nachbarregionen Toscana und Marche werden nämlich schon zum Mittelteil des Landes gerechnet. Auch topographisch ist das eindeutig zu erkennen. Die an einigen Stellen über zweitausend Meter hoch aufragenden emilianisch-toskanischen Apenninen stellen nicht nur die politische sondern auch eine deutlich sichtbare natürliche Grenzlinie dar. Gemeinsam mit dem Alpenbogen im Norden und Westen bilden sie einen sich nur zur Adria hin öffnenden, hohen Gebirgsring rund um die Po-Ebene.
Dass sich in diesem Höhenzug mitten in Italien außerdem eine internationale Grenze befinden soll, dürfte erst einmal für Erstaunen sorgen. Doch zählt auf einem kurzen Abschnitt eben auch die unabhängige Republik San Marino zur Nachbarschaft der Emilia-Romagna. Die letzte Seite des Dreiecks im Norden übernimmt schließlich von wenigen Stellen einmal abgesehen meist der größte italienische Strom selbst. Jenseits des Wassers beginnen dann - ohne dass sich die Landschaft am anderen Ufer groß unterscheiden würde - bereits die Lombardei und Venetien.
Der Bindestrich im Namen der Region ist übrigens keineswegs Zufall. Ähnlich wie beim deutschen Bundesland Baden-Württemberg handelt es sich nämlich um einen künstlichen Verbund aus zwei sich einander nicht unbedingt in inniger Zuneigung begegnenden Teilen, die historisch eigentlich nie eine Einheit bildeten. Während die Emilia den gesamten Westen und Nordosten bedeckt, nimmt die etwas kleinere Romagna die südöstliche Ecke der Region ein.
 |
 |
 |
| Einige recht imposante Gebäude kann man in Salsomaggiore Terme finden, z. Beispiel Kongresszentrum, Rathaus und Thermalbad | ||
Beide Bezeichnungen können auf eine lange Geschichte zurückblicken. Die Romagna hat ihren Namen aus der Völkerwanderungszeit. Denn die Region gehörte noch zum Herrschaftsgebiet der langsam in der Bedeutungslosigkeit versinkenden früheren Weltmacht Rom, während im Rest von Norditalien das Reich der Langobarden entstand, auf das übrigens auch die Bezeichnung "Lombardei" zurück geht.
Auch in der Folgezeit wurde die Romagna meist von Rom aus beherrscht. Viele Jahrhunderte war sie Bestandteil des Kirchenstaates. Erst kurz vor der endgültigen Einigung Italiens konnte sie sich vom Papst lösen und bestand einige Monate lang als unabhängiges Land, das aber schnell dem neu entstandenen Königreich beitrat.
Da dies zur gleichen Zeit auch die beiden emilianischen Herzogtümer "Modena und Reggio" sowie "Parma und Piacenza" taten, waren erstmals seit antiker Zeit beide Regionen wieder in einem Staat vereint. Als politische Einheit entstand die heutige Emilia-Romagna sogar erst nach dem zweiten Weltkrieg, als man dem zuvor eher zentralistisch ausgerichteten Italien eine föderalere Struktur gab.
Sogar noch viel weiter lässt sich die Benennung der Emilia zurück verfolgen. Sie kann ihren Namen nämlich von der mehr als zweitausend Jahre alte Römerstraße "Via Aemilia" ableiten, die ihre flachen Niederungen durchzieht. Nach und nach wurde so nicht mehr nur der Handelsweg sondern auch die Landschaft, durch den er führte, bezeichnet. Die Straße gibt es immer noch, sie ist meist sogar ziemlich gut ausgeschildert. Allerdings hat sie mit dem römischen Ursprung außer dem Verlauf nicht mehr allzu viel gemein.
Als ganz normale Staatsstraße, als Strada statale 9 verbindet sie all die mittleren bis großen städtischen Zentren, die seit der Antike wie Perlen an der Schnur entlang dieser wichtigen Route entstanden sind. Inzwischen verläuft parallel zu ihr auch die Autostrada A1, die fast über die gesamte Stiefelhalbinsel von Mailand nach Neapel führt. Mehrere weitere Autobahnen sowie etliche Bahnlinien durchziehen die Region und belegen die Bedeutung der Po-Ebene und der Emilia als Verkehrsweg.
 |
 |
 |
| Egal ob für Villen (links und rechts) oder die Kirche San Vitale (mitte), Plätze auf dem Hügel sind bei Bauten im Kurort durchaus beliebt | ||
Als Tourismusregion und Reiseziel steht die von der Größe her ungefähr Hessen entsprechende Emilia-Romagna dagegen nicht unbedingt ganz oben auf dem Zettel. Dorthin kommt man doch eher zufällig oder vielleicht einmal auf der Durchreise. Nicht etwa, dass es in der Region überhaupt nichts Interessantes zu sehen gäbe. Aber das an Kunstschätzen und Naturschönheiten reiche Italien hat eben vielerorts noch wesentlich Spektakuläreres zu bieten.
So ist es vermutlich gar nicht einmal so ungeschickt, sich bei einer Laufveranstaltung voll und ganz auf den überregional berühmten Komponisten zu konzentrieren, um sich entsprechend aus dem auch in Italien ziemlich reichhaltigen Angebot ein wenig heraus zu heben. Die Konkurrenz ist schließlich sogar in der näheren Umgebung alles andere als klein. Gerade im Norden des Landes gibt es kaum noch unerschlossene Flecken auf der Marathonlandkarte.
Nur eine Woche nach dem Verdi-Marathon wird zum Beispiel im nahegelegenen Piacenza über zweiundvierzig Kilometer gelaufen, zwei Wochen danach im kaum weiter entfernten Brescia. Es sind zudem zwei Rennen, die sich mit jeweils etwa fünfhundert Teilnehmern auf der Königsdistanz auch noch in etwa der gleichen Größenordnung bewegen. Im Umkreis von einhundert Kilometern kann man im Oktober außerdem den Lauf von Carpi, der sich trotz zuletzt nicht mehr die Vierstelligkeit erreichender Starterzahlen wenig bescheiden "Maratona d'Italia" nennt, finden.
Und im Dezember wird in Reggio nell'Emilia ein zwei- bis dreitausend Läufer anziehendes Rennen ausgerichtet. Schlägt man den Bogen mit einem etwas größeren Radius, kommen unter anderem auch noch Mailand, Verona und der Gardasee als aus dem Raum Parma - in der größten und bekanntesten Stadt der westlichen Emilia selbst gibt es nur einen Halbmarathon - problemlos erreichbare Veranstaltungsorte hinzu.
In eine vollkommene Marktlücke ist man mit dem Verdi-Marathon also nicht hinein gestoßen, doch ist das Gesamtkonzept gut genug, um die Veranstaltung auf eine tragfähige Basis zu stellen. Zum einen beschränkt man sich nämlich keineswegs nur auf Busseto sondern hat bei der Kurssetzung insgesamt fünf verschiedene Gemeinden eingebunden. Und so heißt der Lauf dann im Italienischen auch "Maratona delle terre verdiane" oder "Maratona dei luoghi verdiani", was übersetzt ungefähr "Marathon der Verdi-Länder" und "Marathon der Verdi-Orte" bedeutet.
Zum anderen ist das Streckenangebot breit gestreut. Neben dem eigentlichen Hauptlauf und dem beinahe zu erwartenden Halbmarathon werden auch noch Rennen über ungefähr neun und etwa neunundzwanzig Kilometer angeboten. Die eher krummen Distanzen ergeben sich durch die Ausrichtung aller Läufe auf Punkt-zu-Punkt-Kursen, für die jeweils passende Start- und Zielorte gefunden werden mussten.
Busseto ist auch keineswegs das absolute Zentrum der Veranstaltung. Nur die beiden längsten Strecken enden dort. Eine deutlich größere Bedeutung hat Salsomaggiore Terme. Nicht nur dass dort sowohl der volle wie auch der halbe Marathon sowie die kurze Einsteigerdistanz gestartet werden, auch die Startnummernausgabe findet sich im für sein salzhaltiges Quellwasser bekannten Kurort.
Unter anderem wegen der kürzeren Wege - und vielleicht der Möglichkeit am Wettkampftag ein bisschen länger zu schlafen - ziehen die meisten auswärtigen Teilnehmer Salsomaggiore als Quartier vor. Aber während die Zahl der Übernachtungsmöglichkeiten im kleinen Busseto eher begrenzt ist, findet man im ungefähr dreimal so großen Kurstädtchen natürlich auch eine deutlich bessere Auswahl an Hotels unterschiedlichster Preisklassen vor.
In den übrigen durchlaufenen Gemeinden Fidenza, Fontanellato und Soragna lassen sich jedoch ebenfalls einige Zimmer entdecken. Nicht immer befinden sich diese allerdings direkt im Hauptort. Denn zu jedem von ihnen gehören außerdem noch ein bis zwei Dutzend Ortsteile und kleinere Weiler - sogenannte Frazioni - sowie eine große Zahl einzelner Gehöfte, die sich weit über die hauptsächlich von der Landwirtschaft geprägte Gegend verteilen.
 |
 |
 |
| In einem in seiner Phantasiearchitektur fast an Disneyland erinnernden Straßenzug sind im Fidenza Village Geschäfte teurer Marken untergebracht | ||
Selbst wenn sowohl Salsomaggiore wie auch Busseto an das Eisenbahnnetz angebunden sind und Fidenza als Umsteigebahnhof sogar an der Hauptlinie von Mailand nach Bologna liegt, kann je nach Auswahl des Hotels ein Auto also durchaus notwendig sein. Und da die von Deutschland aus regelmäßig angesteuerten Flughäfen von Milano-Linate und Bologna nur jeweils ungefähr einhundert Kilometer entfernt sind, lässt sich zur Anreise zum Verdi-Marathon ziemlich jede nur denkbare Kombination zusammen basteln.
Das noch näher gelegen Parma besitzt zwar ebenfalls einen kleinen Flughafen. Er ist sogar nach Giuseppe Verdi benannt. Doch eine echte Alternative ist er nicht. Denn bei der Zahl von Starts und Landungen kommt man dort pro Tag nicht über jeweils eine Handvoll hinaus. Und in den deutschsprachigen Raum gibt es vom Parma aus ohnehin keine einzige Verbindung.
Wegen der vielen Unterkünfte kommt Salsomaggiore Terme natürlich ein wenig anders daher als die übrigen Ortschaften der Umgebung. Als Kurstadt ist es zudem deutlich weiter angelegt und wesentlich grüner. Neben dem eigentlichen Kurpark gibt es noch einige weitere Anlagen. Und so manches bessere Hotel und manche der zahlreichen Villen hat einen eigenen großen Landschaftsgarten.
Doch auch die Topographie unterscheidet sich von allen anderen Gemeinden, die man während des Verdi-Marathons passieren wird. Während nicht nur Busseto sondern auch Fontanellato und Soragna sowie der größte Teil von Fidenza in der Po-Ebene liegen, ist das Gelände rund um Salsomaggiore schon deutlich welliger.
In der Nähe des Badeortes beginnt nämlich die Übergangszone zwischen der weiten Flussniederung, die rund die Hälfte der Emilia-Romagna ausmacht, zum bergigen Südteil der Region. Selbst wenn die flache Landschaft am großen Strom - auch aufgrund der dort deutlich stärkeren Besiedlung - in der äußeren Wahrnehmung dominierend ist, besteht doch immerhin jeweils ungefähr ein Viertel ihres Territoriums aus Hügelland und Gebirge.
 |
 |
| Der Start der Punkt-zu-Punkt-Strecke befindet sich im Kurstädtchen Salsomaggiore Terme | |
Gut einhundert Meter liegt deswegen der Startpunkt des Verdi-Marathons in Salsomagggiore oberhalb seines Ziels in Busseto. Die Strecke ist also aufgrund der Vorgabe von maximal einem Promille Gefälle nicht rekordtauglich. Allerdings dürfte dies höchstens einen kleinen Bruchteil der Läufer überhaupt interessiert. Und in die Verlegenheit, dass auf dieser Strecke erzielte Spitzenleistungen es nur mit einem dicken Sternchen in die internationalen Bestenlisten schaffen, wird man schon aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel kaum kommen.
Zwar lagen die Siegerzeiten in der Vergangenheit meist unter 2:20 bei den Herren und 2:50 bei den Damen. Die gültigen Veranstaltungsrekorde stehen immerhin bei 2:14:54 und 2:37:06. Doch in den letzten Jahren ist das Niveau - vielleicht auch aufgrund niedrigerer Preisgelder - spürbar abgesunken. Bei den Männern liegt man nun doch meist näher bei 2:30 oder sogar knapp darüber. Und bei den Frauen reichte zuletzt auch schon einmal eine drei an der ersten Stelle, um ganz oben auf dem Treppchen zu stehen.
Beim oberflächlichen Blättern in italienischen Ergebnislisten scheinen durchaus ähnliche Effekte erkennbar wie auf der anderen Seite der Alpen. Nur ein bisschen später haben die Entwicklungen eingesetzt. Aber inzwischen sinken sowohl in der Spitze wie auch in der Breite die Leistungen auch auf der Stiefelhalbinsel seit einiger Zeit erkennbar ab.
Zwar sind im internationalen Vergleich die italienischen Männer noch ein klein wenig konkurrenzfähiger als die deutschen. Unter die besten zweihundert der Weltrangliste hat es in den vergangenen Jahren allerdings keiner von ihnen mehr geschafft. Die Zeiten, in denen Läufer wie Orlando Pizzolato, Giovanni Poli oder Olympiasieger Gelindo Bordin und als Letzter von ihnen der ebenfalls mit Olympiagold bedachte Stefano Baldini den Standard definierten, sind lange vorbei. Rund zehn Minuten liegen die besten Italiener nun hinter der absoluten Weltelite zurück.
Bei den Frauen ist die Kluft noch nicht ganz so dramatisch. Und aufgrund deutlich weniger Erfolge in der Vergangenheit hat man auch eine nicht ganz so große Fallhöhe wie die männlichen Kollegen. Aber mit einer maximalen Ranglistenposition knapp unter oder knapp über Platz einhundert kann man ebenfalls niemanden wirklich vom Hocker reißen. Und beim eher bescheiden dotierten Verdi-Marathon ist natürlich nicht die absolute nationale Spitze vertreten.
 |
 |
| Nachdem man Salsomaggiore verlassen hat, folgt für zwei Kilometer ein spürbares Gefälle … | … doch als man das Dörfchen Ponte Ghiara erreicht, ist die Strecke schon wieder ziemlich eben |
Höchst stilvoll ist jedenfalls dessen Startnummernausgabe. Sie befindet sich nämlich im Palazzo dei Congressi, dem Kongresszentrum der Stadt, zu dem man ein Luxushotel von aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende umgestaltet hat. Von außen ist der in Pastellfarben gestrichene Bau zwar nicht unbedingt hässlich, aber trotzdem auch nicht wirklich beeindruckend.
Innen jedoch entfaltet sich der Jugendstil - den man in Italien entweder mit dem englischen Begriff "Liberty" oder mit dem französischen "Art Nouveau" bezeichnet - in voller Pracht. Insbesondere der von einer Glaskuppel überragte "Salone Moresco", in dem nicht nur ein Sportartikelgeschäft seine Waren anbietet sondern auch am Samstagabend eigens eine Präsentation des Marathons stattfindet, ist fast schon überladen.
Und während man die Startnummer noch an der zumindest für Jugendstilarchitektur recht nüchternen Garderobe erhält, bekommt man den "pacco gara" - was wörtlich übersetzt "Rennpaket" bedeutet, im Jargon der Marathon-Werbeleute aber wohl doch eher als "goody bag" bezeichnet würde - im bunt verzierten "Sala del Lampadario", dem "Kronleuchtersaal".
Hauptsächlich lokale Agrarprodukte finden sich in der Tüte. Tomatensaft, Würstchen und sogar eine eingeschweißte kleine Schweinshaxe. Ein T-Shirt gibt es noch obendrauf, ein ganz traditionelles aus Baumwolle und keines aus Funktionsfaser, wie man es inzwischen bei vielen Läufen erhält. Das Preis-Leistungsverhältnis ist jedenfalls alles andere als schlecht. Denn mit maximal fünfunddreißig Euro Startgebühr plus zehn Euro Pfand für Chip ist man dabei.
Da außerdem noch ein "Grand Buffet d'Accoglienza" - ein Begrüßungsbuffet nach der samstäglichen Marathonvorstellung - und eine Portion Pasta im Ziel sowie selbstverständlich eine Medaille zum Leistungsumfang gehören, kann sich nun wahrlich niemand beschweren, dass man zu viel Geld bezahlen musste. Zumal selbstverständlich auch die bei einer Punkt-zu-Punkt-Strecke notwendigen Bustransporte im Betrag enthalten sind.
Angesichts mehrerer Start- und Zielpunkte ist dafür ein recht komplexer Fahrplan nötig. Sowohl vor als auch nach dem Rennen werden die Läufer nämlich zwischen den Orten hin und her befördert. Hauptsächlich besteht der "servizio navetta" selbstverständlich zwischen Busseto und Salsomaggiore. Doch eben auch vom Halbmarathonziel Fontanellato rollen die Busse vorher und hinterher in das Kurstädtchen. Und den Bahnhof von Fidenza hat man ebenfalls in das Konzept integriert. Ganz egal wie und wohin man also anreist, man kommt an die richtigen Plätze.
 |
 |
 |
| Überaus reizvolle ist die kleine, aber feine Altstadt von Fontanellato mit ihren Laubengängen | ||
Wer allerdings beschlossen hat, von Busseto aus aufzubrechen, muss sich auf eine relativ kurze Nacht einstellen. Denn obwohl der Start erst um 9:30 angesetzt ist, fahren die Busse dort bereits zwischen 7:15 und 7:45 los. Zumindest ist es Ende Februar um diese Uhrzeit nicht mehr dunkel. Und der im Süden langsam beginnende Frühling sorgt zudem dafür, dass es auch nicht mehr allzu kühl ist.
Noch sind die Temperaturen zwar einstellig, aber bereits am Vortag waren sie bei strahlendem Sonnenschein deutlich über die Marke von fünfzehn Grad geklettert. Und für den Marathonsonntag sind die Vorhersagen mehr oder weniger identisch. Nicht überall lässt sich die Sonne jedoch schon wirklich sehen. Gelegentlich taucht der Bus auch in Nebelfelder ein, die zwischen den Ortschaften über die Felder treiben.
Verwunderlich ist das eigentlich nicht. Denn die Po-Ebene gilt in Italien als absolutes Nebelloch. Insbesondere im Winterhalbjahr kann es ziemlich trüb, ungemütlich und tagelang nicht richtig hell werden. Und selbst auf der Autobahn erinnern ständig Schilder daran, wie schnell man in Abhängigkeit von den noch sichtbaren Straßen-Markierungen fahren soll, wenn wieder einmal die Nebelschwaden über den Asphalt ziehen.
Wer die Augen während der Fahrt noch ein bisschen weiter offen hält, erkennt außerdem, dass die Wetterverhältnisse noch nicht allzu lange so angenehm sein können. Denn immer wieder lassen sich Schneereste aus dem gerade erst zu Ende gegangenen, dem Anschein nach nicht unbedingt milden Winter entdecken. Und je näher man dem höher gelegenen Salsomaggiore kommt, umso häufiger und größer werden die Flecken. Wenig überraschend sind auch die morgendlichen Temperaturen im Hügelland ein wenig niedriger als in der Ebene.
Die Sonne hat es noch schwer über die umliegenden Kuppen hinaus zu kommen. Und an einige besonders schattige Stellen des Städtchens scheint sie um diese Jahreszeit überhaupt nicht vordringen zu können. Dort liegende größere Schneehaufen zeigen das recht deutlich. In einer Ecke des zentralen Platzes vor dem großen Thermalbad muss man angesichts einiger noch immer überfrorenen Stufen sogar ziemlich aufpassen, sich nicht schon vor dem Start auf die Nase zu legen.
Das Berzieri-Kurhaus - benannt nach dem Arzt, der die salzhaltigen Quellen des Ortes als Erster zu Therapiezwecken benutzte - aus den Zwanzigern des letzten Jahrhunderts ist eindeutig der Mittelpunkt und das unverwechselbare Markenzeichen der Stadt. Wuchtig und doch fein gegliedert nimmt der ebenfalls im Jugendstil errichtete Bau einen kompletten Straßenblock ein. Nicht nur wie das Kongresszentrum hauptsächlich innen sondern auch außen reich verziert, wirkt es dabei manchmal fast schon überladen.
 |
 |
 |
| Eine schmale Altstadtgasse bringt die Marathonis zur romanischen Kathedrale von Fidenza | ||
Wer von den Marathonis nicht am Vortag schon einmal einen Blick auf dieses "Centro Benessere Berzieri" - was wörtlich übersetzt so etwas wie "Wohlbefindens-Zentrum" bedeutet, heutzutage aber wohl doch auf Neudeutsch eher als "Wellness-Center" vermarktet würde - geworfen hatte, weil er seine Unterlagen erst am Renntag abholt, sollte vor dem Start vielleicht doch noch einmal dort vorbei gehen. Denn während des Laufes bekommt man es nicht mehr zu Gesicht.
Das war nicht immer so. Die Strecke führte in der Vergangenheit auch schon an den Thermen entlang. Doch während man das Grundkonzept der Veranstaltung in den eineinhalb Jahrzehnten ihres Bestehens eigentlich immer beibehalten hat und die Reihenfolge der angelaufenen Gemeinden sich schon alleine aufgrund ihrer Lage zueinander sich nicht verändert hat, wurde an der genauen Kurssetzung dann doch immer wieder einmal leicht herum gebastelt. Von allen Ortschaften an der Strecke sieht man von Salsomaggiore inzwischen jedenfalls eindeutig am wenigsten.
Einige hundert Meter vom Thermalbad entfernt findet sich der Startpunkt in der Viale Giacomo Matteotti. Der Startbogen der "Gazetta di Parma", der sich über die Absperrgitter wölbt, markiert die genaue Stelle. Doch abgesehen davon und einigen Mobiltoiletten am benachbarten Kurpark hat man ansonsten wegen der ohnehin nur kurzen Verweildauer im Städtchen auf größere Aufbauten verzichtet. Zum Umziehen reicht bei nun doch langsam steigender Quecksilbersäule allerdings auch ein sonniges Plätzchen am Straßenrand.
Kleinlastwagen bringen dann die Wechselkleidung an die entsprechenden Zielorte. Wie bei vielen anderen Veranstaltungen üblich sind die jeweiligen Nummernkreise außen angebracht. Und diesmal sollte man sich trotz des kurz vor dem Start bei der Abgabe entstehenden leichten Gedränges tunlichst daran halten. Denn da zeitgleich mit dem Marathon auch die Halbdistanz sowie die "Salso-Fidenza" genannte Kurzstrecke gestartet werden und deren Teilnehmer ihre Taschen ebenfalls zum Transport abliefern, könnte das Gepäck ansonsten am völlig falschen Punkt landen.
 |
 |
| In der Fußgängerzone endet der neun Kilometer lange Lauf "Salso - Fidenza" | |
Der Anhänger, der nach dem Einladen in den richtigen Laderaum dafür sorgt, dass man die eigenen Sachen nach dem Rennen problemlos wieder ausgehändigt bekommen kann, gehört sicherlich zu den schönsten seiner Gattung. Mit dem Logo der Veranstaltung - das nun wirklich nicht überraschend Giuseppe Verdi zeigt - als Aufdruck und einem Band in Farben der italienischen Trikolore ist er eigentlich zu schade zum wegwerfen. Der Schriftzug "14a Maratona delle terre verdiane" zeigt, dass es die Organisatoren im Vorjahr ja auch nicht getan haben.
Nachdem das insgesamt immerhin fast zwölfhundert Köpfe zählende Feld erst einmal auf die Reise geschickt ist, verlässt es das Zentrum von Salsomaggiore auf den direktesten Weg. Selbst wenn die Straße ab und zu einen leichten Bogen macht, geht es erst einmal praktisch immer geradeaus. Bald werden die Häuser niedriger und rücken weiter auseinander als im dichter bebauten Stadtkern. Später tauchen jene leicht mit dem Auto anzufahrenden Supermärkte und Läden auf, die auch in Italien längst die Randzonen einer Ortschaft dominieren.
Am Verkehrskreisel, in dem man genau an der Kilometermarkierung mit der "2" ankommt, endet die lange innerstädtische Gerade und die Landstraße beginnt. Wenig später hat man auch das Ortsschild passiert. Und statt Bebauung tauchen auf der rechten Seite Ackerflächen auf. Linker Hand ist dagegen erst einmal ein Hang, denn noch hat man die Hügellandschaft nicht endgültig hinter sich gelassen.
Das geht dann allerdings doch ziemlich schnell. Während die Strecke in der Kurstadt nicht unbedingt viel an Höhe verlor und man sogar die eine oder andere leichte Gegenwelle spüren konnte, fällt die Straße jetzt auch optisch erkennbar ab. Nun sorgen vierzig auf zwei Kilometern abhanden gekommene Meter nicht wirklich für eine Bergabpiste, die sich schwungvoll hinunter stürzen lässt. Aber es rollt eben doch ganz gut.
Und als man kurz vor Kilometer fünf das bereits zu Fidenza gehörende Dörfchen Ponte Ghiara erreicht, hat man schon beinahe die Hälfte des gesamten Höhenunterschiedes im Rennverlauf hinter sich. Von nun an sind die Lageangaben auf der Karte zweistellig. Bis zum - zufällig genau passend zum Marathon - zweiundvierzig Meter über dem Meer befindlichen Busseto fehlen nur noch ungefähr fünfzig.
 |
 |
 |
| Nach dreizehn Kilometern führt die Strecke mitten durch die Geschäfte des "Fidenza Village" | ||
Selbst wenn es bis zum Halbmarathonziel in Fontanellato weiterhin mit einem für Straßenläufe irregulären Gefälle bergab gehen wird, lässt sich von nun das kaum noch bemerken. Eine Handvoll Meter pro Kilometer, um die es sich dabei im Schnitt handelt, sind eigentlich nicht der Rede wert. Und nicht nur die Straße, auch das Gelände rundherum ist jetzt schon weitgehend flach. Die Po-Ebene hat das Tal von Salsomaggiore als Schauplatz abgelöst.
Ein seltsames Knattern ertönt über dem Läuferfeld. Fast wie ein Moped oder ein Rasenmäher hört es sich an. Und viel stärker dürfte der Motor des Ultraleichtflugzeuges auch nicht sein, das in der Anfangsphase eine ganze Zeit lang die Sportler begleitet. Sicherlich gehört es zu den ungewöhnlichsten Zuschauerplätzen, denen auch Marathonis mit einer längeren Karriere je begegnet sind.
Ansonsten ist der Publikumszuspruch aber eher bescheiden, was bei einem weitgehend über Land führenden Rennen kaum verwunderlich ist. Nur gelegentlich stehen - dann fast schon überraschend - hie und da eine Handvoll Anwohner an der Strecke. Selbst in den Ortskernen hält sich der Andrang in Grenzen. Die meisten Menschen haben sich noch an den verschiedenen Zielpunkten versammelt. Doch sind das eben hauptsächlich Fachleute und keineswegs wegen der guten Stimmung anwesende Zaungäste.
Ohnehin ist man diesbezüglich durch die großen Stadtmarathons wie Berlin, Frankfurt, Hamburg oder Köln hierzulande nicht nur ziemlich verwöhnt sondern hat vielleicht auch eine gewisse Anspruchshaltung entwickelt, die man anderenorts nur selten erfüllt bekommen wird. Selbst in mancher großen Metropole läuft man nämlich weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und wenn wie beim Verdi-Marathon alle betroffenen Kommunen zusammen gerade einmal sechzigtausend Einwohner zählen, sind fehlende Zuschauermassen eigentlich sogar logisch.
Doch immerhin ist die Veranstaltung in der Gegend akzeptiert. Die ungefähr einstündige Komplettsperrung der Hauptroute nach Salsomaggiore ist jedenfalls kein echtes Problem. Es gibt schließlich noch eine nur wenig längere, wenn auch steigungs- und kurvenreichere Ausweichstrecke. Und von übermäßig viel Verkehr kann an diesem Sonntagmorgen sowieso keine Rede sein.
 |
 |
| Am als Sponsor auftretenden Einkaufszentrum wird auch der Lauf über neunundzwanzig Kilometer gestartet | |
Später werden sich die Läufer den Asphalt zwar mit den Autos teilen müssen. Doch zum einen ist man hauptsächlich auf ohnehin wenig befahrenen Nebenstraßen unterwegs. Zum anderen nehmen die Fahrzeuglenker die aufgestellten Warnschilder oder Tipps der Ordner durchaus ernst und verhalten sich meist ziemlich rücksichtsvoll. Das ist durchaus erwähnenswert, denn insbesondere im Mittelmeerraum, aber auch hierzulande kann man als Läufer gelegentlich ganz andere Beobachtungen machen.
Über einen weiteren der ziemlich verbreiteten Kreisel nähert man sich Fidenza. Wenig später beginnt hinter der Brücke, auf der die Stichbahn nach Salsomaggiore die Straße überquert, die Bebauung. Diese hat durchaus etwa Städtisches. Nicht nur von Gärten umgebene Ein- und Mehrfamilienhäuser, von denen einige fast schon den Charakter einer Villa haben, lassen sich auf dem etwa zwei Kilometer langen Weg hinein in Zentrum entdecken sondern auch einige größere Wohnblocks.
Doch Fidenza ist von allen Gemeinden der Umgebung eben tatsächlich die größte. Wobei man angesichts von gut fünfundzwanzigtausend Einwohnern, die unter Berücksichtigung aller Ortsteile zusammen kommen, nun wahrlich noch nicht von einer echten Metropole sprechen kann. In der Provinz Parma ist man damit hinter der namensgebenden Großstadt und vor dem immerhin auch ungefähr zwanzigtausend Bürger zählenden Salsomaggiore eindeutig die Nummer zwei.
Nachdem die Läufer bisher acht Kilometer mehr oder weniger immer in die gleiche Richtung unterwegs waren, folgen nun einige schnelle Richtungswechsel direkt hintereinander. Und plötzlich ist man dadurch in einer engen Altstadtgasse gelandet. Kleine, in warmen Gelb-, Rot- oder Brauntönen gestrichene Häuschen kleben in ihr malerisch aneinander. Und statt in gerader Linie verläuft sie so gebogen, dass man mittendrin keinen ihrer beiden Zugänge erkennen kann.
Dass Gässchen endet direkt vor der Kathedrale von Fidenza. Immerhin rund neunhundert Jahre hat das vollständig im romanischen Stil errichtete Bauwerk schon auf dem Buckel. Es handelt sich dabei tatsächlich auch um eine Bischofskirche, denn die Stadt ist Sitz eines katholischen Bistums. Allerdings umfasst dieses kaum mehr als das Verdi-Land und zählt nicht einmal hunderttausend Gläubige. Nirgendwo ist die Gliederung nämlich kleinteiliger als in Italien, wo es alleine fast zweihundert Diözesen gibt. Nur in der Emilia-Romagna sind es ja schon fünfzehn.
 |
 |
| Hinter Fidenza führt der Marathonkurs hinaus in die Weite der Po-Ebene | |
Der mit grobem Kopfsteinpflaster - sogenannten Katzenköpfen - versehene Vorplatz geht in die ebenfalls gepflasterte, aber hauptsächlich mit flachen Platten ausgelegte Fußgängerzone über. Und am Streckenrand herrscht auf einmal deutlich mehr Trubel. Denn das erste Ziel des Tages, das des etwas über neun Kilometer langen Rennens "Salso-Fidenza" kommt in Reichweite. Als die Gasse sich zur Piazza Garibaldi weitet, leiten Schilder die Kurzstreckler nach links. Nur noch wenige Meter sind es für sie vom Abzweig zur Linie vor dem Rathaus.
Nebeneinader überlaufen sie gleich zwei Herren als Erste. Doch obwohl sowohl für Edgardo Confessa als auch für Cristian Paoletta eine Zeit von 30:48 registriert wird, setzt man Confessa aus Vicenza auf Platz eins. Die Damen machen es zwar ebenfalls spannend. Allerdings liegen zwischen der in 34:50 siegreichen Sarah Martinelli und ihrer Verfolgerin Gisella Locardi dann doch acht Sekunden.
Die Halb- und Ganzmarathonis laufen am zentralen Platz von Fidenza noch ein Stück weiter geradeaus. Schnurgerade ist die Straße, was den Verdacht aufkommen lässt, dass sie bereits zur Römerzeit existierte. Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Karte, dass diese Altstadtgasse westlich und östlich der Stadt eine in immer noch gerader Linie weiterführende Verlängerung besitzt - die alte Via Aemilia. Den Autoverkehr leitet man inzwischen zwar um die Stadt herum, der ursprünglich Verlauf des mehr als zwei Jahrtausende alten Handelweges ist aber noch klar erkennbar.
Als es dann auch für die Teilnehmer der beiden längeren Distanzen links ab geht, stoßen sie wenig später auf die Eisenbahnlinie, die sich in ihrem Verlauf nahezu durchgängig an der Römerstraße orientiert. Eine Unterführung am Bahnhof bringt das Läuferfeld auf die andere Seite, wo sich Fidenza mit einem Gewerbegebiet langsam in die Weite der Po-Ebene hinaus verliert.
Die durch es hindurch führende Straße mündet in einen Verkehrsknoten, der die moderne Via Emila, die Strada statale 9 gleich in mehreren Varianten an Fidenza anbindet. "Tangeziale" nennt man solche Ortsumgehungen im Italienischen, auch wenn sie zumindest in der Emilia-Romagna wenig mit einer Tangente im mathematischen Sinne zu tun haben. Denn statt einer Gerade, von der die Städtchen nur an einer Stelle berührt werden, handelt es sich eher um Halbkreise, die sich als enger Ring um die Ortschaften herum legen.
 |
 |
| Eine Brücke über die Autostrada A1 und die parallel dazu verlaufende Schnellbahnstrecke Mailand-Bologna ist die größte Steigung des Rennens | |
Eine Brücke über die Umgehungsstraße lässt die Marathonis diesen Ring verlassen. Aus einem Lautsprecherwagen ertönen als moralische Unterstützung bei der Überwindung der Steigung Opernarien. Selbst wenn man sich nicht unbedingt für diese Kunstform interessiert und keinesfalls jede von ihnen kennt, lässt sich vermuten, dass sie ausschließlich vom Namensgeber der Veranstaltung stammen.
Schließlich hat kaum ein Opernkomponist ein ähnlich umfangreiches Werk geschaffen. Während sein Vorgänger Gioachino Rossini und sein Nachfolger Giacomo Puccini - die Wirkungsphasen der drei schließen nahezu lücken- und überlappungsfrei aneinander an - nicht einmal eine Handvoll bekannte Stücke schrieben, zählen Freunde dieses Genres für Verdi rund zwei Dutzend auf, von denen die meisten auch heute noch zum Standardprogramm gehören. Selbst viele völlige Laien können mit den Namen "Nabucco", "Rigoletto" oder "Aida" etwas anfangen.
Wohl nur sein Zeitgenosse Richard Wagner - beide sind im gleichen Jahr, nämlich 1813 geboren - kann in dieser Hinsicht noch mithalten. Eine gewisse Konkurrenz zwischen den zwei großen Komponisten bestand durchaus. Es wird zum Beispiel erzählt, dass Giuseppe Verdi ziemlich erbost reagiert habe, als Kritiker seiner Opern eine Ähnlichkeit mit den Stücken des gebürtigen Sachsen festgestellt haben wollten und einige ihn sogar der Imitierung Wagnerianischer Stilelemente bezichtigten.
Mit der Brücke beginnt der vermutlich unangenehmste Abschnitt des Rennens. Nicht nur dass die Straße, auf der die Läufer nun unterwegs sind, zu einer Autobahnauffahrt führt, auch ein großes Einkaufszentrum wird über sie erreicht. Und da dieses am Sonntagmorgen geöffnet ist, sind eine ganze Menge Fahrzeuge auf ihr unterwegs. Spätestens als die Marathonis in den direkten Zubringer einbiegen, bleibt ihnen aufgrund des nun fehlenden Seitenstreifens nichts anderes übrig, als mitten im Verkehr mit zu schwimmen.
Dass die Konsumpaläste vor den Toren des Städtchens auf dem Streckenplan stehen, ist keineswegs zufällig. Das Fidenza Village gehört nämlich zu den wichtigsten Sponsoren der Veranstaltung. In einem in seiner Phantasiearchitektur fast an Disneyland erinnernden Straßenzug sind Geschäfte teurer Marken untergebracht, die ihre Waren unter dem eigentlichen Listenpreis verkaufen. "Factory-Outlet-Center" nennt sich dieses aus Amerika stammende Modell, das sich inzwischen in Europa ziemlich verbreitet hat.
Auch in Italien wird das Konzept gut angenommen, wovon sich das Marathonfeld schon während des Rennens einen Eindruck verschaffen kann. Denn der Kurs führt mitten zwischen den Einkaufwilligen hindurch. Genau bei Kilometer dreizehn biegt man vom Parkplatz in die Mittelachse des künstlichen Dorfes ein, um sie einige hundert Meter später durch das Hauptportal zu verlassen.
 |
 |
| Die Überführung ermöglicht weite Ausblicke in die flache Landschaft | |
An dieser Stelle waren zur gleichen Zeit wie die Läufer in Salsomaggiore die Teilnehmer des als "Verdi Fidanza Village" bezeichneten zweitlängsten Rennens des Tages auf die Strecke geschickt worden. In manchen Dokumenten wird es noch als Dreißiger bezeichnet, doch in Wahrheit sind es eben doch nur ziemlich exakte neunundzwanzig Kilometer zum Ziel in Busseto, das die Schnellsten natürlich vor den ersten Marathonis erreichen werden.
Genau wie auf der neun Kilometer langen Strecke nach Fidenza sind dabei zwei Läufer zeitgleich. Zusammen laufen Pietro Cabassi und Mauro Cattaneo nach 1:44:13 über die Linie und zerreißen dabei gemeinsam das Zielband. Da beide unterschiedlichen Altersklassen angehören, ist es nicht ganz so schlimm, dass Cabassi am Ende als Gesamterster in der Ergebnisliste aufgeführt wird. Der Dritte Andrea Zambelli ist mit 1:48:11 als Gewinner der M40 schon vier Minuten langsamer als das Spitzenduo.
Bei den Damen machen die Altersklassenathletinnen die ersten Plätze unter sich aus. Sowohl Daniela Montanari, die in 2:17:10 als Erste einläuft, als auch die 2:20:48 benötigende Zweite Teresa Lopilato gehören der W40 an. Die nach 2:22:27 auf Rang drei einlaufende Ornella Bernardoni startet bereits in der W45. Doch ist dies für die italienische Laufszene eigentlich nichts wirklich Besonderes.
Denn wie hierzulande auch ist die Hauptklasse trotz deutlich mehr ihr zugeordneten Jahrgängen - beim Verdi-Marathon endet sie erst mit vierunddreißig - bezogen auf die Teilnehmerzahlen kaum noch halb so stark wie die jeweils nur fünf Jahre umfassenden Altersklassen von vierzig bis fünfzig. Da verwundert es kaum, wenn so mancher Gesamtsieg auch einmal an schnelle Senioren geht. Die erheblichen Nachwuchsprobleme des Laufsports sind längst in ganz Europa zu beobachten.
Das erste Drittel des Verdi-Marathons endet kurz nachdem man die Parkplätze und Zufahrten des Einkaufszentrums hinter sich gelassen hat. Es war der mit Abstand am dichtesten besiedelte Abschnitt der Strecke. Der zweite und dritte Teil werden zumeist wesentlich ländlicher ausfallen und manchmal tatsächlich einem Landschaftslauf nahe kommen, wie es die von den Organisatoren gelegentlich verwendete Bezeichnung "Ecomaratona" nahe legt.
Nun ist die nördliche Emilia als weite Ebene optisch eher unspektakulär. Und die Laufstrecke ist praktisch auch durchgängig asphaltiert oder in den Ortskernen zumindest gepflastert. Von einem Naturmarathon kann man also durchaus auch ein wenig andere Vorstellungen haben. Doch bekommt man unterwegs eben trotzdem einen ziemlich guten Eindruck von der "bassa parmense", der tiefer und nördlich der Via Emilia gelegenen Hälfte der Provinz Parma.
 |
 |
| In Fontanellato endet der Halbmarathon direkt vor der Wasserburg | |
Zwischen Feldern und Weiden ziehen sich im Zickzack etliche Nebenstraßen kreuz und quer durch die flache Flussniederung. Sie verbinden Städtchen, Dörfchen, Weiler und Einzelhöfe, die sich ohne klare Abgrenzungen über die Ebene verteilen. Selbst wenn die Bevölkerungsdichte im Verdi-Land recht gering ist, steht dennoch eigentlich immer irgendwo ein Haus.
Nur gelegentlich unterbrechen einmal Baumreihen die Offenheit des Landes. Meist handelt es sich dabei um Kopfweiden oder Pappeln, die schnell wachsenden Charakterbäume der fruchtbaren, aber eben auch feuchten Po-Ebene. Wälder oder selbst nur Wäldchen sucht man dagegen ziemlich vergeblich.
Unberührte Natur gibt es in dieser Gegend kaum. Ackerland dominiert das Bild. Fast jeder Hektar wird landwirtschaftlich genutzt. In genau diese Landschaft führt die Marathonstrecke nun hinaus. Lange Geraden fehlen von nun an. Immer wieder schlägt die Straße einen Haken, um irgendwie den nächsten im freien Feld stehenden Bauernhof anzusteuern.
Als einige von ihnen sich zu einer kleinen Gruppe zusammen finden, taucht die nächste Verpflegungsstelle vor den Läufern auf. Wie eigentlich immer im Mittelmeerraum hält man sich auch beim Verdi-Marathon an die Verbands-Vorgabe, die Versorgung im Abstand von ungefähr fünf Kilometern aufzubauen. Dazwischen gibt es dann jeweils noch einen Posten mit Schwämmen.
Diese - bei kühler oder nasser Witterung ansonsten oft eher überflüssig, aber eben vorgeschrieben und deshalb vorhanden - finden angesichts der für Ende Februar doch ziemlich hohen Temperaturen insbesondere zum Ende hin tatsächlich Abnehmer. Die fünfzehnte ist die bisher wärmste Auflage der Veranstaltung. Schließlich kratzt das Thermometer zum - am Ende dann doch nicht ganz so streng gehandhabten - Zielschluss nach fünf Stunden fast schon an der Zwanzig-Grad-Marke.
In der Vergangenheit hatte es das Quecksilber zwar während des Rennens meist in die zweistelligen Werte geschafft. Eine Garantie kann man bei einem so frühen Termin allerdings selbstverständlich nicht geben. Und so mussten sich die Läufer vor einigen Jahren auch schon einmal bei knackigem Frost an den Start begeben.
 |
 |
| Die Passage der trutzigen Befestigung ist einer der unbestrittenen optischen Höhepunkte der Strecke | |
Ganz so eng, wie es der Verband gerne hätte, sieht man es in der Emilia bei der Positionierung der Verpflegungsstellen dann aber doch nicht. Man sucht lieber einen logistisch günstigen Ort, als die Tische genau an den Kilometermarken aufzubauen. Fast immer liegt man dabei zu früh. Zum Ende hin ist es meist sogar um mehr als einen Kilometer. Doch ist das eigentlich eher ein Vorteil für die Teilnehmer, die nicht so lange auf die nächste Tränke warten müssen.
Ziemlich gut bestückt sind die Tische. Neben kaltem Wasser und lauwarmen Tee gibt es auch Elektrolytgetränke. Unter "Sali", also einfach "Salze" werden sie ausgegeben. Ihre grüne Farbe und die Geschmacksrichtungen Minze und Waldmeister sind allerdings eher ungewöhnlich. Wer Bedarf für feste Nahrung hat, findet unter anderem Bananen, Orangen und Kekse im Angebot.
"Grazie agli Alpini" bedankt sich eine Läuferin bei der fast ausschließlich aus Männern bestehenden Besatzung der Versorgungsstelle. Auf dem Kopf haben die Helfer nämlich den unverkennbaren Berghut mit der Feder, den die italienischen Gebirgsjäger, die "Alpini" als Teil ihrer Uniform tragen. Auch an den beiden Verpflegungsposten zuvor war dieses Kleidungsstück bereits häufiger zu sehen. Die durch die Bank schon etwas älteren Herren hinter den Klapptischen dürften also ehemalige Angehörige dieser Einheit sein.
Die Organisatoren des Marathons haben anscheinend starke Unterstützung bei einem Reservistenverein dieser weltweit ältesten militärischen Hochgebirgstruppe gefunden. Nun erscheint es im ersten Moment ziemlich seltsam, dass ausgerechnet in der Po-Ebene so viele Gebirgsjäger zu Hause sein sollen. Man hätte sie dann doch eher in den Alpen erwartet. Allerdings zählen die durchaus alpinen Charakter besitzenden Apenninen im südlichen Teil der Region zu den klassischen Rekrutierungsgebieten für eines der traditionsreichen Apini-Regimenter.
 |
 |
 |
| Von Fontanellato … | … führt die Strecke über Land … | … ins sechs Kilometer entfernte Soragna |
Über die größte Steigung der Strecke, die den Marathonläufern auf dem achtzehnten Kilometer bevorsteht, dürften sie deshalb dann auch nur schmunzeln. In einer weiten S-Kurve spannt sich eine Brücke über die Autostrada A1 und die parallel dazu verlaufende Schnellbahnstrecke Mailand-Bologna. Zwanzig Meter werden es bei wohlwollender Schätzung maximal sein. Doch der Anstieg zieht sich und kostet sehr wohl einiges an Kraft.
Belohnt wird man mit einem weiten Ausblick über die flache Landschaft, selbst wenn man deren Ausmaße von der kleinen Anhöhe natürlich nicht wirklich ermessen kann. In der Folge wird es nur noch dann ein paar mal leicht bergan gehen, wenn es wieder einmal gilt, einen der zahlreichen Gräben oder einen kleinen Bach zu überqueren.
Das kleine Straßendorf auf der anderen Seite der Brücke, das aus kaum mehr als ein bis zwei Dutzend Häusern besteht, heißt Cannetolo. Wieder einmal zu früh gibt es dort Getränke. Doch es riecht trotzdem nicht nach Tee oder Elektrolytgetränken. Durch die Luft zieht vielmehr der Duft von Schinken, ein Produkt für das die Provinz Parma ja berühmt ist.
Der Begriff "Parmaschinken" ist geschützt. Nur aus dieser Gegend darf er stammen. Nur wenige Schweinerassen sind erlaubt. Und auch das Herstellungsverfahren ist recht speziell. Denn der "Prosciutto di Parma" wird nicht geräuchert sondern in Hallen mit Fenstern zum Erzeugen von Durchzug luftgetrocknet. Da ist es dann auch kein Wunder, dass man unterwegs beim Passieren eines Bauernhofes gelegentlich den entsprechenden Geruch in der Nase hat.
Das zweite bekannte und ebenfalls markenrechtlich geschützte Produkt aus der Raum Parma, der Parmesankäse, italienisch "Parmigiano Reggiano" hat eine enge Verbindung zum Schinken. Die bei seiner Herstellung übrig bleibende Molke wird nämlich zur Fütterung genutzt und soll ein ganz besonderes Aroma bewirken. Ansonsten bekommen die Schweine nur noch Hafer und Gerste zu Fressen.
Auch das Städtchen Fontanellato beginnt für die Läufer mit einem Kreisel. Die Halbmarathonis läuten nun ihren Endspurt ein. Denn nur noch einen Kilometer wird die "Mezza Maratona di Fontanellato" dauern. Etwa die Hälfte davon besteht aus einer langen Geraden durch ein eher modernes Wohngebiet. Doch dann taucht die Strecke in den alten Ortskern ein.
 |
 |
 |
| Mitten auf dem zentralen Platz erhebt sich die Wasserburg Rocca Sanvitale | ||
Eine der bekanntesten Melodien Giuseppe Verdis empfängt die Läufer, diejenigen die ihr Rennen beenden werden und die denen noch eine zweite Halbzeit bevor steht, in den winkligen Gassen. Aus einer langen Reihe von Lautsprechern, die entlang der Strecke aufgebaut sind, ertönt der melancholische "Gefangenenchor aus Nabucco".
Zumindest im deutschsprachigen Raum ist die Komposition unter diesem Namen bekannt. Dort wo man sich auf Englisch verständigt, nennt man es dagegen eher "Chorus of the Hebrew slaves", den "Chor der hebräischen Sklaven". Denn die Oper handelt vom biblischen Thema der babylonischen Gefangenschaft des jüdischen Volkes und ihr Titel ist nichts anderes als eine Verkürzung von "Nebukadnezar", dem König Babylons. Mit diesem gleich am Anfang seiner Karriere entstandenen und 1842 uraufgeführten Werk gelang Giuseppe Verdi der große Durchbruch.
In Italien wird das berühmte Lied dagegen in der Regel mit der ersten Zeile "Va, pensiero, sull'ali dorate" bezeichnet. "Flieg, Gedanke, auf goldenen Flügeln". Worte, die auch in ganz anderen Zusammenhängen immer wieder zitiert werden. Ohnehin wird behauptet, der Chor sei in der Zeit des Risorgimento, der italienischen Einheitskriege eine Art heimliche Nationalhymne des noch gar nicht existierenden Staates gewesen. Der in diesem Sinne zu verstehende Text lässt diese Vermutung durchaus aufkommen. Wirkliche historische Belege dafür gibt es aber kaum.
Wesentlich verbürgter ist dagegen die in diesen Jahren verbreitete Aufschrift "Viva Verdi", die zwar auch dem zu einer Berühmtheit gewordenen Musiker huldigte, aber eben auch eine politische Botschaft war. Denn das "Verdi" ließ sich genauso gut als "Vittorio Emanuele Re d'Italia" interpretieren. "Es lebe Viktor Emmanuel, der König von Italien". Eine simple Methode sich in den zu diesem Zeitpunkt noch von anderen Fürsten beherrschten Gebieten für die Einheit der Stiefelhalbinsel auszusprechen, ohne sich dabei allzu weit aus dem Fenster zu lehnen.
Während also Nabucco aus den Boxen ertönt, schlägt der Kurs noch ein Haken über die Piazza Giuseppe Verdi vorbei am Theater des kleinen Städtchens. Rund hundertfünfzig Jahre hat das Haus in der mit allen Ortsteilen gerade einmal sieben- bis achttausend Einwohner zählenden Gemeinde schon auf dem Buckel und es wird weiterhin regelmäßig für Aufführungen genutzt.
Es ist keineswegs die einzige Bühne im Verdi-Land. Im etwas größeren Fidenza gibt es ebenfalls ein Schauspielhaus. Doch auch das mit Fontanellato in den Einwohnerzahlen vergleichbare Soragna schmückt sich mit einem "nouvo teatro". Und Busseto besitzt fast schon selbstverständlich ein Opernhaus, in dem die Stücke des größten Sohnes des Städtchens aufgeführt werden.
 |
 |
| Farbenfroh sind Häuser und Fresken in Fontanellato | |
Etwa dreihundert Plätze hat das in einem Seitentrakt des Rathauses untergebrachte "Teatro Giuseppe Verdi". Der Komponist habe sich einst vehement gegen seinen Bau ausgesprochen, ihn als überflüssig und nutzlos abgetan, wird berichtet. Obwohl es bereits 1868 fertig gestellt wurde und Verdi noch mehr als dreißig Jahre in seiner Nachbarschaft lebte, soll er das Theater nie betreten haben. Zu den großen Merkwürdigkeiten dieser Geschichte gehört allerdings, dass der große Meister dennoch einen beträchtlichen Geldbetrag zur Unterstützung der Arbeiten spendete.
Die Strecke führt aus den winkligen Gassen hinaus auf eine größere Freifläche. In der Mitte dieses zentralen Platzes erhebt sich eine trutzige Wasserburg mit Namen "Rocca Sanvitale". Rund um die spätmittelalterliche Befestigungsanlage gruppieren sich mit Laubengängen versehen Bürgerhäuser. Klein, aber ziemlich fein ist die Altstadt von Fontanellato. Und die Passage entlang der dicken Burgmauern stellt einen der unbestrittenen optischen Höhepunkte der Marathonstrecke dar.
Direkt vor der Wasserburg endet der Halbmarathon. Über wenig repräsentative Zieleinläufe darf man sich bei den Rennen im Rahmen des Verdi-Marathons ganz sicher nicht beklagen. Logistisch ist das nicht allzu problematisch. Denn insbesondere in den kleinen Ortschaften Fontanellato und Busseto sind es von dort nur wenige hundert Meter bis zum jeweiligen Sportgelände mit Umkleiden und Duschen. Und die Taschen mit der Wechselbekleidung kann man angesichts des vorhandenen Platzes sogar direkt nach dem Einlauf zurück geben.
Ziemlich genau die Hälfte des Feldes, nämlich knapp vierhundert Teilnehmer biegen in Fontanellato rechts in Ziel ab. Rund fünfhundert halten sich dagegen auf der linken Seite, um das Rennen fortzusetzen. Eigentlich ist das nicht allzu unübersichtlich. Und das Einsortieren der schon weit auseinander gezogenen Sportlerschar in die richtige Spur sollte kein Problem sein.
Dennoch kommen sich doch tatsächlich zwei Läufer beim Ausscheren so in die Quere, dass daraus eine wüste Schimpfkanonade entsteht und man angesichts des trotz eines letztendlich nichtigen Anlasses sofort überkochenden südländischen Temperaments schon befürchten muss, gleich würden die Fäuste fliegen. Die durch das unglückliche Kreuzen verloren gegangenen Sekunden, die doch der ursprüngliche Auslöser für den Streit waren, sind da plötzlich völlig nebensächlich. Ob man eine ähnliche Situation auch in Skandinavien erleben könnte? Wohl eher nicht.
 |
 |
 |
| Auch in Soragna ist die Altstadt mit Kirche und Schloss ziemlich sehenswert | ||
Keine Probleme hat diesbezüglich jedenfalls Adil Lyazali, der in 1:10:25 als Erster den Burgplatz von Fontanellato erreicht. Mehr als fünf Minuten läuft der Halbmarathonsieger auf Nicola Raimondo heraus, der in 1:15:46 als Zweiter folgt. Um Platz drei beharken sich Lino Uselli und Emanuel Marrangone. Am Ende hat dann Uselli in 1:17:12 zu 1:17:49 relativ klar die Nase vorn.
Noch wesentlich deutlicher als bei den Herren fällt das Ergebnis im Frauenrennen aus, wo die mit einer Zeit von 1:23:03 erfolgreiche Isabella Morlini volle zwölf Minuten warten muss, bevor Nadia Rinaldi (1:35:07) und Valeria Poltronieri (1:35:35) hinter ihr endlich das Siegertreppchen vervollständigt haben.
Die Marathonis sind nicht einmal einen Kilometer später schon wieder auf der Landstraße angekommen, die sie von Fontanellato nach Soragna bringen wird. Auf den kurvigen sechs Kilometern werden ihnen nur einige Bauernhöfe und ein Dutzend Autos begegnen. Einzig in Paroletta auf halben Weg hat man sich zu einer kleinen Siedlung zusammen gefunden. Doch viel mehr als eine Straßenkreuzung mit einer Handvoll Häusern, einem Restaurant und einer Kirche ist das eben auch nicht.
Die Haupt-Laufrichtung ist nun allerdings eine andere als zuvor. War man bisher praktisch ausschließlich nach Nordosten unterwegs, geht es nach der Wasserburg von Fontanellato nun tendenziell nordwestlich weiter. Denn der Kurs hat ungefähr die Form eines auf die Seite gekippten "V" mit der Halbmarathonmarke als Spitze.
Der schlanke, hohe Kirchturm ist schon ein markanter Orientierungspunkt, lange bevor man Suràgna - wie das nächste Etappenziel im emilianischen Dialekt heißt - tatsächlich erreicht. Während man dabei den offiziellen italienischen Namen noch einigermaßen erkennen kann, wird das im Falle von "Funtanlè" schon ein wenig schwerer. Denn es handelt sich dabei um das Städtchen, das man vor einigen Kilometern hinter sich gelassen hat, Fontanellato. Und der Zielort Busseto wird in der Gegend selbst mit "Büssé" oder "Busé" bezeichnet.
Die Unterschiede zwischen den Bezeichnungen sind beträchtlich. Und manchmal, wenn sich Einheimische unterhalten, hört sich das Ganze auch nur sehr bedingt nach Italienisch an. Aber die sich über fast die gesamte Stiefelhalbinsel ziehenden emilianisch-toskanische Apenninen sind eben neben einer topographischen Barriere zudem noch eine klar definierte Sprachgrenze.
 |
 |
 |
| Dem Kopfsteinpflaster der Hauptstraße … | … folgen Teppiche, auf denen das Marathonfeld … | … mitten durch das Schloss von Soragna läuft |
Nördlich davon wird das sogenannte Galloromanische - zu dem auch das Emilianische gehört - benutzt. In vielem sind diese Dialekte dem in Südfrankreich gesprochenen Okzitanisch näher als dem Standarditalienischen. Jenseits des Gebirges sind dagegen das Toskanische und Mittelitalienische verbreitet, die sich davon deutlich unterscheiden und aus denen sich die moderne italienische Hochsprache entwickelt hat.
Von manchen Lingiusten wird das Galloromanisch sogar als vollständig eigenständige Sprache betrachtet. Doch aufgrund der Vorherrschaft des Italienischen in den modernen Medien sind alle seine Dialekte deutlich auf dem Rückzug. Die UNESCO führt jedenfalls neben dem Emilianischen auch das Romagnol der Romagna, das Lombardische, das Piemontesische und das Ligurische auf der Liste der zunehmend bedrohten Sprachen.
Schon kurz nachdem man nach ziemlich genau zwei Dritteln der Distanz nach Soragna - oder eben Suràgna - hinein gelaufen ist, wird klar, dass auch dieses Städtchen zu den ziemlich Sehenswerten gehört. Die kopfsteingepflasterte Hauptstraße führt ebenfalls wieder an bunten und dicht gedrängten Bürgerhäusern mit den typischen Bögen vorbei. In den Straßencafés unter den Laubengängen haben es sich angesichts des frühlingshaften Wetters inzwischen etliche Passanten bequem gemacht.
So ähnlich stellt man sich italienische Kleinstädtchen tatsächlich irgendwie vor. Und in manchem Kinostreifen glaubt man solche Szenen schon einmal gesehen zu haben. Vermutlich auch in jener bekannten Film-Reihe, die in der Po-Ebene spielt und in amüsanter Form von der Rivalität zwischen einem katholischen Priester und einem kommunistischen Bürgermeister erzählt - Don Camillo und Peppone.
Diese beiden - wenn auch fiktiven - Berühmtheiten haben ihre Heimat nämlich ebenfalls im Verdi-Land. Ihr geistiger Vater Giovannino Guareschi wurde schließlich nur wenige Kilometer nördlich von Soragna und Fontanellato in der Gemeinde Roccabianca geboren. Und viele Jahre lebte er praktisch in direkter Nachbarschaft von Giuseppe Verdis Geburtshaus. Etlichen, die mit dem Komponisten nun wirklich überhaupt nichts anfangen können, dürfte der nicht nur verbal schlagkräftige Pfarrer sehr wohl ein Begriff sein.
Die Themen für seine Geschichten und die Vorbilder für seine Personen fand der Autor Guareschi praktisch direkt vor der Haustür. Denn die Emilia-Romagna zählte und zählt zu den traditionell politisch links stehenden Regionen. Anfänglich eine Hochburg der italienischen Kommunisten wählt man zwar inzwischen eher sozialdemokratisch, doch bürgerliche oder konservative Parteien bekommen bei Wahlen auch heute noch kaum einen Fuß auf den Boden.
 |
 |
 |
| Eine Treppe im Garten bringt die Läufer in die "Rocca Meli Lupi"… | … durch das Haupttor verlassen sie die Befestigungsanlage auf der anderen Seite anschließend wieder | |
Gedreht wurden die insgesamt fünf Filme mit dem französischen Komiker Fernadel als Don Camillo und Gino Cervi als Peppone sehr zum Leidwesen Guareschis allerdings nicht in seiner direkten Heimat. Vielmehr wählte das Produktionsteam das etwa vierzig Kilometer entfernte Städtchen Brescello in der benachbarten Provinz Reggio nell'Emilia als Schauplatz aus. Auch sechzig Jahre nachdem der erste und mehr als vierzig Jahre nachdem der letzte Film der Filme in die Kinos kam, profitiert man dort noch immer vom Don-Camillo-Tourismus.
Zehntausende Besucher werden auch weiterhin jedes Jahr verzeichnet, die sich mit der vor dem Rathaus stehenden lebensgroßen Statue des dickköpfigen Bürgermeisters ablichten lassen können. Vor der Kirche hat man als Gegenstück ein Abbild des nicht minder sturen Priesters errichtet. Sogar ein mit allerlei übrig gebliebenen Requisiten bestücktes Museum gibt es. Dort wo die Geschichten der beiden sympathischen Streithähne eigentlich entstanden ist, setzt man dagegen notgedrungen auf Verdi.
Der Marathonkurs schwenkt nach rechts und taucht durch ein von Schwalbenschwanzzinnen gekröntes Tor in einen großen Garten ein. Blaue und rote Teppiche sind auf den ungepflasterten Wegen verlegt und führen die Läufer zu einer kleinen Treppe an der Rückwand eines massigen Bauwerks. Diese ist nach nun schon mehr als achtundzwanzig absolvierten Kilometern natürlich ein ziemlicher Rhythmusbrecher.
Doch ist sie die Mühe durchaus wert. Denn nachdem man die Tür am Ende der Stufen passiert hat, befindet man sich auf einmal im langen Flur eines Schlosses. Die "Rocca di Soragna" heißt zwar noch "Burg", doch eigentlich handelt es sich dabei weniger um eine mittelalterliche Festungsanlage als um einen Renaissance-Palast, zu dem sie im sechzehnten Jahrhundert umgebaut wurde.
Noch immer ist das Schloss von der Familie Meli Lupi bewohnt und wird deshalb alternativ auch als "Rocca Meli Lupi" bezeichnet. Und so ist es schon recht ungewöhnlich, dass man den Marathon sogar mitten durch das Haupthaus hindurch führen kann. Auf eine solche Idee muss man jedenfalls erst einmal kommen. Für einen weiteren ziemlich spektakulären Rennmoment sorgt sie auf jeden Fall.
Am anderen Ende des Ganges läuft man in den - noch immer teppichbedeckten - Schlosshof hinaus, um die Rocca wenig später durch das Hauptportal wieder zu verlassen. Der kleine Platz, den man dabei betritt, liegt zwar ein wenig abseits der Durchgangsstraße. Dennoch ist er das eigentliche Zentrum des Städtchens. Denn nicht nur der Adelspalast findet sich hier sondern in direkter Nachbarschaft auch noch das Rathaus und die barocke Pfarrkirche San Giacomo.
 |
 |
| Rathaus, Kirche und Schloss liegen in Soragna direkt nebeneinander | |
Wenig später wird die in diesem Bereich vollkommen geschlossene Bebauung durch einen Torbogen wieder verlassen. Gerade einmal ein Kilometer war nötig, um Soragna komplett zu durchqueren. Doch Eindrücke konnte man dabei definitiv genug sammeln. Ein Reiz des Verdi-Marathons besteht sicher in diesem stetigen Wechsel zwischen einer weiten, offenen Landschaft und den dichtgedrängten Ortschaften, die sich jeweils als neue Etappenziele anbieten.
Am schmalen Sträßchen, das die Läufer aus dem Städtchen hinaus bringt, lassen sich Markierungen des Verdi-Radweges entdecken, der ähnlich wie der Marathon die Orte und Sehenswürdigkeiten der Gegend miteinander verbindet. Im flachen Land der Po-Ebene kann man so sicher auch nicht völlig austrainierte Touristen zu ein wenig sportlicher Betätigung bewegen.
Der "percorso cicloturistico Verdi" gehört zu den gemeinschaftlichen Projekten der "Unione terre verdiane", in der sich neben den vom Marathon berührten Gemeinden auch noch einige andere Kommunen zusammen geschlossen haben. Unter anderem gehören dazu auch Guareschis Geburtsort Roccabianca und Villanova sull'Arda, wo Giuseppe Verdi in der "Frazione" Sant'Agata ein Haus besaß, in dem er jahrzehntelang lebte. Bis zu dieser wenige Kilometer von Busseto entfernt gelegenen "Villa Verdi" kommt der Marathonkurs übrigens nicht.
Man könnte meinen die Laufveranstaltung sei von diesem Gemeindeverbund als Marketingaktion ins Leben gerufen worden. Doch die zeitliche Reihenfolge ist genau anders herum. Der Verdi-Marathon ist einige Jahre älter als die Union. Und vielleicht hat ja gerade die Zusammenarbeit der Verwaltungen bei der Organisation des Rennens sogar dazu beigetragen, die Gründung des kommunalen Zusammenschlusses zu forcieren.
Jenseits des Verkehrskreisels, an dem die nicht unbedingt vielbefahrene Umgehungsstraße von Soragna gequert wird, führt die Strecke auf einem kleinen Sträßchen weiter, das eigentlich kaum mehr als ein besserer Feldweg ist. Selbst wenn auch dieser Abschnitt des Kurses nicht vollständig gesperrt ist, gibt es selbstverständlich keine Probleme mit vorbei kommenden Fahrzeugen. Denn Durchgangsverkehr gibt es keinen. Wer auf diesem schmalen Asphaltband unterwegs ist, will zu einem der wenigen unterwegs gelegenen Höfe.
Mehr als sechs Kilometer läuft man so von Bauernhof zu Bauernhof, von Baumreihe zu Baumreihe, von Kilometermarke zu Kilometermarke ohne dass es wirklich langweilig würde. Die kleinen Zwischenziele am Wegesrand, die man stets für einige Minuten anpeilen kann, bevor man sie dann tatsächlich erreicht, und immer wieder leicht veränderte Perspektiven sorgen für ausreichend Abwechslung in der doch eigentlich gar nicht so spannenden Landschaft.
 |
 |
| Nachdem man Soragna verlassen hat … | … geht es wieder kilometerlang durch die landwirtschaftlich geprägte Ebene |
Hinter Kilometer fünfunddreißig wird die Bebauung dann langsam wieder etwas dichter. Und irgendwann ertönt aus Lautsprechern, die an den neben dem Sträßchen stehenden Strommasten montiert sind, eine andere berühmte Melodie Verdis, die auch Nichtopernkennern etwas sagt, der sogenannte "Triumphmarsch" aus dem im alten Ägypten spielenden Werk Aida.
Im Jahr 1871, also fast dreißig Jahre nach dem Durchbruch Nabucco wurde diese bekannte Oper uraufgeführt. Und zwar passend zum Thema im neuen Opernhaus von Kairo. Während das eine Werk, das man sofort mit Giuseppe Verdi in Verbindung bringt also eines der Ersten aus seiner Feder ist, gehört das andere zu seinen letzten. Nur noch zwei weitere Opern schrieb der Komponist nach Aida - und diese beiden ungefähr zwei Jahrzehnte später.
Das, was man gemeinhin unter dem "Triumphmarsch aus Aida" versteht, ist eigentlich nur ein kurzer Abschnitt, kaum mehr als ein paar Takte aus dem Mittelteil einer insgesamt rund zwölf Minuten langen Komposition. Und so hat man entlang der langen Reihe von Lautsprechern, von denen die Marathonis in das kleine Dörfchen Roncole hinein geführt werden, sich auf die allseits bekannte "Marcia trionfale" einzustellen.
 |
 |
| Nur gelegentlich unterbrechen Baumreihen, Gräben und kleine Bäche die Offenheit der Landschaft | |
Inzwischen heißt Roncole offiziell "Roncole Verdi". Denn in diesem Ortsteil von Busseto wurde der Komponist im Oktober 1813 geboren. Das niedrige, gedrungene Bauernhaus, in dem er das Licht der Welt erblickte, ist eher unscheinbar. Angeblich wollte Giuseppe Verdi es sogar abreißen lassen, weil ihm seine Herkunft aus so ärmlichen Verhältnissen peinlich war. Stünde davor nicht eine Büste des berühmten Musikers, es ließe sich - obwohl einer der "Höhepunkte" des Verdi-Marathons - durchaus übersehen.
Ein über die Straße gespannter Heißluft-Bogen sorgt jedoch dafür, dass nun auch wirklich keiner der Läufer den Blick nach rechts auf das Gebäude, in dem sich inzwischen ein kleines Museum befindet, verpasst. Gleich nebenan wäre auch das Wohnhaus von Giovannino Guareschi, in dem man ebenfalls eine kleine Ausstellung besuchen kann.
Doch natürlich bleibt Verdi bei "seinem Lauf" die Hauptperson. Direkt gegenüber steht die Kirche, in der Verdi getauft wurde und in deren Unterlagen der älteste schriftliche Vermerk über ihn existiert. Am 11. Oktober 1813 trug der Pfarrer nämlich dort ein, dass er einen "am vorherigen Abend" geborenen Buben getauft hätte. Der eigentliche Geburtstag des Komponisten ist aufgrund dieser nicht völlig eindeutigen Aussage bis heute umstritten.
Sowohl der Neunte als auch der Zehnte stehen zur Auswahl. Und beide Daten lassen sich in den Biografien entdecken. Zu jener Zeit war es nämlich durchaus üblich, das Ende eines Tages mit dem Sonnenuntergang zu definieren. Verdi selbst gab jedenfalls angeblich stets den 9. Oktober als seinen Geburtstag an.
Noch knapp sechs Kilometer gilt es zu bewältigen, als man Roncole Verdi auf der anderen Seite wieder verlässt. Erneut ist es eines jener für die Gegend so charakteristischen schmalen Sträßchen, das die Läufer aufnimmt. Und bis man auf eine Straße einbiegt, die wieder einen Mittelstreifen hat, sind zwei weitere Kilometerschilder passiert. Das Ziel hat man spätestens von dieser Ecke an, endgültig vor Augen.
 |
 |
| Guiseppe Verdis Geburtshaus wird auf dem siebenunddreißigsten Kilometer passiert | |
Denn von nun an geht es direkt auf Busseto zu. Und neben der Kirche lässt sich da auch noch der ein wenig an eine Burg erinnernde Turm des Rathauses erkennen. Dieses steht zwar tatsächlich auf dem Grundmauern der "Rocca Pallavicino", doch wurde es im neunzehnten Jahrhundert vollständig im neogotischen Stil umgebaut. Und genau zwischen diesen beiden Türmen wird man das Rennen später beenden.
Zuerst muss man allerdings noch an einem anderen Campanile vorbei. In Spigarolo, einem kurz vor Busseto gelegenen, nur aus wenigen Häusern bestehenden, aber eben dennoch mit einer Kirche ausgestatteten Ortsteil, beginnen die letzten beiden Kilometer. Ein wenig groß für so wenige Schäfchen wirkt diese Chiesa allerdings schon.
Kurz darauf taucht am Straßenrand eine große Tafel in der typischen, international üblichen braunen Farbe touristischer Beschilderung auf. Doch nicht etwa die Heimat Guiseppe Verdis wird damit angekündigt. Vielmehr sind darauf unter anderem mehrere Fotos eines in eine Soutane gekleideten Herren mit markanten Gesicht zu sehen.
Es handelt sich natürlich um Fernandel in seiner Paraderolle als Don Camillo. Und die Beschriftung über den Bildern verkündet, dass das emilianische Städtchen mit dem französischen Carry-le-Rouet, dem Wohnort des Schauspielers verschwistert sei. Selbst in Busseto dreht sich eben nicht alles nur um Verdi.
Kurz nachdem man den Ortsrand erreicht hat, verlässt die Marathonstrecke die Hauptstraße und biegt in ein relativ neues Wohngebiet ab, durch das man dem Stadtzentrum weiter entgegen strebt. Wirklich beeindruckend ist das zwar nicht, doch immerhin laufen die Marathonis durch das "Musikviertel" Bussetos.
 |
 |
 |
| An der Kirche von Spigarolo (mitte) beginnen die letzten beiden Kilometer, die nach dem Durchqueren der Altstadt von Busseto (rechts) vor dem Verdi-Denkmal am Rathaus (links) enden | ||
Alle Straßen sind nämlich nach Komponisten benannt. Unterwegs ist man zum Beispiel auf der Via Wolfgang Amadeus Mozart. Da gibt es eine Via Schubert, eine Via Ravel, eine Via Sibelius und eine Via Gershwin. Und eine der Seitenstraßen hat man sogar nach Verdis großem Konkurrenten Richard Wagner benannt.
Eine den Durchlass auf beiden Straßenseiten deutlich verengende Wellblechwand gibt Rätsel auf. Und wenig später ist man endgültig überrascht, als sich unzählige verkleidete Menschen um riesige Motivwagen versammeln. Quer zur Laufrichtung scheint sich da gerade ein Karnevalsumzug zu formieren. Dabei ist der Aschermittwoch doch schon vorbei.
In Busseto interessiert das allerdings niemanden. Denn der Carnevale de Busseto ist nicht vom ständig wechselnden Ostertermin abhängig sondern wird immer an den vier Sonntagen im Februar gefeiert. Das erklärt dann auch das Konfetti, das man auf dem Weg zur Bushaltestelle im Kopfsteinpflaster der Altstadtgassen bemerken konnte. Gleich nach dem Ende des Marathons wird sich wie jedes Jahr der Zug in Bewegung setzen, was einen weiteren Grund für den nach fünf Stunden angesetzten Zielschluss liefert.
Die Wellblechwände, die auch an allen anderen Zugängen zur Innenstadt aufgebaut sind und nur wenige Durchgänge haben, dienen dazu die Zuschauer an den Kassierern vorbei zu lotsen. Und die strömen von überall herbei. Viele von ihnen sind ebenfalls verkleidet. Das Ganze erinnert tatsächlich an die großen Rosenmontagszüge in den Hochburgen nördlich der Alpen. Einzig die Temperaturen wollen nicht so ganz passen.
Einige der Wagen, die da durch das kleine Busseto rollen, müssen den Vergleich mit den rheinischen Karnevalshochburgen nun auch wahrlich nicht scheuen. Fünf, sechs, sieben Meter hoch sind sie zum Teil. Viele haben auch bewegliche Teile, schaukeln und drehen sich. Unzählige Stunden Arbeit haben die Wagenbauer da wohl hinein gesteckt. Und ein solches Monstrum mit dem Traktor mitten durch die nicht übermäßige Hauptstraße der Altstadt zu ziehen, verlangt mit Sicherheit einiges an Fahrkunst.
 |
 |
 |
| Während anderswo die tollen Tage schon längst vorbei sind, zieht direkt nach dem Marathon in Busseto noch ein Karnevalsumzug durch die Stadt | ||
Doch während der Karnevalsumzug diese ebenfalls wieder mit Laubengängen versehene zentrale Achse wenig später in voller Länge durchlaufen wird, dürfen sie die Marathonis auf ihren letzten Metern nur schnell einmal kreuzen. Man könnte nämlich beinahe behaupten, dass der Zieleinlauf durch die Hintertür erfolgt.
Über kleine Seitengässchen schleicht man sich ans Rat- und Opernhaus an, um dann mit dem Gebäude und dem davor postierten Verdi-Denkmal im Rücken über einen roten Teppich ins Ziel zu laufen. Nicht immer verliefen die letzten Meter so. Früher steuerte man durch die Hauptstraße auf Guiseppe Verdi zu. Doch dann drehte man den Zieleinlauf um. Den Fotografen kann es nur recht sein, sie bekommen so die eindrucksvolleren Bilder. Für die Läufer selbst ist es aber zugegebenermaßen deutlich weniger imposant.
Antonio Armuzzi dürfte das allerdings eher weniger interessieren. Denn in 2:26:27 gewinnt er den Verdi-Marathon in ziemlich überlegener Manier. Mehr als eine Viertelstunde legt er zwischen sich und dem auf Platz zwei einlaufenden Alberto Felloni, den man in 2:42:17 stoppt.
Danach geht es aber Schlag auf Schlag. Denn Giulio Lorenzo auf Rang drei folgt in 2:43:08 nur unweit dahinter. Die 2:43:29 sowie 2:44:28 laufenden Mattia Magnani und Martino Massignani müssen sich mit den Bezeichnungen Vierter und Fünfter begnügen.
Der nördlich der Alpen vielleicht bekannteste Name in der Ergebnisliste steht bei den Frauen ganz oben. Ultraspezialistin Monica Casiraghi reichen 3:01:30 zum Erfolg. Ihre ärgste Verfolgerin Cecilia di Benedetto schafft immerhin eine 3:07:21. Und auch Simona Giuliani (3:08:50) auf Rang drei und Maria Ilaria Fossati (3:09:08) auf Platz vier bleiben noch unter drei Stunden und zehn Minuten.
 |
 |
 |
| Kopfsteingepflasterte Gassen bestimmen die letzten Meter | ||
Obwohl die absoluten Spitzenzeiten fehlen, ist das Niveau in der Breite also gar nicht so schlecht. Auch fünfundzwanzig Zeiten unter drei Stunden sind dafür ein Beleg. Da muss man hierzulande bei Veranstaltungen ähnlicher Größenordnung manchmal doch mit deutlich bescheideneren Werten Vorlieb nehmen. Der Verdi-Marathon bietet jedenfalls eine durchaus gelungene Mischung zwischen Leistungs- und Breitensport.
In den fünfzehn Jahren seines Bestehens hat sich das Konzept sehr wohl bewährt. Dass man dennoch gelegentlich an den Rahmenwettbewerben herum bastelt, hängt wohl eher mit dem Versuch zusammen, neue Teilnehmerkreise und damit ein paar zusätzliche Einnahmen zu erschließen.
Ins Unermessliche wachsen kann die Veranstaltung ohnehin nicht. Das lassen die lokalen Gegebenheiten in den kleinen Städtchen der Emilia gar nicht zu. Der Platz ist begrenzt, Umkleiden und Duschen sind in eher bescheidener Zahl vorhanden, die Bustransfers lassen sich nicht beliebig erweitern. Und manche gelungene Idee wäre gar nicht mehr umsetzbar, wenn das Wachstum zu stark würde Tausende von Teilnehmern dürfte man wohl kaum noch durch das Schloss von Soragna leiten können.
 |
 |
 |
| Das Marathonziel befindet sich auf dem zentralen Platz von Busseto mit Kirche, Rathaus und Verdi-Theater | ||
Dennoch kann und sollte man den Verdi-Marathon sehr wohl weiter empfehlen. Man muss nicht einmal Opernfreund sein, um dabei seinen Spaß zu haben. Allerdings sollte man nicht gerade auf der Suche nach einem "Mega-Event" sein. Denn dann dürfte man in der weiten, offenen und manchmal auch eher einsamen Po-Ebene vielleicht doch nicht unbedingt aus seine Kosten kommen.
Im nächsten Jahr feiert man in Busseto und Umgebung, in den loughi verdiani und den terre verdiane auf jeden Fall den zweihundertsten Geburtstag des großen Komponisten. Und man darf sicher gespannt sein, was sich die Macher des durch die Heimat von Giuseppe Verdi führenden Marathons dazu einfallen lassen. Ganz ohne neue Ideen werden sie dieses besondere Jubiläum wohl kaum vorüber gehen lassen.
 |
Bericht und Fotos von Ralf Klink Ergebnisse und Infos www.verdimarathon.it Zurück zu REISEN + LAUFEN – aktuell im LaufReport HIER |
 |
© copyright
Die Verwertung von Texten und Fotos, insbesondere durch Vervielfältigung
oder Verbreitung auch in elektronischer Form, ist ohne Zustimmung der LaufReport.de
Redaktion (Adresse im IMPRESSUM)
unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes
ergibt.