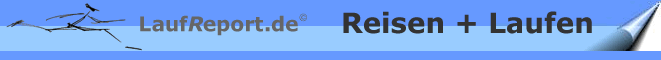

 |
 |
 |
 |
 |
 |
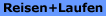 |
 |
 |
 |
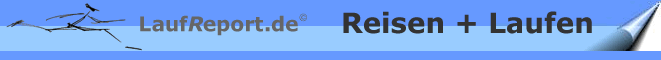 
|
 |
29. Maratona Ticino
|
 |
|
von Ralf Klink
|
Wer "Schweiz" hört, dem kommt dabei meist erst einmal "Heidi" und "Matterhorn" in den Sinn. Man stellt sich glückliche Kühe auf sattgrünen Wiesen im Sommer vor. Man sieht wedelnde Skifahrer auf schneebedeckten Hängen im Winter vor sich. Die Fels- und Eisriesen der Alpen prägen einfach das Bild dieses Landes, obwohl sie eigentlich nur ungefähr die Hälfte seiner Fläche einnehmen.
Höchstens noch Bankgeheimnis und Nummernkonten verbindet man ansonsten mit der Eidgenossenschaft. Klischees sicherlich. Doch werden diese eben auch von den Schweizern selbst gerne gepflegt. Aber Palmen? Das will ja nun so überhaupt nicht in diesen Rahmen passen. Die gibt es doch höchstens in den Tropenhäusern von botanischen Gärten, oder?
 |
 |
| Ein goldenes Oktoberwochenende mitten im November | Palmen und schneebedeckte Gipfel kann man im Tessin beinahe in direkter Nachbarschaft begegnen |
"Falsch gedacht", muss man da allerdings antworten, denn es gibt in der vermeintlichen Hochgebirgsnation sehr wohl eine Region, in der diese Gewächse - selbst wenn sie dort nicht ursprünglich heimisch sind - ziemlich gut gedeihen. Die Rede ist vom Tessin, jenem Kanton südlich des Alpenhauptkammes, in dem die Eidgenossenschaft doch ziemlich italienisch daher kommt.
Nicht nur dass die Kantonsgrenzen zu Italien länger sind als zum Rest der Schweiz, nicht nur dass Landschaft, Vegetation und zudem noch die Architektur manchmal schon recht südländisch aussehen, man spricht dort schließlich auch Italienisch.
Neben einigen kleineren Tälern in Graubünden, die sich ebenfalls in südliche Richtung hin öffnen, bildet der Ticino, wie die Region in der Landessprache heißt, den größten Teil der sogenannten "Italienischen Schweiz".
Schon beim ersten Blick auf die Karte sticht das Tessin ins Auge. Gemeinsam mit dem im Nordosten angrenzenden Misox, der Bündner Talschaft des Val Mesolcina, ragt es fast in Form eines spitzwinkligen Dreiecks, das ans eigentliche Kernland der Eidgenossenschaft angesetzt wurde, weit nach Süden heraus. Die Spitze des Dreieckes bei Chiasso ist zugleich auch der südlichste Punkt der Schweiz.
Bei genauerem Hinsehen wirkt das Gebilde sogar irgendwie noch unlogischer. Dass dabei nicht etwa der Gebirgskamm der Hochalpen und damit die Hauptwasserscheide eine Art natürliche Südgrenze der Schweiz bildet, wie man es zum Beispiel größtenteils bei dem im Westen anschließenden Kanton Wallis vorfindet, lässt sich zwar auch noch in Graubünden beobachten.
Doch im Süden des Tessins gibt es auch noch zwei große Seen, deren Grenzlinien ziemlich verwirrend sind. Im Falle des lang gestreckten Lago Maggiore, dessen nördliches Ende zur Schweiz gehört, während der größte Teil italienisch ist, kann man sie vielleicht sogar noch einigermaßen nachvollziehen.
 |
 |
 |
| Sowohl hohe Berge als auch exotischen Pflanzen findet man am Lago Maggiore reichlich vor | ||
Beim weitverzweigten Lago di Lugano wird die Situation dann allerdings endgültig unübersichtlich. Der komplette östlichste Zipfel gehört nämlich zu Italien, während im mittleren Teil das Tessin die nördlichen und südlichen Ufer einnimmt. Weiter im Westen verläuft die Grenze dann aber wieder genau durch den See, so dass der Südwesten erneut italienisch ist.
Und zu allem Überfluss gibt es da mitten im Schweizer Territorium auch noch die italienische Enklave Campione. Die Zufälligkeit und Willkürlichkeit, die den oft über viele Jahrhunderte gewachsenen Grenzziehungen in Europa meist zugrunde liegt, lässt sich im Tessin jedenfalls ziemlich anschaulich darstellen.
Der Luganersee trennt also den äußersten Süden vom Rest des Kantons ab, der auf dem Landweg eigentlich nur über italienisches Staatsgebiet zu erreichen wäre. Erst durch den Seedamm von Melide quer über den See wurde im neunzehnten Jahrhundert eine künstliche Verbindung errichtet. Der komplette Bahn- und Autoverkehr zwischen Süd- und Nordteil des Tessins rollt nun über diese Kombination von Damm und Brücke.
Betrachtet man nur die Karte des Tessins würde man im ersten Moment vermuten, dass der südlichere und damit weiter von den Alpen entfernte Lago di Lugano auch in bezug auf die Höhe unterhalb des Lago Maggiore liegt.
Doch reicht dieser nach dem Gardasee zweitgrößte unter den Oberitalienischen Seen eben auch viel weiter in die Ebene des Po hinaus.
Und so muss das Flüsschen Tresa, das den Luganersee entwässert, auf seinem nur fünfzehn Kilometer langen Verlauf noch runde achtzig Höhenmeter verlieren, bis es in den Lago Maggiore münden kann. Dessen Seeufer ist deshalb mit 193 Metern über dem Meeresspiegel nicht nur die niedrigste Stelle im Kanton Ticino sondern gleichzeitig auch noch der tiefste Punkt der ganzen Schweiz.
Während bezüglich der höchstgelegenen Strecke durchaus ein gewisser "Wettbewerb" zwischen den Laufveranstaltern möglich ist und ein solcher gelegentlich auch schon einmal ausgetragen wurde, hat ein Marathon am Lago Maggiore wegen dieser Tatsache in umgekehrter Hinsicht natürlich keine Konkurrenz in der Schweiz zu fürchten. Weiter hinunter geht es im Land eben nicht.
"Maratona Ticino" nennt sich die seit 1983 ununterbrochen ausgetragene Veranstaltung. Im ersten Moment erscheint dieser Alleinvertretungsanspruch vielleicht ein wenig übertrieben. Denn in einem Kanton, der zum einen etwas größer als das Saarland und zum anderen ziemlich vielfältig und touristisch interessant ist, wären ja sehr wohl weitere Läufe über diese Distanz denkbar. Doch ist man eben tatsächlich der einzige in der Region und kann die Bezeichnung also durchaus zu Recht führen.
 |
 |
| Dicht bebaut sind inzwischen die Sonnenhänge oberhalb des langgestreckten, von einem Gletscher aus dem Gestein geschliffenen Sees | |
Ginge man mit dem Namen des Start- und Zielorts auf Werbetour, gäbe es auch deutlich mehr Erklärungsbedarf. Denn "Tenero" dürfte wohl nur den Wenigsten außerhalb der Tessiner oder zumindest der Schweizer Grenzen wirklich etwas sagen. Da hat das knapp fünf Kilometer entfernte Städtchen Locarno, das man während des Rennens ebenfalls passiert, dann doch einen ganz anderen Bekanntheitsgrad. "Locarno Marathon" wäre angesichts des doch relativ kurzen Abschnittes im Stadtgebiet allerdings wohl auch nicht wirklich korrekt.
Aber auch die Ortschaft Tenero ist nicht unbedingt Zentrum des Laufes. Eigentlich bekommt man den Dorfkern nicht einmal richtig zu Gesicht. Denn Start und Ziel finden sich ein Stück außerhalb im "Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero", das nicht nur durch die Eisenbahn und eine Schnellstraße vom Hauptteil der Kommune abgetrennt ist sondern selbst beinahe die Ausmaße einer eigenen Gemeinde hat.
Ein halbes Dutzend Rasenplätze und mehrere Sporthallen umfasst der Komplex des Nationalen Jugendsportzentrum, eine Leichtathletikanlage mit Tartanbahn und ein Schwimmbad, Tennisplätze und eine Kunstrasenfläche, Sandplätze für Beach-Volleyball oder -Soccer. Über das Vorhandensein von Kletterwänden müsste man in einer Alpennation wie der Schweiz eigentlich sowieso kein Wort verlieren.
Und am angrenzenden See bieten sich natürlich auch Möglichkeiten für Ruderer, Kanuten und Segler. Ja sogar für eher exotische Sportarten wie Rollhockey gibt es Spielfelder. Kaum eine Disziplin, die man im CST - wie der fast endlos erscheinende offizielle Name in der Regel abgekürzt wird - nicht betreiben könnte.
Da wundert es kaum noch, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft 2008 während der Europameisterschaften in der Schweiz und Österreich ihr Trainingsquartier am Lago Maggiore aufgeschlagen hatte. Und vielleicht hat der eine oder andere deshalb den Namen "Tenero" hierzulande doch schon einmal gehört.
Eventuell sollte man jetzt zur Aussprache des Ortes doch einmal ein Wort verlieren. Die ist anhand des Schriftbildes nämlich keineswegs eindeutig zu erkennen. Da sowohl im Deutschen wie auch im Italienischen mit dem Buchstaben "e" zwei verschiedene Laute dargestellt werden, gäbe es dafür schließlich gleich vier verschiedene Varianten.
Das erste "e" ist im Fall von Tenero stimmhaft, das zweite stimmlos. Die Betonung ist also anders als beim römischen Kaiser Nero. Mit Hilfe der französischen Akzente, die eine gewisse Unterscheidung beider Vokale möglich machen, ließe sich der Name zur Klarstellung vielleicht am Besten "Ténèro" schreiben.
Das Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero bietet jedenfalls eine Infrastruktur, nach der sich viele Veranstalter die Finger lecken würden. Umkleidekabinen und Duschen gibt es vor Ort genauso wie genug Raum für die Startnummernausgabe in einer der Hallen. Parkplätze sind ebenfalls ausreichend vorhanden. Und von der auch am Sonntagmorgen aus beiden Richtungen im Halbstundentakt angefahrenen Bahnstation sind es nur einige Gehminuten.
Dafür sind allerdings Start und Einlauf dann auch wenig spektakulär. Ohnehin ist der Charakter des Rennens eher nüchtern und auf den rein sportlichen Aspekt ausgerichtet. Mit neumodischen "Events" hat das Ganze wenig zu tun. Wer nur Zuschauerspaliere, Partystimmung und möglichst viele Musikkapellen an der Strecke sucht, ist im Tessin definitiv fehl am Platz. All das lässt sich nämlich dort nicht finden.
Alleine die Tatsache, dass es im Ziel keine Medaille gibt, hat durchaus etwas Bezeichnendes. Immerhin ist ein Funktions-T-Shirt im fünfundvierzig Franken betragenden Startgeld enthalten. Für die Halbmarathonläufer, die auf dem Zwei-Runden-Kurs nur eine Schleife absolvieren, ist die Meldung mit vierzig Fränklis auch nicht sehr viel günstiger. Die Nachmeldegebühr hält sich mit fünf Franken dagegen ziemlich im Rahmen.
Der große Reiz dieses Marathons besteht also weniger in seiner unvergleichlichen Atmosphäre als vielmehr in der Tatsache, dass man zu einer Zeit, in der anderswo bereits Nässe und Kälte des Novembers dominieren und manchmal sogar schon der Winter vorbei geschaut hat, noch einmal unter in der Regel recht angenehmen Laufbedingungen auf die Strecke gehen kann.
Südlich des Alpenhauptkammes, der eben nicht nur eine Wasser- sondern auch eine Wetterscheide ist, fällt das Klima schließlich in der Regel deutlich milder aus als auf der anderen Seite des Gebirges. Nicht umsonst ist die "Alpensüdseite" in Schweizer Wetterberichten ein fester Begriff und ein Punkt, auf den man wegen der dort oft völlig anders ausfallenden Witterung noch einmal separat eingehen muss.
 |
 |
| Die Kirche San Quirico (links) und das Cà di Ferro mit seinem Wehrturm finden sich in Minusio praktisch direkt am Seeufer | |
Vor kalten Nordwinden durch die Bergriesen ziemlich geschützt jedenfalls bleiben die Temperaturen am Lago Maggiore auch im gesamten Winterhalbjahr zumeist eindeutig im positiven Bereich. Und im November hat man Durchschnittswerte, wie sie nördlich der Alpen eher im Oktober verzeichnet werden. Eine Schönwettergarantie gibt es natürlich nicht.
Und nur wenige Tage vor dem Marathon gingen in Südfrankreich und Norditalien dann auch schwere Regenfällen nieder, die an einigen Orten sogar zu Überschwemmungen führten. Im Ticino hatte es dabei ebenfalls heftige Niederschläge gegeben. Binnen kürzester Zeit war dort die Wassermenge des ganzen Monats gefallen. Größere Schäden bleiben allerdings zum Glück aus.
Am Laufwochenende präsentiert sich der Tessiner November jedoch von seiner besten Seite. Nachdem sich der Dunst über dem See am Samstagmorgen aufgelöst hat, zeigt sich für die nächsten beiden Tage praktisch kein Wölkchen mehr am klaren Himmel. Und bei zweistelligen Höchsttemperaturen hat das Ganze tatsächlich etwas von Altweibersommer.
Doch ist der Rasen der Fußballplätze noch von Reif bedeckt, als die ersten Läufer sich sonntags im Sportzentrum einfinden. Die auch im Süden zu dieser Jahreszeit erheblich längeren Nächte zeigen eindeutig ihre Wirkung. Um 9:15 soll der Marathon und die erste Welle des Halbmarathons gestartet werden. Drei weitere Startgruppen der quantitativ deutlich stärker besetzten kurzen Distanz sollen danach im Abstand von jeweils zehn Minuten noch folgen.
Als sich die Sonne etwa eine Dreiviertelstunde vor dem Start dann aber hinter den Bergen hervor gekämpft hat, wird es schnell deutlich wärmer. Sie hat dafür aber ganz schön zu tun, denn das Gelände rund um den See steigt ziemlich abrupt um fünfzehnhundert bis zweitausend Meter nach oben. Man sieht dem Lago Maggiore an, dass es wie viele andere Seen am Alpenrand von einem Gletscher aus dem Fels heraus geschliffen wurde und er deshalb so etwas wie ein kleiner Bruder der norwegischen Fjorde ist.
Dagegen ist es rund um das Sportzentrum im völligen Kontrast dazu bretteben. Denn am Nordende des Sees erstreckt sich zwischen Wasser und Hochgebirge, zwischen Locarno - oder genauer gesagt Tenero - im Westen und der Kantonshauptstadt Bellinzona im Osten auf einer Breite von mehreren Kilometern die sogenannte Magadinoebene.
Die Fläche, die ihren Namen vom an ihrem Rand gelegenen Örtchen Magadino hat, ist durch das Schwemmmaterial entstanden, das der in diesem Bereich in den Lago Maggiore mündende Fluss Ticino von seinem langen, im Gotthardmassiv beginnenden Weg mitgebracht und abgelagert hat. Dieses früher versumpfte Delta hat man inzwischen weitgehend trocken gelegt und den Wasserlauf, der dem ganzen Kanton den Namen gegeben hat, kanalisiert.
 |
 |
| Ruhig liegt der Lago Maggiore in der Dämmerung | |
Das dadurch entstandene Land wird nun zu intensivem Ackerbau genutzt, der in den steil aufragenden umliegenden Bergen natürlich nicht möglich ist. Dieser Piano di Magadino ist auch dafür verantwortlich, dass der Tessin Marathon trotz der alles andere als ebenen Umgebung dennoch zu den flachsten Läufen über diese Distanz in der Schweiz zählt. Mit gerade einmal zweiunddreißig Metern zwischen tiefstem und höchstem Punkt kann man durchaus mit Stadtmarathons mithalten.
So stellt der Lauf dann auch eine ziemlich ungewöhnliche, aber interessante Mischung dar, die sich in keine der gängigen Kategorien so wirklich einzuordnen lässt. Landschaftlich beeindruckend, aber trotzdem fast topfeben, völlig städtische und rein ländliche Abschnitte im Wechsel. Ein Marathon, der von allem etwas hat, im sich daraus sofort ergebenden Umkehrschluss aber auch nichts so richtig ist.
Die noch immer tiefstehende Sonne färbt die zum Greifen nah scheinenden Berge hinter dem Hauptgebäude des Sportkomplexes rötlich, als sich die Marathonis und die erste Gruppe der Halbdistanzler direkt davor zum Start versammeln. Dem Sprecher, der die Ankommenden anfangs irrtümlich zum dreißigsten Marathon im Ticino begrüßt hatte, ist wohl sein Lapsus inzwischen gesteckt worden. Jedenfalls ruft er die Teilnehmer nun korrekt zur neunundzwanzigsten Auflage, der "ventinovesima editione" an die Linie.
Auch auf Deutsch, Englisch und Französisch erfolgen die Ansagen. Allerdings sind sie gelegentlich doch ein wenig holprig. Und sogar in der deutschen Variante der Ausschreibung lassen sich einige kleine Fehler entdecken. Selbst in der offiziell mehrsprachigen Schweiz ist natürlich nicht jeder Bürger in allen Landessprachen absolut perfekt.
Trotzdem hat man als Besucher auch ohne allzu große Italienischkenntnisse im Ticino praktisch kaum Probleme. Denn die meisten Tessiner sind des Deutschen eben zumindest ein bisschen mächtig. Ein paar italienische Brocken - und seien sie nur "Boungiorno", "Grazie", "Prego" oder "Scusi" - können in den entsprechenden Situationen selbstverständlich dennoch nicht schaden.
Punkt Viertel nach neun wird die erste Gruppe auf die Strecke entlassen. Die Uhren gehen genau im Ticino. Denn auch wenn sich in vielem schon ein wenig von südländischer Leichtigkeit spüren lässt, ist die Svizzera italiana in dieser Hinsicht eben doch eindeutig ein Bestandteil der Schweiz. Alles hat hier seine Ordnung. Die Straßen sind sauber, die Grünanlagen gepflegt, die Züge fast immer auf die Minute pünktlich.
Und die Busse, die beinahe noch die kleinste Ortschaft im hintersten Tal ansteuern sind gelb lackiert und werden von einer Tochtergesellschaft der Schweizer Post betrieben. Sogar die Aufschrift "AutoPostale" ist nichts anderes als die wörtliche Übertragung des deutschschweitzer "PostAuto". Es ist bei weitem nicht das einzige im Tessin benutzte Lehnwort, das man im Standarditalienischen in dieser Form nicht kennt.
 |
 |
| Das Nationale Jugendsportzentrum von Tenero ist Start- und Zielort des Marathons | Eine lange Gerade durch die Felder der Magadinoebene bestimmt die ersten Kilometer |
Die Rechtskurve, die nur wenige Meter hinter dem Startbereich folgt, ist sicher einer der Gründe dafür, die Läufer in mehreren Gruppen nacheinander ins Rennen zu schicken. Genau wie die zur Sicherheit mit Strohballen gepolsterte Schranke an der Einfahrt wenig später. Bei zwei- bis dreihundert Marathonis und mehr als tausend Kurzstrecklern wäre diese Stelle für den gesamten Pulk wohl tatsächlich viel zu eng.
Vorbei an Parkplätzen führt die Strecke auf diesen ersten Metern, um anschließend Kurs auf zwei Hochhäuser zu nehmen, die ziemlich unvermittelt aus der Ebene aufragen. Bis zu diesen wenig gelungen und in die Landschaft passenden Feriendomizilen kommt man allerdings nicht. Denn schnell erfolgt ein weiterer Schwenk nach links, der die Läufer zur Brücke über das Flüsschen Verzasca bringt, das nicht weit entfernt in den Lago Maggiore mündet.
Der Überführung über den Wasserlauf folgt direkt anschließend eine Unterführung zum Passieren der Autobahn. Und kaum ist Kilometer eins passiert, hat sich das Sträßchen auch schon zu einem Feldweg gewandelt, der sich schnurgerade und praktisch ohne jeden Höhenunterschied durch den Piano de Magadino zieht.
Auf beiden Seiten ist die Ebene von Höhenzügen begrenzt. Kaum mehr als zwei, drei Kilometer wären es wohl bis dorthin. Und auch an ihrem ein Stück weiter entfernten hinteren Ende ragen die Berge in einem scheinbar geschlossenen Ring bis zu zwei Kilometer über sie hinauf. Dort schlägt der Ticino einen Neunzig-Grad-Bogen und dreht von nord-südlicher auf ost-westliche Fließrichtung.
Dort wo der Tessin - der Fluss wird im Gegensatz zum Kanton auch im Deutschen meist mit einem männlichen Artikel versehen, im Italienischen sind dagegen beide schon mangels eines grammatischen Neutrums maskulin - in die weiter werdende Ebene austritt, liegt die Hauptstadt Bellinzona. Mehrere hohe Felsen in der Mitte des Tales verengen dort den ohnehin nicht gerade breiten Durchlass zusätzlich, so dass der Platz schon zur Römerzeit eine strategische Bedeutung hatte.
 |
 |
| Im Palazzo della Conferenza wurden in den Zwanzigerjahren die Verträge von Locarno abgeschlossen | Die Piazza Grande ist der zentrale Platz in Locarno |
Neben dem zum Gotthardpass führenden Tal des Ticino, kann man von diesem Punkt nämlich auch noch das kurz hinter Bellinzona abzweigende Val Mesolcina zum San Bernardino und das weiter flussaufwärts einmündende Valle di Blenio über den Lukmanierpass kontrollieren. Da verwundert es eigentlich nicht, dass die Stadt insbesondere im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert etliche Male mehrfach den Besitzer wechselte.
Gleich drei Burgen bewachen in Bellinzona die Engstelle. Das Castelgrande mitten
in der Stadt auf einem Felsrücken etwa fünfzig Meter über dem
Talboden, das auf einem Hangvorsprung oberhalb des Zentrums errichtete Castello
di Montebello und das noch weiter am Berg gelegene Castello di Sasso Corbaro.
Zusammen mit der sie verbindenden Wehrmauer, durch die man das Tal vollkommen
abriegeln konnte, gehören diese größtenteils erhaltenen und
restaurierten Befestigungsanlagen zum UNESCO-Welterbe.
Nur gute zwanzig Kilometer von Locarno entfernt bietet sich die Kantonshauptstadt für einen Ausflug in Mittelalter geradezu an. Oder auch für einen Zwischenstopp bei An- oder Abreise. Schließlich müssen fast alle, die aus dem Norden ins Tessin kommen, sowieso am Verkehrsknoten Bellinzona vorbei. Nur aus Richtung Wallis gibt es mit dem Simplonpass und dem damit verbundenen Abstecher nach Italien noch eine weitere Alternative.
Es entbehrt übrigens nicht einer gewissen Ironie, dass alle drei Burganlagen vom Herzogtum Mailand errichtet wurden, um die über den Gotthard immer weiter nach Süden vorstoßenden Eidgenossen abzuwehren. Doch nur wenige Jahre nach der endgültigen Fertigstellung des Festungsgürtels waren sie bereits in deren Besitz gewechselt und dienten von nun an dazu, die Mailänder ihrerseits von den Pässen fern zu halten.
Zwar standen die Tessiner - ein Oberbegriff, den es zu jenes Zeit noch gar nicht gab, da die Region in wesentlich kleinere Herrschaftsgebiete aufgeteilt war - während des ein ganzes Jahrhundert andauernden Ringens, zum Teil durchaus auf Seiten der Eidgenossen. Doch gleichberechtigte Partner waren sie dabei keineswegs. Vielmehr blieben die gewonnenen Gebiete lange Zeit von Vögten verwaltetes Untertanenland.
Auch das ist eine Ironie der Geschichte, führt doch die Schweiz ihre Entstehung laut dem eigenen Gründungsmythos ausgerechnet auf die Rebellion gegen die Habsburger und ihren Landvogt Gessler zurück. Keine zweihundert Jahre später beherrschte man bereits selbst die ersten der sogenannten "Ennetbirgische Vogteien" - Vogteien jenseits der Berge. Mit dem "einig Volk von Brüdern" war es wohl zumindest anfangs doch nicht so wirklich weit her.
 |
 |
| Nach gut vier Kilometern leitet ein Linksbogen dann langsam den Rückweg ein, … | ... auf dem sich der Marathonkurs erst einmal an der die Ebene querenden Bahnlinie orientiert |
Neben der Leventina, dem oberen Tal des Ticino, die im alleinigen Besitz des Kantons Uri war, handelte es sich dabei um mehrere "Gemeine Herrschaft" - was nichts mit der heutigen Interpretation von "gemein" zu tun hat, sondern vielmehr "gemeinsam" bedeutet. In verschiedenen Kombinationen wurden diese nämlich von den jeweils an ihrer Eroberung beteiligten Kantonen regiert.
In Bellinzona waren das nur die drei Urkantone. Und so konnten sich Uri, Schwyz und Unterwalden die drei Burgen für ihre Vögte und die dazu gehörende Garnison untereinander aufteilten. Deshalb trugen die Befestigungen für einige Zeit auch die Namen Castello d'Uri, Castello di Svitto und Castello di Unterwalden.
Die Vogtei Luggarus, die dem heutigen Bezirk Lugano entspricht - auch fünfhundert Jahre später spiegelt die Verwaltungsgliederung des Tessin die damalige Situation weitgehend wider - und in der man beim Tessin Marathon unterwegs ist, wurde dagegen gleich von zwölf der dreizehn "Orte", die damals die Eidgenossenschaft bildeten, beherrscht.
Ohne Kurve geht es kilometerlang zwischen abgeernteten Feldern, dazwischen errichteten Bauernhöfen und einzelnen Baumgruppen immer geradeaus in Richtung der im Osten immer höher steigenden Sonne. Nur eine weitere Unterführung bringt ein wenig Veränderung ins weitgehend gleichförmige Bild und außerdem auch eine Handvoll Höhenmeter.
Für etwas Abwechslung sorgen höchstens noch die Kleinflugzeuge, die vereinzeltet auf dem rechter Hand gelegenen "Aeroporto Cantonale di Locarno" starten oder landen. Im Linienbetrieb wird der Flugplatz allerdings nicht angesteuert. Einzig und allein der Flughafen Lugano bietet aus dem Tessin einige Verbindungen nach Zürich, Genf und Rom.
Bereits Kilometer vier ist passiert, als ein Linksbogen dann doch langsam den
Rückweg einleitet. Grob gesprochen hat die Strecke nämlich die Form
einer ziemlich platt gedrückten Acht. Sie lässt sich also in eine
Ost- und eine Westschleife aufteilen, zwischen denen man bei Hälfte jeder
Runde ganz nahe an Start und Ziel vorbei kommt.
Für einige hundert Meter orientiert sich der Marathonkurs nun an der Bahnlinie, die an dieser Stelle die Ebene quert. Ansonsten sind die Gleise allerdings weitgehend an den Hängen verlegt, die den Piano de Magadino begrenzen, denn die Strecke wurde bereits etliche Jahre vor der Flussbegradigung und Trockenlegung des sumpfigen Deltas vollendet.
Auch die Ortschaften liegen alle ein wenig höher am Rande der lange Zeit weitgehend unzugänglichen Fläche. Langsam wachsen sie allerdings nun doch in die Ebene hinein, wie es auch das wie die meisten seiner Artgenossen optisch wenig ansprechende Industriegebiet verdeutlicht, das nach fünf Kilometern erreicht wird.
 |
 |
| Ein halbes Dutzend Kirchen (hier die Pfarrkirche Sant'Antonio Abate) findet man in der Altstadt | Etliche Villen belegen die frühere Bedeutung Locarnos als Nobelferienort |
So wirklich will es nicht in die Landschaft - und vor allem ins Bild, das man von Hochgebirge im Kopf hat - passen. Doch nicht nur im Tessin sondern auch anderswo im Alpenraum werden die wenigen ebenen Flächen immer stärker mit Gewerbeanlagen und Verkehrswegen zugebaut. Nur von Idylle allein kann man schließlich schlecht leben.
Die Urlauber, die doch angeblich auf der Suche nach unberührter Natur sind, tragen durchaus ein gehöriges Maß dazu bei. Schließlich will man doch so schnell und bequem wie möglich in die Berge kommen. Und ein angemessenes Quartier hätte man ja auch gerne. Alleine in der Region um Locarno ist die Zahl der Hotels dreistellig.
Zersiedelt ist die Gegend trotzdem. Einzelne, klar voneinander abgegrenzte Ortschaften sind eigentlich nicht mehr zu erkennen. Und weiterer Zuwachs ist zu erwarten. Denn die kleinen Bergdörfer in den Seitentälern haben ein immer stärkeres Problem mit Entvölkerung und Überalterung. Hauptsächlich die Jungen ziehen weg in die Städte. Inzwischen leben von den nur etwa dreihundertfünfzigtausend Tessinern bereits mehr als dreihunderttausend in den Ballungsräumen rund um Lugano, Bellinzona und Locarno.
Es ist durchaus bezeichnend, dass das Industriegebiet von Riazzino und die angrenzende Siedlung verwaltungstechnisch nur eine kleine Exklave des viel weiter hinten im Verzascatal gelegenen Gemeinde Lavertezzo darstellen. Doch längst hat die ehemalige Winterweide in der tiefer gelegenen Ebene das eigentliche Dörfchen bezüglich der Einwohnerzahl weit abgehängt.
Auf der nun wieder deutlich breiteren Straße vor den Werkshallen ist nach gut fünf Kilometern dann auch die erste Verpflegungsstelle aufgebaut. Diesen Abstand wird auch in der Folge ungefähr eingehalten, so dass man auf dem Zwei-Runden-Kurs mit gerade einmal vier Versorgungsposten auskommen kann. Obwohl das Quecksilber im Laufe des Rennens auf klar über zehn Grad klettern wird, ist die Dichte durchaus ausreichend. Schließlich ist bei einem Lauf im November selbst im Tessin kaum noch mit einer Hitzeschlacht zu rechnen.
 |
 |
| An den Seiten ist die Ebene von Höhenzügen begrenzt, die sie um fünfzehnhundert bis zweitausend Meter überragen | |
Dass man sich auf Seite der Veranstalter durchaus auch auf ungemütlichere Herbstwitterung vorbereitet hat, zeigt der warme Tee, der an den "posti di rifornimento" ausgeschenkt wird. Neben den praktisch überall üblichen weiteren Flüssigkeiten Wasser und Elektrolytgetränk sowie Obst reichen die Helfer zusätzlich noch die für die Eidgenossenschaft so typische und eben auch in der Svizzera italiana ziemlich beliebte Limonade Rivella, deren Produzent allerdings auch einer der wichtigsten Sponsoren ist.
Über die Straße, die man vorhin unterquert hatte, geht es nun an
einem von der Polizei gut bewachten Kreisel direkt hinweg. Die Sicherung des
Marathonkurses ist wirklich vorbildlich. Selbst auf den Feldwegen ist praktisch
jede Einmündung von einem oder zwei Ordnern überwacht. Und auf dem
westlichen Teil der Acht, in dem man dichter bewohntes Gebiet durchläuft,
ist die Zahl der Streckenposten noch deutlich größer. Die zahllosen
aufgestellten Hütchen und eher in Kilometern als in Metern zu rechnenden
Flatterbänder muss man da eigentlich kaum noch erwähnen.
Hinter dem Kreisel nimmt das Sträßchen wieder eher den Charakter eines Feldweges an. Und auch das in einer Links-Rechts-Kombination im Abstand von wenigen hundert Metern erfolgende zweimalige Abbiegen ändert daran wenig. Auch für die nächsten beiden Kilometer bleibt die Strecke noch ziemlich ländlich.
Diese Distanz festzustellen wird allerdings zunehmend schwerer. Waren die ersten Kilometer noch jeweils mit einer großen Tafel markiert, besteht die Kennzeichnung inzwischen nämlich nur noch aus mit roter Farbe auf die Straße gesprühten Zahlen. Diese sind natürlich schnell einmal übersehen. Nur alle fünf Kilometer wird im weiteren Verlauf noch ein Schild stehen. Und die letzten vier Tausend-Meter-Abschnitte vor dem Ziel werden auch wieder einzeln gekennzeichnet sein.
Manchmal erscheinen die Ziffern auf dem Asphalt zudem ein wenig sprunghaft zu sein, was allerdings auch daran liegen könnte, dass alte Marken von früheren Austragungen für Verwirrung sorgen. Denn obwohl das Grundkonzept der Strecke seit vielen Jahren eigentlich gleich geblieben ist, ergibt sich alleine schon durch die im Laufe der Zeit anfallenden Baumaßnahmen natürlich immer wieder einmal eine kleine Änderung am genauen Verlauf.
Die schlecht auszumachenden und manchmal auch nicht ganz stimmig wirkenden Markierungen sind ein kleines Detail, das der fast schon legendären Schweizer Präzision zu widersprechen scheint. Doch über die korrekte Länge der Gesamtdistanz muss man sich wohl dennoch keine Gedanken machen. Schon viele Male wurden im Ticino die Schweizer Landesmeisterschaften ausgerichtet. Und dass die Marathon-Titel des Kantons regelmäßig bei dieser Veranstaltung vergeben werden, ist angesichts ihrer regionalen Konkurrenzlosigkeit sowieso logisch.
Da man nun in genau entgegengesetzter Richtung unterwegs ist, haben natürlich auch die Bergketten zu beiden Seiten ihre relative Position getauscht. Obwohl beide auf den ersten Blick ziemlich ähnlich aussehen, werden sie dennoch ganz unterschiedlich eingeordnet. Denn die Madaginoebene gehört zu jener recht deutlich definierten Linie, durch die die eigentlichen Hoch- und südlichen Voralpen voneinander getrennt werden.
Während die nördliche, nun rechts von den Marathonis gelegene Gruppe deshalb in der Regel den "Tessiner Alpen" oder "Lepontinische Alpen" zugerechnet wird, bezeichnet man die südlichen Berge als "Luganer Voralpen". Während diese die Zweitausend-Meter-Marke meist nicht mehr übertreffen können, geht es schon wenige Kilometer nördlich des Piano de Magadino fünfhundert Meter höher hinaus.
Doch zerschneidet die Bergreihe linker Hand eben auch den Kanton Ticino in zwei Teile. Der Monte Ceneri-Pass ist nämlich der einzige Übergang - oder angesichts einer Höhe von gerade einmal 554 Metern vielleicht besser der einzige Durchlass - zwischen diesen beiden auf Schweizer Gebiet. Und entsprechend sind die ziemlich ungleichen Hälften auch benannt.
Das wesentlich größere, noch ziemlich alpin geprägte Nordtessin heißt nämlich "Sopraceneri" - auf Deutsch ungefähr "über dem Ceneri". Und die deutlich flachere südliche Region rund um den Luganer See ist unter "Sottoceneri" - also "unter dem Ceneri" - bekannt. Obwohl sie nicht einmal ein Fünftel der Gesamtfläche einnimmt, leben dort jedoch weit über fünfzig Prozent der Tessiner Bevölkerung. Dass damit die Madaginoebene und der Lago Maggiore, also der tiefstgelegene Teil der Schweiz streng genommen zum "Über-Ceneri" gehören, ist schon etwas paradox.
Im Zuge des Ausbaus der Bahnverbindung zwischen der restlichen Schweiz und
dem Ticino sowie Norditalien durch den Gotthardbasistunnel wird auch unter dem
Ceneri-Pass, zu dem die Züge bisher noch einmal erneut mehr als zweihundert
Meter klettern mussten, an einem neuen fünfzehn Kilometer langer Tunnel
gearbeitet.
Er soll allerdings erst zwei bis drei Jahre nach der für 2016 geplanten Inbetriebnahme des inzwischen vollständig fertig gebohrten längsten Tunnels der Welt, der vom Vierwaldstädter See aus das gesamte Alpenmassiv auf weit mehr als fünfzig Kilometern ohne größere Höhenunterschiede durchquert, eröffnet werden. Eine ganze Stunde schneller soll man dann mit dem Zug ins Tessin gelangen.
Mehr oder weniger direkt hinter dem letzten Bauernhof schließt sich eine Wohnsiedlung an. Sie gehört zum jenseits der Bahnlinie am Hang gelegenen Ortschaft Gordola, die sich an dieser Stelle allerdings zungenartig in die Ebene hinein schiebt. Der Marathonkurs schlägt nach acht absolvierten Kilometern einen Bogen um sie herum und erreicht dabei wieder die Verzasca, der er immer entlang der ersten Häuserreihe für einige hundert Meter flussaufwärts folgt. Dort führt eine schon leicht futuristisch anmutende Fußgängerbrücke ans andere Ufer.
 |
 |
| Auf einer leicht futuristischen Fußgängerbrücke wird nach acht Kilometern das Flüsschen Verzasca überquert | |
Der Wasserlauf unterhalb des durch die Auf-und-Ab-Bewegungen der Marathonis leicht schwankenden Steges scheint trotz des relativ breiten Bettes ziemlich ausgetrocknet. Von den nur ein Woche zuvor gefallenen schweren Regenfällen ist nicht viel zu sehen. Allerdings sorgt der nur wenige Kilometer entfernte Lago di Vogorno, dessen mehr als zweihundert Meter aufragende Staumauer eine der höchsten des ganzen Landes ist, für eine Regulierung.
Erst vor wenigen Jahren wurde die Passerelle mit dem markanten Doppelstahlbogen eröffnet und anschließend dann auch in die Streckenführung der "Maratona Ticino" - der im Deutschen männliche Marathon ist in der italienischen Sprache weiblich - eingebaut, die dadurch sich in ihrem Charakter von einer Pendel- eher zu einer Rundstrecke wandelte. Zuvor wurden die beiden Anfangskilometer nämlich in umgekehrter Richtung erneut gelaufen. Nun kann man einen anderen Weg wählen.
Zum Abschluss der ersten Schleife gibt erneut die Bahnstrecke die Richtung vor. An dem neben ihr verlaufenden Feldweg steht nicht nur einer Tafel mit der Ziffernfolge "30", wenig später ist auch eine "9" auf den Asphalt gepinselt. Langsam nähert man sich zwar damit auch wieder dem Start- und Zielbereich. Doch wirklich zu Gesicht bekommt man ihn nach der Streckenänderung nicht mehr. Das Sportzentrum versteckt sich hinter der Schnellstraße.
Dabei ist man nach einer kurzen, etwas skurril anmutenden Passage vorbei an der Lieferrampe auf der Rückseite eines Einkaufszentrums genau auf der anderen Seite des direkt zum Centro sportivo führenden Fußgängertunnels gelandet. Zumindest alle, die mit dem Zug angereist waren, kennen diesen Zugang recht gut. Mit einigen wenigen Schritten wäre man von dort aus schon am Zielbogen angelangt.
 |
 |
| Kurz bevor man nach Abschluss der ersten Schleife wieder ganz nahe an Start und Ziel vorbei kommt, gibt erneut die Bahnstrecke die Richtung vor | |
Doch die Strecke schwenkt erst einmal parallel zur "Autostrada" ein, um bald darauf zwischen mehrere Wohnblocks einzutauchen, die sich bei Kilometer zehn in den schmalen Streifen zwängen, der auf der einen Seite von der Straße und auf der anderen Seite vom Bahnhof begrenzt wird. Auch Tenero, wächst zumindest dort, wo zwischen den Verkehrswegen noch etwas Platz bleibt, vom Hang in die Ebene hinein.
Das aus Feldsteinen errichtete Haus, das man wenig später passiert, als der Marathonkurs zum dritten Mal die Bahnlinie ein Stück begleitet, steht dazu in einem seltsamen Kontrast. Jenen typischen Tessiner Baustil, bei dem meist auch das Dach mit Steinplatten gedeckt ist, sieht man in der doch recht verstädterten Region zwischen Locarno und Bellinzona inzwischen eher selten. Meist dominieren moderne Zweckbauten das Gesamtbild. In den kleinen Gebirgsdörfern der Seitentäler begegnet man diesem gedrungen wirkenden Häusertyp noch wesentlich öfter.
Daneben stehen einige Reihen Rebstöcke. Dass in dieser Gegend mit ihren
sonnenbeschienenen Südhängen im Wetterschutz der Alpen Weinbau betrieben
wird, kann eigentlich wenig überraschen. Meist sind es rote Merlot-Beeren,
die man im Tessin erntet. Die Doppelgemeinde Tenero-Contra - der Ortsteil Contra
liegt weiter oben am Berg - ist jedenfalls nicht nur bekannt für einen
guten Tropfen, sie führt sogar Weintrauben inklusive einer Rebenschere
im Wappen.
Dort wo sich Bahn und Schnellstraße immer näher kommen, bevor sie kurz darauf beide für einige Zeit im Berg verschwinden, taucht die Laufstrecke an einem Fußgängertunnel unter der Autostrada hindurch. Der Radweg auf der anderen Seite ist mit Absperrbändern der Länge nach geteilt. Das kurze Begegnungsstück, das man auf dem Rückweg noch einmal zu Gesicht bekommen wird, endet schon wieder an der Zufahrt zu dem dabei gerade umrundeten kleinen Parkplatz.
Denn der Weg nach Locarno führt die Marathonis hinauf zur alten Hauptstraße, von der die in einem langen Tunnel abgetauchte Autobahn abgelöst worden ist. Da man inzwischen das Ende des Piano de Magadino erreicht hat und die Berge direkt ans Seeufer heran gerückt sind, verläuft sie ein wenig oberhalb am Hang.
Auch dieser Abschnitt ist noch nicht allzu lange im Streckenplan verzeichnet. Früher verlief der Kurs in beide Richtungen auf dem Seeuferweg, zu dem man nun aus einigen Metern hinab blickt und den man dann erst später genauer in Augenschein nehmen kann. Die durch die Änderung neu gewonnene Abwechslung wird allerdings durch einige weitere leichte Anstiege erkauft. Denn die gesamte Höhendifferenz der Runde wird auf den nächsten zwei Kilometern überwunden.
 |
 |
 |
| Vorbei an der Kirche San Vittore und südländischer Vegetation geht es ins Stadtzentrum von Locarno hinein | ||
Solange die Läufer auf der in diesem Abschnitt vierspurigen Via San Gottardo bleiben, ist für sie eine der Fahrbahnen komplett abgesperrt. Direkt daneben rollt der Verkehr aus Locarno heraus. Nachdem man wenige Minuten später in die erste einmündende Nebenstraße eingebogen ist, kann dann allerdings wieder die gesamte Breite des Asphaltes genutzt werden.
Die Umgebung hat endgültig städtischen Charakter angenommen und wird diesen nun auch für längere Zeit behalten. Links und rechts der Laufstrecke ist durchgängige Bebauung. Mehrgeschossige Wohnblöcke bestimmen das Bild entlang der in leichten Wellen immer geradeaus führenden Straße, der man nun zwei Kilometer lang folgen wird.
Obwohl es so aussieht, ist man eigentlich noch nicht in Locarno angekommen. Vielmehr durchläuft man die Gemeinde Minusio, die noch nicht einmal wirklich an das wesentlich bekanntere Städtchen grenzt. Doch längst sind rund ein halbes Dutzend politisch selbstständiger Ortschaften in der Umgebung zu einer einzigen großen Stadt zusammen gewachsen. Die Übergänge bemerkt man höchstens noch am Eingangsschild.
In der meist ziemlich kleinteilig angelegten administrativen Gliederung der Schweiz begegnet man solchen Phänomenen ziemlich oft. Denn Eingemeindungen und Gemeindefusionen, die in Deutschland in der Vergangenheit oft von oben einfach durchgedrückt wurden, müssen in der recht basisdemokratisch verfassten Eidgenossenschaft in der Regel von den betroffenen Bürgern durch ein Referendum gebilligt werden.
Und nicht immer werden die Vorschläge auch wirklich gebilligt. Die Bildung einer in den Medien meist als "Gross-Locarno" bezeichneten neuen Kommune, die sich mehr an den Stadtgrenzen im rein geographischen Sinn, also dem zusammen hängenden bebauten Gebiet orientieren und deshalb bis Tenero-Contra reichen sollte, wurde zum Beispiel von den Bewohnern der einzugliedernden Orte erst vor Kurzem mehrheitlich abgelehnt.
So gibt es im Moment noch mehr als zweieinhalbtausend Gemeinden in der Schweiz, während das sogar etwas größere und ähnlich bevölkerte deutsche Bundesland Niedersachsen nicht einmal die Hälfte davon zählt. Selbst im fast die doppelte Fläche und Einwohnerzahl umfassenden Bayern, wo man sich traditionell mit Gebietszusammenlegungen ebenfalls eher schwer tut, reicht man nicht an die eidgenössischen Zahlen heran.
Manche der Kommunen sind dabei regelrecht winzig. Auch im Tessin findet man eine Reihe von Gemeinden, die über wenige Dutzend Bewohner nicht hinaus kommen, insbesondere natürlich in den alpinen Regionen. Umgekehrt gibt es dafür aber einige Orte, deren Verwaltungsgebiet nicht einmal einen Quadratkilometer umfasst. Die Comune di Muralto, in die man zum Ende der Gerade hinein läuft, gehört zur zweiten Kategorie.
 |
 |
 |
| Rund um die Piazza Giovanni Pedrazzini stehen Villen vom Beginn des letzten Jahrhunderts | ||
Das unter einer Brücke rauschendes Wasser zeigt deutlich, dass man inzwischen an Höhe gewonnen hat. Denn die vom Hang auf der rechten Seite herunter kommenden Kaskaden setzen sich nach links zum See hinunter noch ziemlich weit nach unten fort. Doch bald darauf dürfen auch die Marathonis wieder mit viel Schwung den Weg bergab antreten.
Denn dort, wo die Straße beginnt nach rechts weg zudrehen, hält sich die Strecke links und biegt in eine Nebenstraße ab. Vorbei an der im Kern bereits aus dem elften Jahrhundert stammenden romanischen Kirche San Vittore senkt sich der Kurs langsam dem Lago Maggiore entgegen. Der im Gegensatz zu vielen anderen oft recht schlanken und grazilen Kirchtürmen im Tessin doch eher wuchtige Campanile wurde allerdings erst später ergänzt und - bei genauerem Hinsehen deutlich erkennbar - in den Dreißigerjahren noch einmal umgebaut.
Eine Brücke führt über die im Gegensatz zur Schnellstraße, die als Ortsumgehung erst auf der anderen Seite Locarnos ihren Tunnel verlässt, längst wieder im Freien verlaufende Bahnlinie. Diese endet kurz darauf in einem Kopfbahnhof, denn sie ist nur eine kurze Stichstrecke, die das schon im neunzehnten Jahrhundert als Urlaubsort beliebte Locarno an die von Bellinzona direkt nach Lugano führende Gotthardbahn anbindet.
Die Station firmiert auch unter der Bezeichnung "Locarno". Doch betreibt man dabei eigentlich einen ziemlichen Etikettenschwindel. Der Bahnhof liegt nämlich gar nicht auf dem Boden der Gemeinde, deren Namen sie trägt. Die Marathonis, die parallel zu den Gleisen ihren vierzehnten Kilometer beenden, sind vielmehr noch immer in Muralto unterwegs.
Selbst wenn die Normalspurstrecke der SBB, der Schweizerischen Bundesbahnen, im in der Fremde gelegenen Bahnhof von Locarno endet, kann man dennoch von dort mit dem Zug weiter reisen. Die meterspurige Centovallibahn führt über unzählige Brücken und durch etliche Tunnels mehr als fünfzig Kilometer weit ins italienische Domodossola, wo sie auf die Simplonlinie, die in Wallis führende zweite Hauptachse durch die Schweizer Alpen trifft.
 |
 |
 |
| Vom Bahnhof führt die Strecke hinunter zu einem kurzen Begegnungsstück an der Uferpromenade | ||
Doch zu sehen ist von ihr im ersten Moment überhaupt nichts. Die früher wie eine Straßenbahn mitten durch Locarno verlaufende Strecke ist schließlich inzwischen im Stadtgebiet komplett unter die Erde verlegt. Nur der direkt neben dem Bahnhof gelegene Zugang zur nun ebenfalls unterirdischen Endstation der Schmalspurbahn ist noch zu erkennen. Auch zwei weitere Haltepunkte befinden sich noch im Tunnel. Welche Stadt dieser Größenordnung außer Locarno verfügt schon über eine eigene U-Bahn?
Obwohl er nur über drei Gleise verfügt, ist der Bahnhof in Muralto Fernzugstation. Im stündlichen Wechsel verkehren von dort Züge nach Zürich oder gar nach Basel am anderen Ende der Eidgenossenschaft. Zudem startet alle halbe Stunde eine S-Bahn in Richtung Bellinzona. Betrieben wird diese Linie von den Treni Regionali Ticino Lombardia, kurz TILO, einer gemeinsamen Tochter der italienischen und schweizerischen Staatsbahnen.
Einzig die Linie nach Locarno, die kürzeste der bislang drei Tessiner S-Bahn-Strecken bleibt nämlich komplett auf dem Staatsgebiet der Eidgenossenschaft. Die anderen beiden führen hinüber in die Lombardei, zu der man schon alleine wegen der ungewöhnlichen, nicht unbedingt an die geographischen Gegebenheiten angepassten Grenzziehung und der gemeinsamen Geschichte ziemlich gute Verbindungen hat. Der Dialekt ist ebenfalls ziemlich ähnlich.
Und Mailand ist vom Südtessin mit seinem Zentrum Lugano nur ungefähr eine Fahrtstunde entfernt. Selbst von der weiter nördlich gelegenen Kantonshauptstadt Bellinzona ist die italienische Metropole schneller zu erreichen als Luzern oder Zürich jenseits des Gotthard. Nicht umsonst tragen auch die Schnellbahnzüge im Ticino die Nummer "S10", "S20" und "S30". Denn das mit niedrigeren Zahlen ausgestattete Mailänder S-Bahn-Netz überschneidet sich zum Teil mit ihnen.
Während italienische Züge von Milano bis zum Schweizer Grenzstädtchen Chiasso fahren, rollen Triebwagen aus dem Ticino ins lombardische Como. Die am östlichen Ufer des Lago Maggiore entlang führende dritte Linie wird mit dem nächsten Fahrplanwechsel sogar bis zum Internationalen Flughafen Mailand-Malpensa verlängert. Und an einer weiteren Strecke zwischen Lugano und dem Aeroporto wird bereits gebaut.
 |
 |
 |
| Die Altstadt Locarnos drängt sich mit engen Gassen am Hang | ||
Noch einmal senkt sich die Strecke, als man am Bahnhof abbiegt, um die Seepromenade anzusteuern. Zum zweiten Mal gibt es dort für einige Meter Gegenverkehr. Während man auf der Landseite der Straße nach Locarno hinein läuft, wird man später näher am Ufer wieder aus der Stadt heraus kommen, deren nur am Ortsschild erkennbare Gemeindegrenze auf einer kurzen Brücke über den ziemlich ausgetrockneten Bach Torrente Ramogna überschritten wird. Einzig und allein dieser kleine Graben trennt Muralto von Locarno.
Das Begegnungsstück bietet sich natürlich als Beobachtungspunkt für Freunde und Verwandte absolut an. Innerhalb einiger Minuten kann man so die eigenen Läufer gleich zweimal bejubeln. Und so stehen an dieser Stelle dann auch deutlich mehr Zuschauer hinter den Flatterbändern als auf fast allen übrigen Passagen des Kurses.
Aber nicht nur die eigenen Bekannten sondern auch viele andere werden namentlich angefeuert. Denn bei allen vorangemeldeten Teilnehmern steht die Ziffernkombination nur klein in einer Ecke der Startnummer, während ins Hauptfeld der Vorname gedruckt ist. Bei Nachmeldungen ist das natürlich nicht möglich. Und so gibt es zwei unterschiedliche Varianten, denen man den Zeitpunkt der Einschreibung ansieht.
In der Mehrzahl sind die Zurufe zwar dann doch Italienisch. "Forza" und "vai" sind - oft gekoppelt mit dem Namen - dabei der Standard. Von den etwa vierzehnhundert Teilnehmern kommen schließlich fünfhundert aus dem Ticino und mehr als dreihundert aus dem benachbarten Italien. Doch auch Schwizerdütsch bekommt man zu Ohren, denn der Anteil der Starter aus den Kantonen nördlich des Gotthard ist genauso groß wie der italienische.
Das oft zu hörende "gonz guatt" mag für die ebenfalls recht zahlreichen Deutschen - immerhin mehr als ein Zehntel der Felder ist zum Saisonende aus Deutschland angereist - eventuell etwas ungewöhnlich sein. Doch ist mit diesem "ganz gut" eben in der ursprünglichen Bedeutung tatsächlich noch einmal eine Steigerung von "gut" gemeint und nicht etwa eine Relativierung, zu der sich der Ausdruck im Sprachgebrauch hierzulande inzwischen gewandelt hat.
Genau am Übergang zwischen dem älteren und dem neueren Teil Locarnos führt die Strecke in die Stadt hinein. Rechts ziehen sich enge, winklige Gassen des historischen Zentrums den Hang hinauf. Auf der linken Seite breitet sich auf ebenem Grund das rechtwinklige Straßenmuster der wesentlich jüngeren Neustadt aus.
 |
 |
 |
| Nicht allzu lange ist der Besuch, den man der Altstadt von Locarno abstattet | ||
Denn dort, wo die Marathonis gerade entlang laufen, ersteckte sich noch vor
wenigen Jahrhunderten der Lago Maggiore. Ähnlich wie auch beim Ticino und
der durch ihn entstandenen Magadinoebene hat das südwestlich von Locarno
aus den Alpen heraus kommende Flüsschen Maggia mit dem von ihm mitgebrachten
Geröll ein Delta gebildet, das sich immer weiter in die Wasserfläche
hinaus schob. Halbkreisförmig ragt es in den See und nimmt ihm so rund
die Hälfte seiner eigentlichen Breite.
Und genau wie beim Ticino hat man auch die Maggia inzwischen kanalisiert und das Schwemmland trocken gelegt. Auf das dadurch nutzbare Gelände sind Locarno und das jenseits des Flusses gelegene Schwesterstädtchen Ascona - nicht nur als Ferienort sondern auch als Namensgeber für ein Auto bekannt - inzwischen weit hinaus gewachsen.
Die Piazza Grande, auf die man nun zusteuert, war im Mittelalter noch der Hafen der Stadt. Heutzutage ist der lang gezogene und leicht gekrümmte Platz, der als der größte im ganzen Tessin gilt und seinen Namen deshalb durchaus zu Recht trägt, unter anderem im Sommer der Veranstaltungsort der Filmfestivals von Locarno.
Mitte November werkelt man dort schon eifrig an den Holzpodesten für die Eislaufbahn, die über die Adventszeit und den Jahreswechsel als Attraktion dient. Bevor sie die kopfsteingepflasterte Freifläche allerdings erreichen, biegen die Marathonis ab und umgehen sie in einer parallel verlaufenden Seitenstraße.
So kommt man auch nicht an jenem Palazzo vorbei, der jetzt der Società Elettrica Sopracenerina, der Elektrizitätsgesellschaft des Sopraceneri gehört und mit seiner breiten Front einem gewissen Kontrast zu den eher schmalen, in die Höhe gebauten und mit Laubengängen ausgestatteten Häusern auf der Hangseite gegenüber bildet.
 |
 |
| Im Innenraum des riesigen Kreisels an der Piazza Castello muss man fast eine komplette Runde drehen … | … über die Piazza Giovanni Pedrazzini mit ihrem großen Brunnen läuft man nur hinweg |
Im neunzehnten Jahrhundert residierte in ihm die Kantonsregierung, und zwar immer sechs Jahre lang, um anschließend in eine andere Stadt weiter zu ziehen und erst zwölf Jahre danach zurück zu kehren. Die erste Verfassung des Tessins bestimmte nämlich als Kompromisslösung die drei um diesen Titel bemühten Zentren Locarno, Bellinzona und Lugano abwechselnd zur Hauptstadt. Nach über einem Dreivierteljahrhundert Rotation legte man sich dann 1881 endgültig auf Bellinzona fest.
Wobei die offizielle Schweizer Bezeichnung eigentlich "Hauptort" lautet. Denn zum Beispiel im nicht einmal zwanzigtausend Bewohner zählenden Appenzell-Innerrhoden hat der ebenfalls Appenzell heißende kantonale Verwaltungssitz noch immer keine Stadtrechte. Und auch Altdorf im Kanton Uri wird in der Regel nur als Hauptort bezeichnet, denn die Zehntausender-Marke, die es zumindest statistisch zur Stadt machen würde, kann man dort bei Weitem nicht übertreffen.
Erst mit dem Einmarsch französischer Truppen 1798 hatte die Herrschaft der Alten Eidgenossenschaft über die Untertanengebiete auf der Südseite der Alpen geendet. Doch vor die Wahl gestellt, entweder der von der neuen Herren aus Frankreich in Norditalien gegründeten "Cisalpinischen Republik" angegliedert zu werden oder Bestandteil der Schweiz zu bleiben entschied man sich für Letzteres. "Liberi e svizzeri" lautete der Wahlspruch.
 |
 |
| Am Rande des Zentrums findet man die Chiesa di San Francesco und das Castello Visconteo | |
Die ursprünglich unter französischer Besatzung entstandenen beiden Kantone Bellinzona im Nordosten und Lugano im Südwesten vereinigte man fünf Jahre später, als die Schweiz wieder zu einem formal vollkommen unabhängigen, aber im Endeffekt dennoch von Frankreich abhängigen Staat wurde. "Repubblica e Cantone Ticino" hieß den neuen Landesteil von nun an in der eigenen italienischen Amtssprache.
Erst damals wurde "Tessin", womit man bis dahin ausschließlich den Fluss gemeint hatte, auch die Bezeichnung für die gesamte Region. Ein wenig dürfte man sich dabei durchaus am französischen Vorbild orientiert haben, wo viele der Departements ebenfalls nach Wasserläufen benannt sind. In der Schweiz, wo über die Hälfte der Kantone den Namen ihrer Hauptorte tragen, ist man dagegen die absolute Ausnahme.
Ein Anschluss an Italien stand auch in der Folgezeit eigentlich nie zur Debatte. Weder zu Zeiten der italienischen Einigungskriege im neunzehnten Jahrhundert noch zwischen den beiden Weltkriegen, als Benito Mussolini den Anspruch erhob, auch den Ticino in den von ihm beherrschten Staat einzugliedern und diesen - nach der im Krieg erzwungenen Abtretung Südtirols - damit endgültig bis zum Alpenhauptkamm auszudehnen.
Doch dieser sogenannte "Irredentismus" - von "terre irredente", den "unerlösten Gebieten" - erreichte das genaue Gegenteil. Denn in Wahrheit wollten weder die Tessiner noch Bewohner der Graubündner Südtäler erlöst werden und bekannten sich angesichts der Forderungen aus dem Süden nur umso stärker zur Schweiz.
Und trotz der kulturell und wirtschaftlich engen Kontakte über die Grenze hinweg ist man im Tessin auch weiterhin mit voller Überzeugung Eidgenosse. Fast noch häufiger als die vertikal rot-blau gestreifte Flagge des Kantons - wie alle eidgenössischen Fahnen quadratisch - sieht man zum Beispiel das rote Tuch mit dem unverkennbaren Kreuz an den Masten flattern.
Die Lauftrecke kurvt für einen Moment durch enger werdende Straßen, die noch nicht zum Schachbrettmuster der Neustadt gehören. Dann treten die Häuser allerdings wieder zurück und man läuft auf eine Fläche hinaus, die sich nicht so richtig entscheiden kann, ob sie nun ein richtiger Platz oder doch nur die große Kreuzung mehrerer verkehrsberuhigter Gassen sein will.
Dort markiert das Castello Visconteo den südwestlichen Eckpunkt der Altstadt. Die Überreste der einst noch wesentlich größeren Befestigungsanlage tragen den Namen der Mailänder Adelsfamilie Visconti, die von ihr aus über Locarno herrschte. Später residierten die eidgenössischen Landvögte der Vogtei Luggarus in der immer wieder umgebauten und erweiterten Burg.
 |
 |
 |
| Das Castello Visconteo ist der noch erhaltene Rest einer wesentlich größeren mittelalterlichen Burg | ||
Dort wo sich früher der Hafen des Kastells befand, drehen heute Autos in einem riesigen Verkehrskreisel ihre Runden. Dessen Innenraum liegt deutlich tiefer und kann über mehrere Fußgängerunterführungen erreicht werden. In der größten von ihnen, durch die der Marathonkurs hindurch führt, kann man unterhalb der Straße noch die Ruinen der Wehrmauern erkennen, die das Becken schützten. Einmal fast komplett um die eigentlich nur aus einer großen Freifläche bestehenden Piazza Castello herum müssen die Läufer.
Sie werden dabei sorgsam von zwei Helferinnen beobachtet, die zur Kontrolle ihre Startnummern notieren. Die Zeitmessung erfolgt zwar mit einem in die Nummer integrierten Chip. Doch Zwischenmatten, mit denen man technisch überprüfen könnte, ob jeder auch die gesamte Strecke absolviert hat, gibt es nicht. Anbieten würde sich der Burgplatz-Kreisel dafür schon. Denn er ist nicht nur die Wendemarke des Kurses, auf ihm ist auch der fünfzehnte Kilometer markiert.
Ein zweiter Fußgängertunnel bringt in die Marathonis in die Neustadt, wo auf dem direkten Weg wieder das Seeufer angesteuert wird. Nur der Schlenker, den man um den Brunnen mitten auf der quadratischen Piazza Giovanni Pedrazzini vollführen muss, unterbricht die Gerade. Die um ihn herum stehenden Villen vom Beginn des letzten Jahrhunderts heben sich angenehm vom sonstigen architektonischen Zweckbauten-Einerlei des Viertels ab.
Nur einen Straßenblock entfernt liegt auch der Palazzo della Conferenza, in dem der französische Außenminister Aristide Briand mit seinem deutschen Kollegen Gustav Stresemann 1925 die Verträge von Locarno auszuhandeln, durch die das im Ersten Weltkrieg besiegte Deutschland in den Völkerbund aufgenommen wurde. Die beiden erhielten dafür den Friedensnobelpreis. Doch nur eineinhalb Jahrzehnte sprachen zwischen beiden Nationen schon wieder die Waffen.
Die baumbestandene Uferpromenade nimmt die Läufer auf, die durch die Halbkreisform
des einstigen Flussdeltas nun direkt auf die hinter der Stadt aufragenden Berge
zusteuern. Hoch oben auf einem Felsen erhebt sich die Wallfahrtskirche Madonna
del Sasso mit dem auffälligen zickzackförmigen Kreuzweg, der zu ihr
hinauf führt. Sie wird in Reiseführern meist als Wahrzeichen Locarnos
bezeichnet. Doch wie der Bahnhof liegt sie gar nicht auf deren Gebiet sondern
in der angrenzenden Gemeinde Orselina.
Auf den meisten der von ihr verbreiteten Fotos sieht es so aus, als ob die Chiesa an markanter Stelle ganz alleine über dem See thronen würde. Doch muss man dafür schon einen ganz bestimmten Blickwinkel wählen. Denn in Wahrheit ist sie längst von anderen Gebäuden umzingelt. Die aussichtsreichen und sonnenbeschienenen Südhänge sind natürlich beliebtes Baugelände. Und so wuchern Locarno und Ascona sowie die angrenzenden Orte mit oft ziemlich tristen Betonbauten immer weiter die Berge hinauf.
Hinter der Anlegestelle für die auf dem Lago Maggiore verkehrenden Schiffe ist man wieder auf der kurzen Begegnungspassage angekommen. Das flache Schwemmland endet an den ersten Hügeln und der Kurs dreht deshalb um neunzig Grad in Richtung Osten. Der Graben zwischen Locarno und Muralto, der immerhin verhindert, dass Gebäude in beiden miteinander vollkommen verwachsenen Gemeinden stehen, verändert auch die Promenade.
Denn statt in einer Allee befindet man sich plötzlich in einer Art tropischen Garten. Auch anderswo in und um Locarno sieht man immer wieder Palmen, die sich obwohl eigentlich fremd am Lago Maggiore längst ziemlich wohl fühlen. Doch im Uferpark von Muralto stehen zudem Zypressen und mannshohe Agaven, Eukalyptus- und sogar Bananenbäume. Eine Pflanze ist exotischer als die andere.
Bei strahlendem Sonnenschein wie an diesem Marathonsonntag wähnt man sich dabei viel eher irgendwo in Spanien oder Italien am Mittelmeer und nicht an einem See in der Schweiz. Die nächsten Kilometer, die weitgehend direkt entlang des Lago Maggiore verlaufen, sind wohl eindeutig die schönsten der Marathonstrecke. Nicht nur wegen der botanischen Vielfalt, die es dabei zu entdecken gibt. Auch wegen der beeindruckenden Aussichten, die sich über den See hinweg öffnen.
Gegenüber am anderen Ufer ragen in wenigen Kilometern Entfernung die Berge direkt aus dem Wasser. Und manchmal tauchen auch in Laufrichtung Hochgebirgsgipfel über Palmen auf. Die Farben der meisten von ihnen liegen noch immer irgendwo zwischen grün und braun. Nur ganz wenige helle Flecken lassen auf Schnee schließen. Der zu warme und viel zu trockene Herbst zeigt auch in den Alpen deutliche Wirkung.
Einige Schweizer Skiorte geben ausgerechnet an diesem Tag bekannt, dass sie die für das folgende Wochenende angesetzte Saisoneröffnung verschieben müssen. Die Lifte würden noch nicht in Betrieb genommen. Denn Naturschnee sei bisher kaum gefallen. Und für den Einsatz von Beschneiungsanlagen wären die Temperaturen selbst in den oberen Regionen meist noch deutlich zu hoch.
Doch selbst im hierzulande als ziemlich schneesicher geltenden Skandinavien sieht es nicht anders aus. Im norwegischen Beitostølen muss man ebenfalls in diesen Tagen den dort geplanten Weltcupauftakt der Skilangläufer abgeben, weil nicht genug Schnee vorhanden war. Und im eingesprungenen Sjusjøen werden die Sportler später ihre schmalen Latten auf einem Kunstschneeband durch weitgehend grüne Landschaft gleiten lassen.
 |
 |
 |
| Von der Piazza Pedrazzini sind es nur noch wenige Meter, bis man erneut an der Uferpromenade angelangt ist | ||
Oberhalb der Laufstrecke taucht jenseits der sie wieder einmal begleitenden Bahnlinie die Chiesa San Quirico auf. Bei ihr verhält es sich genau umgekehrt wie bei San Vittore. Denn während der Campanile noch im romanischen Original erhalten ist, wurde das Kirchengebäude später im Barockstil neu errichtet. Sie liegt schon in Minusio. Denn das kleine Muralto hat man, ohne es aufgrund des auf dem Uferweg fehlenden Ortschildes richtig zu merken, bereits wieder verlassen.
Nicht ganz alleine sind die Läufer auf diesem Abschnitt. Doch sind es weniger mit voller Absicht anwesende Zuschauer als vielmehr zufällig ins Marathongeschehen hinein geratene Spaziergänger, die dort unterwegs sind. Während auf den Promenaden von Locarno und Muralto die Strecke noch mit Flatterband abgetrennt war, ist dies auf dem meist nur wenige Meter breiten Weg kaum noch möglich. Immerhin hat man an den Zugängen Schilder aufgestellt, die das Radfahren unterbinden sollen.
Ohnehin ist in der Ausschreibung ausdrücklich vermerkt, dass die Begleitung der Teilnehmer mit dem "Velo" untersagt ist. Und man hält sich auch weitgehend daran. Nur ganz wenige Radler tauchen auf der Strecke auf. Dass nicht nur "bicicletti" sondern auch "veicoli a motore" untersagt sind versteht sich zwar fast von selbst, ist aber genauso in den Teilnahmebedingungen nachzulesen.
Ein burgartiges Gebäude mit einem wuchtigen Wehrturm taucht am Streckenrand auf. "Cà di Ferro" wird es genannt und diente früher als Quartier für neu angeworbene Reisläufer. Selbst wenn im Tessin tatsächlich an einigen Orten - unter anderem im Maggia-Delta zwischen Locarno und Ascona sowie in der Magadinoebene - Reis angebaut wird, hat dieser Begriff allerdings mit Getreide nicht das Geringste zu tun.
 |
 |
| Noch einmal herrscht kurz Gegenverkehr … | … dann macht man sich durch den Park am Seeufer auf den Rückweg |
Es handelt sich bei "Reisläufern" vielmehr um jene schweizerischen Söldner, die im ausgehenden Mittelalter für ihre kriegerischen Fähigkeiten berühmt-berüchtigt waren. Der Begriff ist verwandt mit "Reise" und meint jene, die in die Fremde aufbrechen. Der Wortbestandteil "Läufer" erklärt sich dadurch, dass es sich im Gegensatz zu Rittern um Fußsoldaten handelte.
Durch die großen Erfolge der eidgenössischen Truppen gegen die Habsburger und Franzosen im Ringen ihre Unabhängigkeit, wo sie in Schlachten mehrfach trotz großer zahlenmäßiger Unterlegenheit siegreich blieben, hatten sie sich den Ruf erworben, praktisch unbesiegbar zu sein. Immer mehr Herrscher ließen darum Kämpfer aus der Schweiz anwerben oder schlossen Verträge mit eidgenössischen Heerführern oder sogar den Kantonen zur Abstellung von Einheiten.
Insbesondere in den kargen Bergregionen blieb bei wachsender Bevölkerung vielen gar keine andere Wahl als Reisläufer zu werden. Und da diese in immer größerem Maß eingesetzt wurden, kämpften in vielen Gefechten des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts Schweizer gegen Schweizer für fremde Fürsten. Als nach und nach stehende Heere in Mode kamen, gingen praktisch alle europäischen Staaten auch dazu über Schweizer Regimenter aufzustellen.
Und so waren trotz der im Westfälischen Frieden festgeschriebenen Neutralität der Eidgenossenschaft dennoch bei beinahe allen Kriegen der Folgezeit weiterhin Schweizer Soldaten im Einsatz. Erst Mitte des neunzehnten Jahrhunderts wurde die Anwerbung endgültig unterbunden. Und inzwischen ist es Staatsbürgern der Eidgenossenschaft bei Strafe verboten, in ausländische Militärdienste zu treten.
Eine kleine Ausnahme davon gibt es jedoch. Denn die 1506 gegründete Schweizer Garde des Papstes, die sogar eine Uniform trägt, die an die Zeit der Resiläufer erinnert, besteht auch heute noch vollständig aus katholischen Schweizern. Im Allgemeinen wird diese Einheit jedoch nur als Hauspolizei des Vatikans betrachtet, so dass die Gardisten in ihrer Heimat auch nicht als Söldner gelten und also auch nicht unter dieses Gesetz fallen.
 |
 |
| Die Kilometer am Seeufer entlang von Locarno zurück nach Tenero sind die wohl schönsten der ganzen Strecke | |
Selbst wenn die Pflanzen am Uferweg inzwischen doch wieder weniger exotisch sind, steht auch weiterhin - insbesondere auf Privatgrundstücken - immer wieder einmal eine Palme am Streckenrand. Doch irgendwann hört die Bebauung auf. Es bleibt kein Platz mehr für sie. Der vorletzte Kilometer der Runde, auf den man auf dem Hinweg schon einen Blick von oben werfen konnte, führt auf dem schmalen Streifen, der zwischen Wasser und Straße noch bleibt, um die nördlichste Spitze des Lago Maggiore.
Zum Abschluss dürfen die Marathonis dann aber noch einmal in die nun wieder erreichte Ebene hinaus laufen. Dafür müssen sie allerdings den See verlassen. Zwischen Laufstrecke und Ufer breitet sich nämlich nun ein riesiger Campingplatz aus. Tenero gilt als absolutes Zentrum für diese Urlaubsform in der Region.
Denn die anderen Orte am Nordende des Sees haben aufgrund ihrer Hanglage eigentlich nicht die geeignete Fläche dafür. Das Mündungsgebiet des Ticino weiter südlich steht unter Naturschutz und dann folgen schon wieder Berge. Tenero hat also fast ein Monopol. Gleich mehrere Plätze gibt es deshalb im Gemeindegebiet. Und eigentlich ist das Ufer des Lago Maggiore sogar fast komplett von ihnen in Beschlag genommen.
Nur das Sportzentrum unterbricht diese Reihe. In einer nicht unbedingt beeindruckenden Mischung von Campingplatz, Häusern unterschiedlichster Bauart und schließlich einer Wiese wird dieses durch einen Seiteneingang angesteuert. Eine triumphale Zielgerade sieht definitiv anders aus. Auch der Weg zwischen den Sportanlagen hindurch hat damit eher wenig zu tun. Der traditionelle Tessiner Marathon legt seinen Schwerpunkt eben weiterhin anders, als manche Veranstaltung, die zuletzt die Bühne betreten hat.
Zumindest die letzten zweihundert Meter führen dann aber noch geradeaus auf den Zielbogen vor dem Hauptgebäude. Die Läufer der Halbdistanz haben damit ihr Soll erfüllt. Die Marathonis dürfen die abwechslungsreiche, nun allerdings deutlich weniger stark bevölkerte Schleife noch ein weiteres Mal in Angriff nehmen.
Nicht allzu lange können sich die Helfer nach dem Start der letzten Gruppe im Sportkomplex zurück lehnen. Denn ziemlich schnell sind die Besten schon wieder zurück. Nur 1:06:41 benötigt der für Stade Genève antretende, aber ursprünglich aus Äthiopien stammende Terefe Seifu nämlich für seine einundzwanzig Kilometer. Den Sieg bringt er damit zwar sicher nach Hause, aber Ueli Koch ist mit 1:08:28 trotzdem bei Weitem nicht völlig abgeschlagen.
 |
 |
 |
| Palmen und Hochgebirge, historische Gebäude und schöne Landschaft, dieser Streckenabschnitt bietet viel Sehenswertes | ||
Noch drei weitere Läufer bleiben unter der Marke von siebzig Minuten, was sowohl die gute Besetzung wie auch die schnelle Strecke belegt. Sogar sechsundzwanzig "Uomini" unterbieten achtzig Minuten. Abraham Eshak sichert sich jedenfalls in 1:09:04 den dritten Treppchenplatz. Doch nicht allzu weit zurück folgt Luca Merighi aus dem italienischen Como mit 1:09:12. Und auch Joseph Bago, ein Vereinskamerad des Siegers mischt bei 1:09:25 noch mit.
Bei den Frauen macht Penuel Kiondo nach 1:21:35 den Doppelsieg der schwarz-gelb gekleideten Genfer perfekt. Gesamtplatz zwei geht durch Marie-Luise Heilig-Duventäster von der LG Welfen in 1:24:03 nach Deutschland.
In der Ergebnisliste wird sie als W45-Siegerin geführt, obwohl sie bereits der W50 angehört. Ihrer nach 1:26:50 auf Rang vier einlaufenden Vereinskollegin Brigitte Hoffmann geht es als Klassenzweite nicht anders. In einer etwas ungewöhnlichen Einteilung sind nämlich auf beiden Distanzen für die Frauen nur die Altersklassen W35 und W45 ausgeschrieben.
Zwischen die beiden Schwäbinnen schiebt sich noch die 1:25:45 benötigende Melanie Stapfer vom LC Uster im Kanton Zürich. Knapp hinter Brigitte Hoffmann folgt in 1:26:55 mit Alexandra Schaller noch eine weitere Züricherin. Mit insgesamt sogar acht Damen unter eineinhalb Stunden ist das Niveau auch bei den "Donne" durchaus beachtlich.
 |
 |
 |
| Für den letzten Kilometer verlässt man den See noch einmal, um zum Ziel im "Centro sportivo nazionale della gioventù" zu gelangen | ||
Vom Marathon kann man das erst recht behaupten. Denn gleich drei Frauen knacken die Drei-Stunden-Marke. Nicht nur die nach 2:39:26 überlegen gewinnende und sich damit sechshundert Franken Siegprämie sichernde Alemitu Bekele - nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen, in die Türkei eingebürgerten Europameisterin über 5000 Meter - sondern auch Angela Haldimann-Riedo mit 2:53:30 und die kurz darauf in 2:54:14 die Linie überquerende Susanne Rügger sorgen für ein ziemlich schnelles Rennen. Carmen Bähler scheitert zudem mit 3:01:35 nur knapp.
Bei gerade einmal fünfundzwanzig Frauen im Marathonziel ergibt sich damit eine Quote von zwölf Prozent. Da können die Männer mit sechszehn von 183 nicht ganz mithalten. Und nur Sieger Stefan Luescher in 2:35:33 und der Zweite Massimo Maffi in 2:37:40 können mit der schnellen Dame aus Äthiopien mithalten.
Doch auch Nicolas Wiedmer mit 2:44:29 und Daniel Waldmeier in 2:47:28 auf den Plätzen drei und vier gelingt es, im Schnitt noch jeden Kilometer unter vier Minuten zurück zu legen. Der als große Favorit gehandelte und mit Startnummer "1" ausgestatte Eticha Tesfaye, der im Vorfeld angekündigt hatte die Olympianorm des Schweizer Verbandes angreifen zu wollen, kommt dagegen nicht ins Ziel.
Bemerkenswert ist, dass mehr als drei Viertel aller Teilnehmer die Marathondistanz in weniger als vier Stunden zurück legen. Ins Tessin fährt man anscheinend hauptsächlich um dort schnell zu rennen. Obwohl die Region ansonsten bei Urlaubern ziemlich beliebt ist, haben die Lauftouristen diese Veranstaltung noch nicht für sich entdeckt.
 |
 |
 |
| Alleine oder … | … in Begleitung eines ganzen Dutzend Fans … | … endet der Marathon wieder im Sportzentrum |
Große Massen wird man im Ticino wohl auch in Zukunft nicht anziehen und könnte sie zudem ohne große organisatorische Änderungen gar nicht verkraften. Aber im nördlich der Alpen meist trüben und nasskalten November ist die Wahrscheinlichkeit am Lago Maggiore doch noch einmal gute Bedingungen für einen Marathon vorzufinden sicher nicht schlecht.
Interessant ist die Gegend rund um Lugano und Tenero allemal. Das Tessin und der Lago Maggiore sind zwar ganz sicher nicht die Schweiz, die man im ersten Moment im Kopf hat. Und Palmen gehören definitiv nicht zum klassischen Bild der Eidgenossenschaft. Doch gerade das ist ja der besondere Reiz einer Region aus, die sich zwischen alpin und mediterran bewegt. Die Maratona Ticino ist nicht nur wegen des ungewohnten Artikels eben ein Lauf in der etwas anderen Schweiz.
 |
Bericht und Fotos von Ralf Klink Ergebnisse und Infos www.maratona-ticino.ch Zurück zu REISEN + LAUFEN – aktuell im LaufReport HIER |
 |
© copyright
Die Verwertung von Texten und Fotos, insbesondere durch Vervielfältigung
oder Verbreitung auch in elektronischer Form, ist ohne Zustimmung der LaufReport.de
Redaktion (Adresse im IMPRESSUM)
unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes
ergibt.