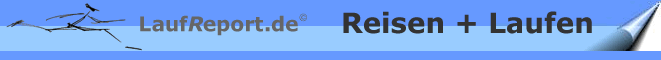

 |
 |
 |
 |
 |
 |
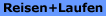 |
 |
 |
 |
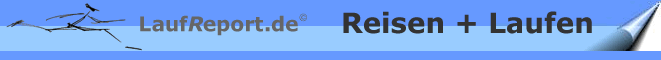 
|
10.04.11 - Connemara International Marathon IrlandDurch Irlands wilden Westen |
|
von Ralf Klink
|
Wenn ein Marathon zum zehnten Male ausgetragen wird, ist das eigentlich noch nicht wirklich etwas Besonderes. Gerade in Deutschland hat zuletzt eine größere Anzahl Veranstaltungen diese Marke hinter sich gebracht. Oder sie steht ihnen zumindest in nächster Zeit bevor. Der große Aufschwung des Marathons zu Beginn des neuen Jahrtausends hat hierzulande schließlich eine ganze Reihe neuer Läufe entstehen lassen, die sich jetzt im Jubiläumsalter befinden.
Falls man mit gerade einmal einem knappen Jahrzehnt an Geschichte jedoch schon der zweitälteste bestehende Marathon im Land ist, bekommt das Ganze dann doch eine etwas andere Bedeutung. Insbesondere wenn es sich dabei auch noch keineswegs um ein Entwicklungsland sondern um einen Staat in Europa handelt. Die Rede ist von Irland und dem Connemara Marathon.
Obwohl man auf der einen Seite mit dem bereits 1980 ins Leben gerufenen Rennen in Dublin eigentlich eine lange Tradition über diese Distanz vorzeigen kann, lag andererseits der Rest der Republik in dieser Hinsicht ziemlich brach. Die ohnehin in Ländern mit einer einzigen dominierenden Stadt oft zu beobachtende Tendenz, dass sich auch in läuferischer Hinsicht alles auf eben diese Metropole konzentriert, fand damit eines ihrer extremsten Beispiele.
Erst mit dem Connemara Marathon wurde das langjährige Monopol des Hauptstadtlaufs, der mit zuletzt jährlich rund zehntausend Teilnehmern die nationale Größenrangliste natürlich dennoch klar dominiert, endgültig gebrochen. Zwar betrat 2002, also im gleichen Jahr auch der Longford Marathon erstmals die Bühne. Doch blieb dieser Veranstaltung im Spätsommer gegenüber dem Frühjahrslauf von Connemara nur der dritte Platz der aktuellen Altersrangliste.
Inzwischen ist die Marathonszene Irlands allerdings heftig in Bewegung gekommen. Überall schießen neue Rennen wie Pilze aus dem Boden. So viele, dass man kaum noch den Überblick behalten kann. Selbst wenn man die kaum mehr als privaten Trainingsläufe darstellenden Kleinveranstaltungen der hartnäckigsten Sammler außen vor lässt, kommt man nun bei der Aufzählung bereits auf ein gutes Dutzend.
 |
 |
| Busse bringen die Läufer aus dem Stadtzentrum von Galway .... | … zum Start irgendwo im nirgendwo |
Jetzt kann man nämlich nicht nur in Dublin sondern auch in Cork, Limerick und Galway, den anderen städtischen Zentren der ansonsten eher ländlich geprägten Republik einen Marathon absolvieren. Auch in den Kleinstädten Kildare im Osten und Clonakilty im Süden der Grünen Insel sind zum Beispiel neue Läufe über diese Distanz ausgeschrieben.
Und selbst wenn man - wie wohl zu erwarten ist - im deutschsprachigen Raum von diesen beiden "towns" noch nie etwas gehört haben sollte, sind der Burren, die Halbinsel Dingle und die Cliffs of Moher zumindest den Irlandfreunden sehr wohl ein Begriff. Schließlich zählen diese doch zu den absoluten touristischen Höhepunkten des Landes. Durch die ersten, über die zweite und an der dritten dieser landschaftlichen Sehenswürdigkeiten vorbei haben eifrige Organisatoren nun ebenfalls jeweils eine Marathonstrecke gelegt.
Nicht ganz zufällig hat man sich dabei höchstwahrscheinlich auch den Connemara Marathon zum Vorbild genommen. Denn dieser führt ebenfalls durch eine Gegend, die in praktisch allen Reiseführern unter der Klassifizierung "höchst sehenswert" geführt wird, und zieht damit weit mehr als nur die lokale Läuferschaft an, sondern ist ganz im Gegenteil recht international besetzt.
Über mangelnden Zuspruch können sich die Macher des - in einem angesichts der Silbengleichheit fast zwingenden Wortspiel - auch "Connemarathon" genannten Rennens nun wahrlich nicht beklagen. Während die meisten Veranstalter hierzulande bekanntermaßen längst oft händeringend nach Teilnehmern suchen, muss man wegen der begrenzten Logistik die Zahl der Starter auf der Marathonstrecke sogar bei ungefähr eintausend begrenzen. Interessenten gäbe es dagegen eigentlich noch deutlich mehr.
Zahlenmäßig liegt man damit zwar keineswegs auf gleicher Höhe wie der Lauf in der Hauptstadt Dublin. Doch geographisch tut man das sehr wohl. Ziemlich exakt auf jenem Breitengrad, den ganz im Osten der Republik die irische Metropole besetzt, dehnt sich nämlich am anderen Ende der Insel die Landschaft "Connemara" aus.
Denn es handelt sich keineswegs um eine Stadt, die diesen Marathon beherbergt und ihm deshalb den Namen gab, sondern um eine ganze Region. Mit diesem Begriff wird nämlich der westliche Teil des Counties Galway - eine jener sechsundzwanzig in der Republik traditionell existierenden Verwaltungseinheiten, die ihren Namen daher haben, dass sie früher von einem Grafen, einem "Count" beherrscht wurden - direkt an der Atlantikküste bezeichnet.
Die Abgrenzung ist leicht und eigentlich ziemlich eindeutig. Denn sie besteht nahezu ausschließlich aus Wasserflächen. Den Süden und Westen erledigt dabei der Ozean selbst, der sich mit der weiten Bucht von Galway tief ins Land hinein schiebt, während die restliche Uferlinie von Connemara mit ihren unzähligen Buchten, Halb- und Ganzinseln so zerrissen daher kommt, dass man schon einmal ein wenig die Übersicht verlieren kann, was da nun wie zusammen hängt.
 |
 |
| Zwischen Hang und See bleibt nur wenig Platz für die auf ihren Start wartenden Marathonis | |
Auch im Norden übernimmt das Meer die Aufgabe Connemara und die Grafschaft Galway von ihrem Nachbarn, dem County Mayo zu trennen. Doch hier ist es der schmale Killary Harbour, der die Grenze definiert. Dabei handelt es sich zwar nicht wie oft behauptet um den einzigen, wohl aber um einen der wenigen echten Fjorde entlang der wild zerklüfteten irischen Küste.
Kaum mehr als zehn Kilometer breit ist die Landbrücke, die man überqueren muss, um von diesem Überbleibsel der Eiszeit hinüber an den Lough Mask zu kommen. Und noch wesentlich kürzer stellt sich der Weg zwischen diesem See und dem sich mit doppelter Quadratkilometerzahl weiter südlich anschließenden Lough Corrib dar.
In der Republik Irland ist er das größte Binnengewässer, auf der Insel das zweitgrößte. Das klingt zwar im ersten Moment seltsam, ist aber dennoch kein wirklicher Widerspruch. Denn der noch ausladendere Lough Neagh findet sich in dem zum Vereinigten Königreich Elizabeths II gehörenden Nordirland.
Vom Lough Mask zum Lough Corrib - beide von ziemlich zerfleddertem Umriss und zudem mit unzähligen Inseln gesprenkelt - gibt es zwar eine natürliche Verbindung, in der Wasser vom einen zum anderen der zwei Seen gelangen kann. Doch ist diese unterirdisch. Und so hat man zwischen ihnen zusätzlich noch einen kurzen Kanal gegraben.
Mit dem River Corrib schließt sich dann der gerade beschriebene Begrenzungskreis. Denn dieser entwässert den Lough gleichen Namens in die Galway Bay. Da er dafür jedoch kaum zehn Kilometer benötigt, was ihn zum wohl kürzesten Fluss Irlands macht, lässt sich auf Karten mit entsprechend groben Maßstab kaum noch erkennen, wo der See endet und das Meer beginnt.
Links und rechts des Corrib dehnt sich jene Stadt aus, nach der sowohl die Bucht wie auch die Grafschaft benannt sind - Galway. Seit 2010 ist die nach Dublin und Cork drittgrößte Stadt Irlands auch die Heimatstätte eines eigenen Marathons. Aber bereits acht Jahre länger findet sich in ihr zudem das Zentrum des Laufes quer durch Connemara.
Wirklich verwundern kann das jedoch nicht. Denn westlich der Stadt, in Connemera wird es bald ziemlich einsam. Das zweitgrößte irische County ist ohnehin nur dünn besiedelt. Auf einer Fläche, die immerhin mehr als doppelt so groß wie das Saarland ist, lebt nicht einmal eine Viertelmillion Menschen. Bei der Bevölkerungsdichte liegt man damit noch weit unter dem ohnehin schon geringen irischen Durchschnitt.
Ja, selbst wenn man den Großraum Dublin - in dem rund ein Drittel der gut vier Millionen Iren beheimatet ist und der damit den Wert natürlich extrem anhebt - bei der Berechnung außen vor lässt, ergibt sich kein wirklich anderes Bild. Noch immer liegt die Grafschaft Galway nämlich klar unter dem nun deutlich niedrigeren Mittel.
Die Stadt Galway selbst bringt mit mehr als siebzigtausend Einwohnern - kein wirklich hoher Wert für das drittgrößte urbane Zentrum eines Landes - ihrerseits den Schnitt noch einmal erheblich durcheinander. Und der größte Teil der restlichen Bevölkerung des Counties hat sich entweder in ihrem direkten Umfeld oder aber östlich von ihr angesiedelt. Für Connemara bleibt da nicht mehr wirklich viel übrig.
Wie menschenleer dieser etwa zweitausend Quadratkilometer umfassende Landstrich ist, zeigt vermutlich am besten die Tatsache, dass Clifden trotz seiner gerade einmal ungefähr fünfzehnhundert Bürger bereits die größte Siedlung jenseits von Galway darstellt und als eine Art heimliche Hauptstadt von Connemara gilt. Die meisten übrigen der ohnehin nicht wirklich zahlreichen Dörfer erreichen dagegen maximal einen Zahl von wenigen hundert Köpfen.
 |
 |
| Auf die rechte Straßenseite werden die Marathonis kurz vor dem Start gebeten ... | … denn zuerst kommt noch die Spitze des Ultralaufes vorbei, bereits in Führung der spätere Sieger Garrett Crossan |
Mit insgesamt mehreren tausend Startern auf den zur Auswahl stehenden drei Distanzen würde man also überall schnell an logistische Grenzen stoßen. Schon alleine die Anreise wäre problematisch, denn ein dichtes öffentliches Nahverkehrsnetz ist angesichts der schwachen Besiedlung natürlich nicht vorhanden. Bei der deshalb notwendigen Anfahrt mit dem Auto wären die wenigen Parkmöglichkeiten in den Ortschaften schnell erschöpft.
Und natürlich wollen die Teilnehmer, die nicht aus der Region stammen und wegen des Laufes an die westliche Peripherie Irlands gekommen sind, auch irgendwo untergebracht werden. Dabei wären die Kapazitäten, die Connemara bezüglich Übernachtungen zu bieten hat, vermutlich ebenfalls kaum ausreichend. In Galway, das ohnehin meist als "Tor nach Connemara" gepriesen wird, sind davon jedenfalls definitiv genug vorhanden.
Und auch die Erreichbarkeit ist natürlich deutlich besser. Der Regionalflughafen wenige Kilometer außerhalb der Stadt wird zwar nur mit kleinen Maschinen aus Irland und dem Vereinigten Königreich angeflogen. Direkte Verbindungen ins restliche Europa existieren nicht. Aber vom nur knappe hundert Kilometer und eine gute Fahrtstunde entfernten Shannon International Airport gibt es sogar Transatlantikflüge. Aus dem deutschsprachigen Raum wird er jedoch eher selten angesteuert.
Doch selbst von Dublin am anderen Ende der Grünen Insel, wo deutlich mehr Flieger landen, ist man nur unwesentlich länger unterwegs. Schließlich ist die zwischen beiden Städten verlaufende Nationalstraße N6 inzwischen praktisch durchgängig vierspurig ausgebaut und hat deswegen ihren Namen neuerdings auf M6 - M wie Motorway, der irischen Bezeichnung für eine Autobahn - geändert.
Dafür ist die etwa zweihundert Kilometer lange Route in einigen Abschnitten jedoch auch kostenpflichtig. Erstens halten sich die Preise dafür aber durchaus im vertretbaren Rahmen. Und zweitens würde man durch das Umfahren der Mautstellen auf Landstraßen nie und nimmer jene - je nach Verkehrslage im Großraum Dublin - zwei bis drei Stunden schaffen, die man nun nur noch benötigt, um von der Ost- an die Westküste Irlands zu gelangen.
Selbst wenn man den in Irland herrschenden Linksverkehr scheut und statt Mietwagen lieber auf öffentliche Verkehrsmittel setzt, gibt es allerdings wenige Probleme. Denn zum einen verkehren zwischen Dublin und Galway am Tag etliche direkte Züge über die irischen Breitspurgleise. Und ansonsten gibt es auch noch die Fernbuslinien von Bus Éireann, die das eher weitmaschig geknüpfte Eisenbahnnetz ergänzen und ebenfalls Direktverbindungen von der Hauptstadt aus anbieten.
Nach Galway zu gelangen stellt also eigentlich kein echtes Problem dar. Das Erhalten der Startnummern ist da fast schwieriger. Denn diese werden - wie so oft gerade im englischsprachigen Ausland - in einem Hotel ausgehändigt. Und dieses befindet sich ein ganzes Stück außerhalb des Stadtkerns bei einem Einkaufszentrum an einer Ausfallstraße.
Doch selbst wenn man nicht die Mietwagenvariante gewählt hat und seine Unterlagen deshalb auf vier Rädern abholen kann, sind die etwa zwei bis drei Kilometer Fußmarsch aus der Innenstadt für Langstreckler definitiv noch einigermaßen erträglich. Allerdings kann man sie entlang mehrerer Areale mit den inzwischen praktisch überall gleich aussehenden Super- und Fachmärkten - die bunten Logos der beiden deutschen Billigketten mit jeweils vier Buchstaben lassen sich dort natürlich auch entdecken - nicht wirklich schön nennen.
Wer tatsächlich irgendwo in Connemara Quartier bezogen hat, kann sich jedoch den nicht unbedingt kurzen Weg nach Galway sparen. Auch in Clifden ganz im Westen der Region werden in einem Hotel Startunterlagen verteilt. Allerdings müssen alle, die sie dort in Empfang nehmen wollen, das den Organisatoren bereits im Vorfeld mitteilen, damit diese dort entsprechend deponiert werden können.
 |
 |
| Die erste Meile verläuft in weiten Bögen am Ufer des Lough Inagh ... | ... noch ist das Feld dabei ziemlich dicht |
Bei der Startnummernausgabe muss man sich auch in Galway keineswegs lange aufhalten. Viel zu entdecken gibt es im Hotel nämlich nicht. Der Raum ist nicht wirklich groß und die Laufmesse besteht gerade einmal aus dem Verkaufsstand mit den Souvenirs des Connemara Marathon. Dazu kommen noch eine Handvoll Prospektverteiler für irische Lauf- und Triathlonveranstaltungen und das ziemlich überschaubare Gesamtbild ist bereits fertig.
Vorbei an der Tafel mit der Starterliste, an der sich diejenigen, die ihre Meldebestätigung vergessen haben sollten, noch einmal die ihnen zugeordnete Ziffernfolge heraus suchen können, steuert man den passenden Tisch an und hat innerhalb kürzester Zeit die Tüte in den Händen. Nur die Begutachtung des Bildes beim obligatorische Vorlegen des Reisepasses dauert fast länger als bei der - zugegeben doch eher oberflächlichen - Kontrolle des Grenzpolizisten am Flughafen.
Schon im Vorfeld sortiert eine Helferin die Läufer auseinander. "Marathon straight ahead, Half Marathon to the left". Waren in den Anfangsjahren beide Strecken etwa gleich stark, biegt inzwischen längst der größte Teil an die beiden Tische nach links. Mehr als viermal so dick wird 2011 die Ergebnisliste der Halbdistanz sein. Da die Meldekontingente allerdings gedeckelt sind, zeigen diese Werte nur bedingt, wie das Interesse am Ende tatsächlich verteilt gewesen wäre.
Doch noch eine dritte Streckenlänge wird angeboten. Seit der dritten Auflage kann man nämlich auch einen dreiundsechzig Kilometer langen Ultra laufen. Wobei dieses Rennen bei einem genaueren Blick auf die Karte von Connemara eigentlich sogar eine ziemlich logische Ergänzung des Programms ist.
Der Marathonkurs hat ganz grob gesprochen etwa die Form eines auf den Kopf gestellten "U". Praktisch vollständig auf dessen letzter Kante wird auch der Halbmarathon gelaufen. Es besteht jedoch die Möglichkeit durch Hinzufügen der zum leicht abgerundeten Viereck noch fehlenden Seite, die Runde zu schließen.
Und genau das haben die Organisatoren seit dem Jahr 2004 dann auch getan. Dass dabei, wenn man die Startlinie nur noch ein klein wenig nach hinten nimmt, so dass einige hundert Meter doppelt zurück gelegt werden, ein Lauf über exakt drei halbe Marathons heraus kommt, ist zwar Zufall, aber natürlich ein ganz angenehmer Nebeneffekt, um dem Ganzen ein wenig mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Siebzig Euro sind bei der Meldung fällig, ganz egal welche Strecke man sich aussucht. Insbesondere für einen Halbmarathon scheint das ein ziemlich stolzer Preis zu sein. Doch nüchtern betrachtet müssen abgesehen von einigen Verpflegungsständen, die man auf der kürzeren Strecke weniger benötigt, ja für alle Teilnehmer die gleichen Leistungen erbracht werden.
Eigentlich wäre sogar der Ultramarathon als am pflegeleichtesten zu bezeichnen. Denn dadurch dass auf der geschlossenen Schleife Start- und Ziellinie nicht allzu weit voneinander entfernt sind, könnte man dabei auf den Lastwagen für den Taschentransport, ohne den die beiden anderen Distanzen nicht auskommen, durchaus verzichten.
 |
 |
| Anfangs hängen die Wolken eher tief, der guten Laune tut es anscheinend keinen Abbruch | |
Ein nettes Detail am Rande, das zeigt wie perfektioniert und durchdacht die Abläufe dieser Veranstaltung inzwischen sind, ist übrigens die auf den Kleiderbeutelaufkleber gedruckte Erklärung: "This is your baggage transfer label, please stick it on your transfer bag, this is not your race number". Da steht es eindeutig. Nein, das ist eben nicht die Startnummer, dieses Stück Papier gehört auf die Tasche mit der Wechselbekleidung.
Die hierzulande gelegentlich zu machende Beobachtung, dass die Aufkleber gerade von etwas unerfahrenen Teilnehmern während des Rennen auch einmal auf dem Trikot spazieren getragen werden, sollte mit dieser Bedienungsanleitung ein ganzes Stück unwahrscheinlicher werden. Ein sicher nicht patentrechtlich geschützter Kniff, auf den vielleicht andere Organisatoren durchaus zurück greifen könnten.
Medaille und Funktions-T-Shirt gehören nach dem Zieleinlauf zwar für alle Streckenlängen ebenfalls zum Leistungspaket, doch was die Organisation eben wirklich so verkompliziert und deshalb auch den Betrag ein wenig erklärbar macht, sind die Bustransfers. Die kennt man zwar von Punkt-zu-Punkt-Kursen durchaus zur Genüge. Doch, da sich weder an den Startpunkten noch im Zielbereich ausreichend Parkplätze bieten, sind diese beim Connemara Marathon eben sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg fällig.
Über achtzig Reisebusse sind dafür in einem wohlausgeklügelten Plan den ganzen Tag über im Einsatz. Denn nicht nur aus der Zentrale Galway gilt es schließlich die Teilnehmer heran zu karren. Auch die Marathonzweigstelle in Clifden will angebunden werden. Und zwar an alle drei Startpunkte. Dass man zusätzlich im ein Stückchen westlich von Galway gelegenen Dorf Oughterard noch einen weiteren Haltepunkt eingerichtet hat, macht die Logistik noch ein bisschen komplizierter.
Der Schwerpunkt der Transfers liegt jedoch fast selbstverständlich in Galway. Und so haben sich rund um den Cathedral Car Park, den großen Parkplatz vor der Kathedrale der Stadt am Sonntagmorgen eine erkleckliche Anzahl von Bussen versammelt. Nach einem gut ausgeklügelten Zeitplan werden die Läufer von diesem am Rande der zwar kleinen, aber recht schmucken Innenstadt noch recht zentralen, andererseits aber verkehrstechnisch gut angebundenen Punkt nach Connemara gebracht.
Zuerst bereits um sieben Uhr die Ultras, denn diese starten um neun Uhr als erste. Um acht sind dann die Marathonis an der Reihe, deren Start eineinhalb Stunden später angesetzt ist. Und ganz zum Schluss dürfen dann die Teilnehmer des Halbmarathons in ihre Busse steigen. Denn diese müssen bis zum Mittag warten, bis auch sie auf die Strecke gelassen werden. Von Clifden aus existiert ein ähnlich ausgetüftelter Plan. Da die Entfernungen und Fahrzeiten jedoch anders und zum Teil auch deutlich kürzer sind, ist er jedoch ein wenig versetzt.
Die im ersten Moment ungewöhnlich wirkenden Startzeiten sind natürlich ebenfalls gut durchdacht, kommen so doch die Teilnehmer alle einigermaßen zeitgleich und ohne gar zu große Lücken im Ziel an, so dass sich auch die Busse für den Rücktransport schnell wieder füllen. Außerdem halten sich so die marathonbedingten Verkehrsbehinderungen im nicht unbedingt dichten Straßennetz von Connemara in Grenzen. Und auch die Verpflegungsstände müssen aufgrund der schnell durchmischten Felder nicht übermäßig lange besetzt bleiben.
Das farbige Papier-Armband, das sich neben Startnummer, Kleiderbeutelaufkleber und Zeitmesschip auch noch im Umschlag befunden hatte und das nach den auf diesen aufgedruckten Informationen "unbedingt" zu tragen sei, interessiert beim Einteigen in Wahrheit niemanden. Wer um diese Urzeit mit einem Trainingsanzug gekleidet in den Bus klettert, muss wohl kaum kontrolliert werden.
 |
 |
| Wirklich flach ist der Kurs nur selten ... | ... dafür entschädigt aber immer wieder die Aussicht |
Genauso verhält es sich später übrigens auch in der Verpflegungszone im Ziel, in die man ebenfalls nur mit diesem "participant wrist band" hinein kommen und dort bedient werden sollte. Und auch bei der Rückfahrt, achtet niemand darauf. Es gibt schließlich genug andere Zeichen, an denen die Helfer die Teilnehmer problemlos erkennen können. Eine Startnummer auf dem Bauch oder eine Medaille um den Hals sind jedenfalls selbst ohne Bändchen eindeutig genug.
Selbst für diejenigen, die sich in den Vortagen nicht schon einmal die Strecke angesehen haben, um eine Ahnung davon zu bekommen, was da auf sie zukommen wird, ist schon kurz nach der Abfahrt klar, warum die Busse doch relativ früh starten und für den Transport so viel Zeit veranschlagt ist. Es sind nämlich bis zum Marathon- und Halbmarathonstart von Galway aus nicht nur jeweils stolze sechzig Kilometer zu überbrücken, die Straße ist auch alles andere als gut ausgebaut.
Relativ schmal windet sie sich durch die Außenbezirke der Stadt, nur um hinter dem Ortsschild noch ein bisschen enger, kurviger und damit unübersichtlicher zu werden. Wer in Irland mit dem Auto unterwegs ist, sollte eben Zeit mitbringen. Viel Zeit, denn abgesehen vom Großraum Dublin und der schon erwähnten Querverbindung nach Galway gibt es in der Republik keine Autobahnen.
Selbst manche jener wichtigsten Nationalstraßen, die sternförmig und an einer einstelligen Nummer erkennbar aus dem ganzen Land auf die Hauptstadt zulaufen, zwängt sich immer wieder einmal mitten durch ein Städtchen. Bei weitem nicht überall gibt es Umgehungen für den Fernverkehr. Und je höher die Zahlen der Nummerierung und je größer die Entfernungen von Dublin werden, umso länger sollte man für eine Fahrt kalkulieren.
Selbst wenn manche Einheimische mit beachtlichen - oder besser bedrohlichen Geschwindigkeiten - über diese schmalen Pisten unterwegs sind, in der Regel geht es eher geruhsam zu. Eine überall auf der Grünen Insel zu kaufende, ziemlich selbstironische Postkarte zeigt eine kleine Schafherde auf einer noch kleineren Straße. Dazu trägt sie die dazu passende Aufschrift: "Rushhour in Ireland". Übrigens sollte man tatsächlich jederzeit mit einer solchen Begegnung rechnen.
Jene N59, auf der die Busse nun nach Connemara hinein rollen, ist - wie die zweistellige Ziffernfolge schon zeigt - auch keineswegs eine Nebenstrecke. Sie bildet ganz im Gegenteil die wichtigste sowie abgesehen von einer Route zwischen den beiden großen Seen und einer weiteren entlang der Südküste sogar die einzige Zufahrt in diese doch recht abgelegene Region.
Das allerdings tut die nationale Straße gleich an zwei Stellen. Denn zuerst stellt sie einmal die Verbindung zwischen Galway und Clifden her, um anschließend einen großen Bogen nach Norden und dann zurück nach Osten zu schlagen. An der nordöstlichsten Ecke, am Killary Harbour verlässt sie Connemara dann wieder. Westport und Sligo heißen die weiteren Ziele auf ihrem alles andere als gerade verlaufenden Weg durch Irlands Westen.
Dazu kommen noch zwei Querverbindungen zwischen den beiden Ästen der N59 sowie einige Stichstraßen, die hierzulande wohl kaum mit Schildern versehen werden würden, da sie maximal den Charakter eines etwas besser ausgebauten Feldweges besitzen. Und schon ist das komplette Straßennetz der Gegend vollständig beschrieben.
 |
 |
 |
| Nicht nur bunte Trikots auch die gelben Ginsterhecken am Straßenrand bringen Farbe ins Spiel - Carol Morgan (mitte) ebenfalls in gelb ist die Schnellste auf der Ultradistanz | ||
"Fáilte go Connemara" steht auf der großen Tafel am Straßenrand, was nichts anderes als "Willkommen in Connemara" bedeutet. In Irisch ist der kurze Text verfasst. Nun ist "Fáilte" tatsächlich eine der wenigen Floskeln, die sich aus dem in Irland trotz ihres Status als offiziell erster Landessprache inzwischen nahezu vollständig vom Englischen verdrängten keltischen Idiom im normalen Umgang noch erhalten haben.
Auch die nationale Tourismusagentur, die eine Zeit lang als Namenssponsor des Connemara Marathons auftrat und diesen noch immer unterstützt, heißt schließlich "Fáilte Ireland". Wobei das dann aber doch schon wieder ein wenig inkonsequent ist, denn statt "Irland" hätte man in diesem Fall auch das sprachlich besser passende und durchaus bekannte "Eire" nehmen können.
Allerdings hat das oben genannte Schild in dieser Region sehr wohl noch eine tiefere Bedeutung. Denn zumindest ein Teil davon gehört zum sogenannten "Gaeltacht", jenen immer mehr zurückgedrängten Gebieten, in denen Irisch oder - wie die Eigenbezeichnung lautet - "Gaeilge" wirklich noch im Alltag verwendet wird. Das tun nämlich selbst bei großzügigsten Schätzungen weit weniger als hunderttausend Bewohner der Republik.
Immerhin gut eineinhalb Millionen können sich auf Irisch - die gelegentlich auch zu hörende Bezeichnung "Gälisch" sollte man wegen der möglichen Verwechslung mit der in Schottland benutzten, eng verwandten und ähnlich bedrohten Sprache besser vermeiden - einigermaßen verständigen. Eine Zahl die andererseits ziemlich niedrig erscheint, weil es für alle Schüler zumindest einige Jahre lang Pflichtfach ist.
Doch abgesehen von den Ortsbezeichnungen, die noch immer zweisprachig auf den Straßenschildern zu lesen sind - "Gaillimh" ist zum Beispiel die ursprüngliche Bezeichnung für das anglifizierte "Galway" - befindet sich Irisch seit Jahrhunderten ständig weiter auf dem Rückzug. Während der britischen Oberhoheit war es insbesondere für den sozialen Aufstieg einfach nötig, die Sprache der Landesherren zu sprechen. Nur in den ländlichen Gebieten konnten sich die ursprünglichen Dialekte behaupten.
Ein Trend, der sich trotz aller Bemühungen der Regierung auch nach der Erlangung der Unabhängigkeit nicht mehr umkehren ließ. Längst hat sich das Englische - obwohl laut Verfassung nur Zweitsprache - überall durchgesetzt. Und die modernen Massenmedien, die auch weiterhin engen Beziehungen zum britischen Nachbarn sowie eine immer stärkere Globalisierung werden wohl über kurz oder lang dafür sorgen, dass Gaeilge endgültig verschwinden wird.
Die romantisch-idealistischen Revitalisierungsversuche der einst als "bäuerlich" verpönten Sprache, die es - Ironie der Geschichte - inzwischen ausgerechnet in einigen Kreisen des sogenannten Bildungsbürgertums gibt, kommen vermutlich zu spät. Selbst den wenigen noch vorhandenen Muttersprachlern bleibt ja meist gar nichts anderes übrig, als zusätzlich noch Englisch zu beherrschen.
Eine Version der Internetseite auf Irisch, wie man es aus anderen zweisprachigen Ländern kennt und eigentlich gerade in diesem Fall erwarten würde, hat jedenfalls nicht einmal der zum Teil mitten durch das Gaeltacht führende Connemara Marathon. Doch ist das abgesehen vom ein Stück weiter südlich ebenfalls im Gaeltacht stattfindenden Lauf über die Dingle-Halbinsel auch bei allen anderen Marathons des Landes so.
 |
 |
| Mitten in der Landschaft steht eine einsame Kirche am Straßenrand | Immer wieder ist die weite Heidelandschaft mit kleineren oder größeren Seen gesprenkelt |
Rund fünfundzwanzig Kilometer ist der Bus schon unterwegs, als er nach Oughterard hinein rollt, jener dritten Ortschaft, von der es ein - allerdings eingeschränktes - Busangebot zu den Startpunkten gibt. Nicht dass hier die Zahl an Übernachtungsmöglichkeiten überwältigend wäre, doch am Sportplatz des Tausend-Seelen-Dörfchens hat man ausreichend Parkplätze, um alle, die mit dem Auto anreisen wollen, abzufangen und einzusammeln.
Eine Helferin in leuchtend gelber Warnweste, die an dieser Stelle den Verkehr ein wenig ordnet, signalisiert dem Fahrer, dass er doch bitteschön einmal anhalten sollte. Nachdem sie in den Bus geklettert ist, fragt sie freundlich, ob nicht doch eine Handvoll Freiwillige aussteigen und auf einen späteren Bus warten wollten. Sie hätte da nämlich noch einige Walker, die so schnell wie möglich zum Start gebracht werden müssten.
Und tatsächlich, wer sich die Ausschreibung genauer angesehen hat, dem ist aufgefallen, dass da etwas von einer zweiten Startzeit bereits um 9:30 zu lesen war. Auch beim Halbmarathon können die Langsamen bereits eine Stunde vorher, also um elf Uhr auf die Strecke gehen. Dabei sind jedoch wirklich nur bessere Wanderer gemeint.
Die Infos auf dem Startnummernumschlag erläutern noch einmal ganz klar, dass jeder der auch nur darüber nachdenke, ob er nicht vielleicht ein Walker sein, dort nichts zu suchen hätte. Ein auf eine Zeit von drei Stunden für den Halbmarathon hinauslaufendes Leistungsvermögen sei noch lange kein Grund für einen vorgezogenen Start.
Und außerdem gäbe es eine ganz klare Regel. Wer bei zehn Meilen vor den Spitzenläufern durchkäme, würde definitiv disqualifiziert. Dass die schnellste, nur gut zweieinhalb Stunden benötigende Walkerin auf der Halbdistanz in der Wertung bleiben wird, liegt dann später auch hauptsächlich an den guten Ergebnissen der Sieger und Platzierten.
Die Mehrzahl der knapp zweihundert Marschierer auf der Kurzstrecke wird allerdings tatsächlich jenseits der genannten drei Stunden im Ziel ankommen. Beim Marathon ist das Ganze deutlich überschaubarer. Nur etwa ein Dutzend Teilnehmer wird die Möglichkeit früher auf die Reise zu gehen nutzen und dann zwischen fünf und acht Stunden für die zweiundvierzig Kilometer benötigen.
Was man auf der Fahrt bis Oughterard bisher zu sehen bekam, hatte durchaus noch etwas mit dem "typischen Irland" zu tun, das man aus Filmen, Büchern oder vielleicht sogar eigener Anschauung zu kennen glaubt. Immer wieder einmal waren jene einzelnen Häuser oder Häusergruppen passiert worden, mit denen die Ortschaften rund um die engbebauten Kerne in die Landschaft hinaus tröpfeln und die es eigentlich unmöglich machen zu entscheiden, wo welche Siedlung beginnt oder endet.
Dazwischen konnte man, falls die Hecken am Straßenrand einmal die Sicht freigegeben hatten, jene klassischen grünen Wiesen mit den genauso klassischen Feldsteinmauern entdecken, denen man praktisch überall auf der Insel begegnet. Oder man konnte sogar ab und zu einmal einen Blick auf einen der unzähligen Seitenarme des Lough Corrib erhaschen.
 |
 |
 |
| Eine ganze Zeit lang bleibt der Kurs auf einem
welligen Plateau ... |
... bevor er sich zum Meer hinunter senkt | |
Doch schon die Reklametafel "Last supermarket before Clifden", mit der das örtliche Lebensmittelgeschäft seine Dienste anpreist, macht ein wenig stutzig. Schließlich kann man sich anhand der Entfernungsangaben, die in Galway auf den Straßenschildern zu lesen waren, ausrechnen, dass es bis dorthin selbst auf kürzestem Weg noch deutlich weiter als die Distanz eines Marathons sein muss. Und dazwischen soll es keine Einkaufsmöglichkeit mehr geben?
Natürlich stimmt die Aussage, denn nachdem der Bus die dicht gedrängten und leuchtend bunten Häuser - ein besonders schönes Exemplar auch noch auf alte Art mit Reet gedeckt - hinter sich gelassen und auch die enge S-Kurve auf der Brücke über den das Dörfchen durchfließenden Bach überwunden hat, ändert sich das Bild fast schlagartig.
Statt grün dominieren auf einmal Brauntöne. Die gewohnten satten Wiesen haben sich in die eher karge Vegetation einer Moor- und Heidelandschaft verwandelt. Nur die allgegenwärtigen, leuchtend gelben Blüten der Ginsterbüsche bringen dann doch etwas mehr an Farbe ins Spiel. Vor allem ist die Gegend jedoch auf einmal weit und offen. Die Mauern sind verschwunden, keine Hecke oder Baumreihe verstellt mehr die Sicht.
Wenn die doch an diesem Morgen eher tief hängenden Wolken einmal aufreißen, lassen sich kahle Berge am Horizont erkennen. Bis auf eine Höhe von über siebenhundert Meter schwingen sie sich auf. Das ist durchaus normal in der eher ungewöhnlichen Geographie der Grünen Insel, bei der eine zentrale Ebene fast vollständig durch einen Ring von Bergen umschlossen ist.
Und obwohl diese für mitteleuropäische Verhältnisse gerade einmal Mittelgebirgsniveau - die höchste Erhebung Irlands ist mit 1041 Metern der Carrauntuohill im Südwesten - erreichen, werden sie insbesondere im westlichen Teil der Insel ziemlich schroff, bilden dabei nicht gerade selten dramatische Steilküsten und Klippenformationen.
Von den eher lieblichen Hügeln in der Mitte des Landes unterscheidet sich diese Landschaft jedenfalls deutlich. Jetzt erst ist man im eigentlichen Connemara angekommen, im rauen, im ursprünglichen Connemara. In jenem Connemara, das in Prospekten mit dem Spruch "wild at heart" für sich wirbt. Willkommen in Irlands wildem Westen.
Dieser Westen war einst die Heimat des Stammes der Conmhaicne, einer keltischen Volksgruppe, die ihre Herkunft auf einen mythischen Helden namens Conn zurück führte. Noch heute lebt dieser Name in leicht abgewandelter Form in der Bezeichnung "Connacht" - oder in der inzwischen wieder ziemlich unüblichen englischen Variante "Connaught" - fort. So heißt nämlich die westliche der vier traditionellen Provinzen Irlands. Die anderen drei sind Ulster im Norden, Leinster im Osten sowie Munster im Süden und Südwesten
Während diese sich in der Größe nicht viel geben - Connacht ist zwar die Kleinste im Quartett, aber selbst Munster als Größte hat nur etwa ein Drittel mehr an Fläche - verteilt sich die Bevölkerung doch recht ungleichmäßig. Denn Leinster, in dem sich ja der Großraum Dublin befindet, und Ulster - das entgegen der hierzulande oft benutzten Gleichsetzung eben nicht nur das britische Nordirland sondern auch noch drei Grafschaften der Republik umfasst - kommen jeweils auf über zwei Millionen.
Connacht kann dagegen gerade einmal eine halbe Million Menschen bieten. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die übrigen Counties Mayo, Sligo, Leitrim und Roscommon keineswegs dichter besiedelt sein können als Galway. Genau genommen hat sogar keines von ihnen mehr Einwohner als die Stadt Galway alleine. Doch abgesehen von der bereits wieder im Tiefland gelegenen Grafschaften Roscommon sind diese eben alle auch von ziemlich gebirgiger Natur.
 |
 |
| Am Killary Harbour, einem der wenige echten Fjorde an der dennoch wild zerfurchten irischen Westküste ist kurz vor der Halbzeitmarke auf Meereshöhe der niedrigste Punkt der Strecke erreicht | |
So ist es dann irgendwie auch wenig verwunderlich, dass die Rugby-Auswahlmannschaft der Provinz, die zusammen mit der inneririschen Konkurrenz, vier walisischen sowie zwei schottischen und neuerdings zwei italienischen Teams in einer gemeinsamen Profi-Liga spielt, meist nur einen der hintersten Plätze belegt.
Beim Heineken-Cup, einer Art Europapokal im Rugby, dessen Übertragungen während des Marathonwochenendes auch über die irischen Bildschirme flimmern, ist man im Gegensatz zu den anderen drei Teams von der Grünen Insel auch diesmal nicht dabei. Dennoch sieht man immer wieder einmal Fahnen mit dem ziemlich ungewöhnlichen Logo der Mannschaft flattern, das an das genauso ungewöhnliche Wappen von Connacht angelehnt ist. Auf der linken Hälfte zeigen beide nämlich einen Adler, auf der rechten einen Arm mit einem Schwert.
Und - man hatte es beinahe schon vermutet - natürlich auch der Name Connemara hängt ziemlich direkt mit der Nachkommenschaft des Recken Conn zusammen. Eine Gruppe der Conmhaicne siedelte sich nämlich ganz weit im Westen direkt am Meer an. Diese wurden deshalb dann Conmhaicne Mara - Conmhaicne des Meeres - genannt. Eine Bezeichnung, die sich im Lauf der Jahrhunderte verkürzte und auf ihre raue, karge Heimat übertrug.
Irgendwie ist es fast schon logisch, dass sich auch der Straßenbelag der Landschaft rundherum angepasst hat und nun noch ein ganzes Stück rauer und unebener geworden ist als ohnehin schon. Selbst wenn der Bus noch über Asphalt rollt - oder zumindest das, was man in Irland darunter versteht - eine Teststrecke für seine Stoßdämpfer stellt die Piste, die ja immerhin als eine Nationalstraße der zweiten Kategorie gilt, schon dar.
Die Läufer auf dem Weg zu ihren Startplätzen werden dabei ganz schön durchgeschüttelt. In ständig neue Richtungen wackeln die Köpfe. Noch ist das kein wirkliches Problem. Auf der Rückfahrt allerdings wird das Geschaukel - wie man hören und gegebenenfalls auch kaum überhören kann - für den einen oder anderen zuvor schon grenzbelasteten Magen dann doch ein wenig zu viel werden.
Fünfzehn Kilometer hinter Oughterard taucht mitten in der weiten Landschaft eine Straßenkreuzung mit einigen wenigen Häusern auf. Ein kleines Hotel, eine Tankstelle, einige landwirtschaftliche Hallen, das ist Maam Cross. Wären da noch die hohen Leuchtreklamen, könnte man sich bei dieser Ausstattung fast schon in einem amerikanischen Roadmovie wähnen. Irlands wilder Westen eben.
Diese scheinbar zufällig im Gelände platzierte Wegkreuzung ist das Ziel, das man einige Stunden später ansteuern wird. Und eben auch der Start für den Ultra, wie die jetzt in regelmäßigem Abstand am Straßenrand auftauchenden Markierungen eindeutig zeigen. Von nun an sind die Busse nämlich auf deren Laufstrecke unterwegs.
Noch etliche weitere Minuten dauert das Geholper auf der N59, dann biegt der Bus nach rechts in ein mit R344 nummeriertes Sträßchen ein. Absolut nicht verwunderlich ist, dass diese Regionalstraße - das bedeutet der Buchstabe "R" nämlich tatsächlich - beileibe keinen besseren Ausbaugrad hat als die nationale Hauptverbindungsstrecke.
Inzwischen ist man seit der Abfahrt in Galway rund eine Stunde unterwegs gewesen und noch immer ist der Startpunkt nicht erreicht. Einige Kilometer gilt es noch zurück zu legen, bis der Bus plötzlich hält. Zu sehen ist an dieser Stelle nicht wirklich viel. Links der Straße erstreckt sich ein See, rechts beginnt direkt hinter dem Graben ein Hang. Aussteigen bitte.
"Right in the middle of nowhere". Man muss nicht viel mehr als diese übersetzt etwa "mitten im Nirgendwo" bedeutende, im Englischen aber doch ein wenig flüssiger klingende Redewendung sagen, um diesen Platz zu beschreiben. Nachdem man seine Blicke ein wenig hat wandern lassen, entdeckt man irgendwo am Straßenrand dann eine kleine Reihe jener allseits bekannten blauen Häuschen. Und auch ein großer Lastwagen, der wie leicht zu kombinieren ist das Läufergepäck zum Ziel bringen soll, ist dort geparkt. Ansonsten Fehlanzeige.
Ein Starttransparent oder gar eines jener wuchtigen, mit Sponsorenlogos vollgepflasterten Stahlgerüste, wie man es von den großen Stadtmarathons kennt, sucht man jedenfalls vergeblich. Mit ein bisschen Mühe lässt sich ein Stück die Straße hoch gerade noch eine kleine Tafel entdecken, die den genauen Ort markiert, an dem es später losgehen soll. Von lauter Musik oder einem nervigen Ansager, der - oft ja ohne die geringste Ahnung von der Materie - versucht, die Läufer anzuheizen, ist ebenfalls nichts zu hören.
So bleibt den auf den Start Wartenden dann auch die Peinlichkeit erspart, zu "der La-Ola-Welle" genötigt zu werden. Schließlich ist alleine die Bezeichnung schon peinlich und albern genug, stellt doch "La" sowieso nur den Artikel "die" dar und "Ola" bedeutet übersetzt nichts anderes als "Welle". "Die die Welle Welle" ist also kaum mehr als eine besondere Art des Stotterns.
Und das Publikum, das so ein Dampfplauderer mit seinen Sprüchen zusätzlich zu den Teilnehmern auch noch unterhalten - oder nerven - könnte, würde an dieser Stelle gerade einmal aus einigen am Hang verstreuten Schafen bestehen. Nein, wer die Partystimmung eines "Events" sucht, wer bei seiner "Heldentat" gesehen und dafür gefeiert werden will, der ist im irischen Westen völlig fehl am Platz.
Bus um Bus rollt an und spuckt seine menschliche Fracht aus. Einige Teilnehmer werden zudem von Freunden oder Familienangehörigen auch direkt mit dem Auto vorbeigebracht. Das soll zwar eigentlich nicht sein, doch die Route ist schließlich offen. Und wenn die Privattaxis anschließend gleich weiter fahren, gibt es eigentlich auch nicht viel dagegen zu sagen.
Langsam füllen sich die Straßenränder. Denn vielmehr als dort darauf warten, dass es irgendwann losgeht, kann man in dieser Einöde kaum tun. Einige Ordner versuchen das Läufervolk mit nicht immer durchschlagendem Erfolg auf die rechte Seite zu komplimentieren, damit auf der anderen Spur - man fährt ja links - der Zubringerverkehr in einer Art Einbahnstraßensystem einfach durchrollen kann. Einen vernünftigen Wendeplatz würden die Fahrer ohnehin nicht finden.
Einer aus dieser überschaubaren Helferzahl, die versucht ein wenig Ordnung ins doch langsam entstehende Gewimmel zu bringen, trägt eine knallgelbe Signaljacke mit der Aufschrift "race director". Es ist tatsächlich Rennleiter Ray O'Connor, der - abgesehen von einigen zwischendurch geführten Telefonaten mit anderen Schauplätzen der weitverzeigten Logistik - ständig und überall persönlich mit Hand anlegt.
Ihm ist es vermutlich aber auch lieber, mittendrin zu sein als irgendwo nur aus der Distanz zu koordinieren. Denn im Normalfall stünde er viel eher mit kurzen Hosen und Lauftrikot mit hinter der Startlinie. Eine dreistellige Zahl von Marathons hat er nämlich schon für seinen Verein Athenry AC absolviert. Und ist dabei auch ein bisschen in der Welt rumgekommen.
Irgendwann muss ihm dabei auch die Idee gekommen sein, der Welt die Schönheit seiner Heimat im irischen Westen zu zeigen. Das Konzept hat gegriffen. Was ein Jahrzehnt zuvor mit nicht einmal einhundert Teilnehmern begann, ist - insbesondere wenn man die Maßstäbe der Region anlegt - nun zu einer echten Großveranstaltung geworden, die weit über dreitausend Menschen in Bewegung bringt.
Und obwohl sich in diesem Jahr in Dublin mit dem über zehn Kilometer führenden und etliche tausend Teilnehmer anziehenden Great Ireland Run eine mächtige Konkurrenz bietet, die zudem auch gleichzeitig noch als irische Straßenlauf-Meisterschaft ausgeschrieben ist, sind die vorhandenen Meldekontingente des Connemara Marathons wieder einmal viele Monate im Voraus ausgeschöpft. Und zwar wie die gleiche Erfahrung in den Vorjahren zeigt, beileibe nicht nur wegen des Jubiläums.
Selbst als sich der Start der Läufer - die Walker sind ja schon geraume Zeit auf der Strecke - langsam nähert, längst alle Busse durch sein müssten, die meisten der Kleiderbeutel bereits auf dem Laster gelandet sind und auf der Straße höchstens noch mit einem Nachzügler mit eigenem Fahrdienst oder früh aufgebrochenen Touristen zu rechnen ist, versuchen die Ordner weiterhin, die Teilnehmer dazu zu bewegen nach rechts zu gehen.
Sie versuchen es sogar noch eindringlicher als zuvor. Das "this is your side" und das ständige Winken mit den Armen, ist ziemlich eindeutig. Nur auf der einen Spur soll die Startaufstellung vorgenommen werden. Denn - man kennt auf Seite der Organisatoren ja die Abläufe inzwischen ganz gut - jederzeit kann auf der anderen die Spitze des Ultrafeldes vorbei kommen.
Und tatsächlich rauscht wenige Minuten vor dem Marathonstart hinter dem Führungsfahrzeug eine Vierergruppe mit Garrett Crossan, Martin Rea, Piotr Zienkiewicz und Vasily Neumeritski am nahezu vollständig angetretenen Spalier der "Mittelstreckler" vorbei. Nach gerade einmal 1:25:26 löst der Erste von ihnen die inzwischen verlegte Zeitnahmematte aus. Und bevor sich die Marathonis auf die Verfolgung begeben dürfen, holen sich auch noch Shane James Whitty, Ivan Slovak und Mick Rice einen kleinen Vorsprung auf sie heraus
Doch dann um Punkt halb elf dürfen auch die am Lough Inagh - so heißt nämlich der See neben der Startlinie - Versammelten auf die Strecke. Dass dieser zwar nur wenige hundert Meter breit andererseits aber auch keineswegs wirklich klein ist, wird spätestens nach den ersten Kurven der in weiten Bögen am Ufer entlang verlaufenden Straße klar. Denn hinter keiner von ihnen ist das Ende der Wasserfläche zu erkennen.
Rund fünf Kilometer lang zieht er sich durch das Tal, mit dem er den Namen teilt, das Inagh Valley - oder um eine andere Variante zu nutzen, das Glen Inagh. So sieht es zwar ein wenig irischer aus, ist allerdings dennoch eine anglifizierte Form. In Gaeilge würde es zwar kaum anders ausgesprochen, hätte aber als Gleann Eidhneach trotzdem eine beträchtliche Anzahl Buchstaben mehr. Doch ganz unabhängig davon, wie man es auch schreibt, in diesem Gletschertal wird das erste Viertel des Marathons gelaufen.
Wobei man in das Wörtchen "Tal" nicht allzu viele Hoffnungen setzen sollte, denn schon bald schlägt die Straße nicht nur seitliche Haken sondern wellt sich auch ein wenig nach oben und unten. Das ist zwar alles noch nicht wirklich heftig. Mehr als zehn oder zwanzig Höhenmeter geht es im Glen Inagh eigentlich nicht auf und ab. Doch erstens passiert dies in schöner Regelmäßigkeit und zweitens gibt es schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was später noch kommen wird.
Längst ist die Zeit vorbei, nach der man die erste Kilometermarke erwartet hätte. Doch noch immer ist kein Schild zu sehen. Wer sich im Vorfeld nicht informiert hat, geht beinahe schon davon aus, die Tafel verpasst zu haben und stellt sich schon darauf ein, dann eben am zweiten Kilometer die Zwischenzeit zu kontrollieren, da taucht am Straßenrand doch noch eine "1" auf. "Mile" steht darunter. Und das ist dann auch des Rätsels Lösung. Nicht 42 Kilometer und 195 Meter werden in Connemara gelaufen sondern 26 Meilen und 385 Yards.
Deshalb standen ja auch die Zahlentafeln des Ultralaufs, an denen man auf der N59 mit dem Bus vorbei gefahren ist, so weit auseinander. Denn auch die Ganzlangstreckler sind eben nicht auf einer dreiundsechzig Kilometer langen Distanz unterwegs, sie absolvieren "nur" neununddreißig Meilen. Dass ihre Startnummern alle mit genau dieser Zahl beginnen, ist also nicht wirklich unlogisch.
Dennoch ist das Ganze eigentlich ein wenig verwunderlich. Denn vor einigen Jahren hat man in Irland endgültig komplett vom "imperialen" britischen auf das metrische System umgestellt. Abgesehen von vielleicht irgendwelchen Neben-Neben-Strecken, auf denen man das eine oder andere Schild vergessen haben könnte, ist inzwischen die gesamte Straßenbeschilderung ausgetauscht und lautet nun auf die international üblichen Maßeinheiten, denen sich neben Briten eigentlich nur noch die Amerikaner widersetzen.
Entfernungen werden in der Republik jetzt in Kilometern angegeben, Geschwindigkeiten in Kilometer pro Stunde. Um gefährlichen Fehlinterpretationen - gerade bezüglich des erlaubten Tempos - durch die daran nicht gewöhnten Untertanen der zweiten Elizabeth von jenseits der offenen inneririschen Grenzen vorzubeugen, erwähnt man das gelegentlich sogar noch einmal ganz explizit.
Die Umstellung in den Köpfen der Marathonläufer dauert anscheinend jedoch etwas länger. Bis die magische Zahl 42 und nicht mehr 26 lautet, wird wohl auch in Irland noch ein bisschen Zeit vergehen. Doch es soll ja auch hierzulande noch immer Leute geben, die selbst zehn Jahre nach der Euroeinführung Preise weiterhin stur in Mark umrechnen. Da seien den Iren ihre Probleme mit dem für sie deutlich jüngeren Kilometer noch einmal nachgesehen.
In der Nähe dieses ersten Meilenschildes entfernt sich die Straße ein wenig vom Seeufer, an dem sie sich bisher ziemlich streng orientiert hatte. Eine erste deutlich spürbare Steigung führt hinauf in ein kleines Wäldchen. Was anderswo für einen Landschaftslauf - nichts anderes ist der Connemara Marathon nämlich, selbst wenn er vollständig über Asphalt führt - absolut normal wäre, kann in Irland durchaus besonders hervor gehoben werden.
 |
 |
| Nur ganz selten steht einmal ein einzelnes Haus an der Strecke ... | ... meist läuft man durch eine weite und einsame Landschaft |
Denn kaum zehn Prozent der Insel sind bewaldet. Meist handelt es sich dabei allerdings nur um kleinere Restbestände oder Neupflanzungen, mit denen man inzwischen versucht, den Anteil zumindest ein bisschen zu heben. Größere zusammenhängende Forstflächen gibt es dagegen praktisch nicht. Und so ist der gerade durchlaufene Wald zumindest von seiner Ausdehnung her durchaus typisch.
Da auf dem kargen Moorboden jedoch eher genügsame Nadelhölzer als wuchtige Eichen gedeihen, ist die Vegetation dann doch ein wenig anders. Noch mehrfach wird man während des Rennens unterwegs auf solche Waldstücke, die in Connemara gar nicht einmal so selten sind, treffen. Doch der größte Teil des Laufes führt über völlig offenes Gelände.
Dort wo die Bäume anfangen, steht ein Wohnmobil am Straßenrand. Der Fahrer hat eine der wenigen vorhandenen Möglichkeiten genutzt, um es abzustellen. Die Camper haben es sich mit einer Tasse Kaffee auf Klappstühlchen vor ihrem mobilen Heim bequem gemacht und beklatschen die an ihnen vorbei kommenden Marathonis. Es sind die ersten Zuschauer überhaupt. Irlands Westen ist zwar auch ein wenig wild, vor allem ist er aber ziemlich einsam.
Kaum zu glauben, dass ausgerechnet in dieser Einöde Technikgeschichte geschrieben wurde. Doch der italienisch-irische Funkpionier Guglielmo Marconi, der in den Jahren zuvor bereits die ersten Signale und Botschaften nach Amerika gesendet hatte, betrieb seit 1907 in der Nähe von Clifden eine dauerhafte Station für seinen transatlantischen Telegrafendienst.
Unweit dieser Stelle gibt es ein weiteres Denkmal, das an eine Ozeanüberquerung erinnert. Es markiert den Platz, an dem John Alcock und Arthur Whitten Brown im Juni 1919 ihre Atlantiküberquerung per Flugzeug beendeten. Entgegen der landläufigen und weitverbreiteten Meinung wurde diese Leistung nämlich keineswegs von Charles Lindbergh vollbracht. Diesem gelang später nur die erste Alleinüberquerung, die gleichzeitig auch der Direktflug von New York nach Paris war.
Die beiden Briten - Alcock als Pilot, Whitten Brown als Navigator - waren jedoch bereits acht Jahre zuvor vom damals zu ihrem Weltreich gehörenden Neufundland ins zur jener Zeit ebenfalls noch britische Irland geflogen, was zwar eine deutlich kürzere Strecke, aber eben dennoch ein Transatlantikflug war. Dennoch erinnert sich praktisch niemand mehr an sie. Nicht immer wird Ruhm eben gerecht verteilt. Zumindest die von der Zeitung Daily Mail ausgelobte Prämie von immerhin zehntausend Pfund erhielten sie.
Eventuell spielt bei alledem eine Rolle, dass ihre Landung im Gegensatz zu der Lindberghs nicht wirklich triumphal verlief. Denn nicht nur dass sie fernab jeglicher Öffentlichkeit wieder auf den Boden kamen, die aus der Luft ausgewählte Wiese stellte sich auch als Teil eines - in Connemara eigentlich kaum verwunderlich - Moores heraus, in dem die Räder prompt stecken blieben. Die Maschine kippte nach vorne und stellte sich wenig elegant auf der Nase. Der erste Flug über den Atlantik endete also mit einer sauberen Bruchlandung, die Alcock und Whitten Brown allerdings heil überstanden.
Fast zwei Meilen hat man schon in den Beinen, als auf der anderen Seite des Wäldchens mit der Lough Inagh Lodge das nächste Zeichen menschlicher Zivilisation auftaucht. Wer in diesem Hotel weit mehr als ein Dutzend Kilometer von jeder noch so kleinen Siedlung entfernt übernachtet, der ist ganz sicher nicht auf der Suche nach Trubel und Hektik.
 |
 |
| In stetigem auf und ab läuft man durchs Maam Valley ... | ... zwischen über siebenhundert Meter hohen kahlen Bergen |
Angler steigen in ihm vielleicht ab, die im noch immer nicht allzu weit entfernten See oder in einem der ihm zuströmenden Bäche in aller Ruhe ihre Fische fangen möchten. Oder eventuell auch Wanderer, die ihre Schuhe schnüren, um durch die beiden das Tal begrenzenden Bergketten zu streifen.
Dabei darf man zwar noch kein dicht ausgebautes und gut beschildertes Wegenetz erwarten, wie man es aus Mitteleuropa kennt. Doch auch in Irland hat man inzwischen so manche Markierung gesetzt und vermarktet eine ganze Reihe von Fernwanderwegen. So folgt zum Beispiel der in Oughterard beginnende und hinüber ins County Mayo führende Western Way ebenfalls dem Inagh-Tal.
Dazu muss er die Maumturk Mountains oder kurz Maumturks überqueren, die sich rechts der Läufer erheben. Dass sich die Iren selbst nicht ganz einig sind und gelegentlich auch Maamturks schreiben, hängt natürlich wieder damit zusammen, dass die ursprüngliche, die irische Variante Mhám Toirc irgendwie lautmalerisch der englischen Sprache angepasst werden sollte.
Die andere, die aus Läufersicht linke Talseite begrenzen die Twelve Bens, wo man mit dem 729 Meter hohen Benbaun - oder im irischen Original Binn Bhán - auch die höchste Erhebung von Connemara findet. Zwar könnte man, je nachdem welche Definition man wählt, natürlich auch durchaus mehr als zwölf Berge oder Gipfel - nichts anderes meint das irische "Binn" nämlich - aus dem Höhenzug heraus deuten, doch die zwölf hat sich als Name eingebürgert.
Wenn man es wörtlich nimmt zwar ziemlich schlecht übersetzt, aber nicht völlig unpassend ist die Bezeichnung "Twelve Pins", "die zwölf Kegel", der man gelegentlich ebenfalls begegnen kann. Denn im Gegensatz zu den fast genauso hohen Maamturks ist ihr westliches Gegenstück wesentlich stärker aufgegliedert. Und mit etwas Phantasie kann man sogar tatsächlich in der einen oder anderen Erhebung eine Kegelform zuerkennen.
Die Marathonis - und auch die Ultramarathonläufer, deren Vorderfeld sich langsam mit den am Lough Inagh Gestarteten vermischt - müssen sich, falls sie in den vergangenen Tagen nicht schon einmal bei besserem Wetter in der Gegend waren, zu dieser Feststellung allerdings auf Fotos verlassen. Denn die oberen Teile der Berge verstecken sich zumeist hinter tief hängenden Wolken.
Ansonsten präsentiert sich das Wetter allerdings keineswegs umpassend für einen Marathon. Angesichts von Temperaturen zwischen zehn und fünfzehn Grad - in der später gelegentlich durchbrechenden Sonne sogar noch etwas mehr - kann man sich Anfang April nun wahrlich nicht beschweren.
Auch der Wind, mit dem man so nahe am Meer natürlich stets rechnen muss, ist zwar spürbar. Er hält sich jedoch in Grenzen. Da er zudem aus südwestlicher Richtung weht, haben die Läufer ihn erst einmal im Rücken. Vor allen Dingen ist es aber trocken, was im ziemlich regenreichen irischen Westen - es fällt im Schnitt mehr als doppelt so viel Niederschlag wie in Deutschland - durchaus positiv zu erwähnen ist.
Der eine oder andere, der während der untätigen Wartezeit am Lough Inagh ein wenig ins Frösteln kam, hat vielleicht dann doch eine Schicht zu viel angelegt. Die meisten sind allerdings tatsächlich in kurz-kurz unterwegs. Sowohl die Iren wie auch die - natürlich ebenfalls in großer Zahl angetretenen - Briten sind schließlich oft wesentlich ungemütlichere Bedingungen gewohnt.
Noch immer läuft das sich langsam auseinander ziehende Feld hauptsächlich auf der rechten Straßenseite. Denn diese Straße ist auch während des Rennens nicht vollständig gesperrt und links fließt der Verkehr. Nun ja, er quält sich eher an den Marathonis vorbei. Denn selbst wenn die meisten Fahrzeuge in die gleiche Richtung wie diese unterwegs sind, immer wieder kommen auch einmal welche - ebenfalls links, also auf der aus ihrer Sicht falschen Spur - aus der Gegenrichtung.
Das führt wegen der dann nötigen Ausweichaktionen, für die ja auf der irgendwie nur noch halb so breiten Straße eigentlich gar kein Platz vorhanden ist, dann oft genug zum völligen Stocken. Zumindest anfangs, bis die Läufer sich weit genug über den Kurs verstreut haben, geht es auf vier Rädern kaum schneller voran als zu Fuß.
Und manches Auto kommt sogar gleich mehrfach vorbei, nur um wenig später selbst wieder überholt zu werden, wenn es am nächsten Engpass wieder hängen geblieben ist. Da sie zumeist jedoch zum Marathontross gehören, ist das für die Insassen, die so eventuell gleich mehrfach Gelegenheit haben, ihren ganz speziellen Favoriten zuzujubeln, manchmal gar nicht so schlimm.
Ärger und Probleme gibt es dennoch keine. Man mag sich kaum vorstellen, was in dem Land am Mittelmeer, das nicht nur eine Flagge besitzt, die der irischen ziemlich ähnlich ist, sondern auch noch ebenfalls mit einem "I" beginnt, unter diesen Umständen passiert wäre. Zumindest seinen Schimpfwort- und Kraftausdruckwortschatz hätte man wohl deutlich erweitern können.
Doch die Iren sind eben keine Italiener. Die Hand wandert bei ihnen nicht gleich zur Hupe, wenn während der Fahrt irgendetwas nicht so läuft wie erwartet. Und gerade in ländlichen Regionen wie im Westen hat man vermutlich einfach noch ein bisschen mehr Zeit sowie die Ruhe und Gelassenheit, um sich wegen einer Viertelstunde Verzögerung nicht gleich aufzuregen und verrückt zu machen.
Inzwischen ist die erste Verpflegungsstelle erreicht. Im Abstand von ungefähr drei Meilen sind sie über die Strecke verteilt, was ziemlich genau dem bekannten Fünf-Kilometer-Rhythmus entspricht. Wenn man mit Hitzeschlachten rechnen müsste, wäre das vermutlich eher dürftig. Für ein normales irisches Aprilwetter ist die Versorgungsdichte allerdings durchaus ausreichend.
Dafür ist das Angebot nicht wirklich breit. Denn in der Regel reichen die eifrigen Helfer nichts anderes als Mineralwasser. Dieses wird jedoch immerhin in kleinen Plastikflaschen ausgeteilt, so dass es mit der ausreichenden Flüssigkeitsaufnahme kaum Probleme gibt. Ganze Paletten davon hat man aus dem Lastwagen des Getränkesponsors jeweils ausgeladen.
Wer an regelmäßige Zuckerstöße gewöhnt ist, sollte jedoch das Mitnehmen von zusätzlichem Proviant in Erwägung ziehen. Denn gerade einmal an drei von acht Posten werden neben Wasser auch noch Elektrolytgetränke ausgegeben. Bei Meile neun, zwischen Meile achtzehn und neunzehn sowie bei Meile zweiundzwanzig.
Und feste Nahrung wie Obst oder Riegel sucht man endgültig vergeblich. Das Weingummi, das man bei Meile zweiundzwanzig als - aus mitteleuropäischer Sicht ziemlich schräge, im angelsächsischen Sprachraum aber durchaus nicht unübliche - Alternative in einer großen Dose hingehalten bekommt, kann da nur bedingt als Ersatz dienen.
Die Straße senkt sich. Doch nur, um auf der anderen Seite umso höher nach oben zu steigen. Mindestens eine Meile - bleiben wir einfach einmal bei dieser Maßeinheit - lässt sie sich einsehen. Die nächsten Kuppen kündigen sich in dieser weiten, ursprünglichen Landschaft ziemlich frühzeitig an.
Ja, ja, das sei schon ein etwas anderes Irland, stimmt Shane Martin - die Reihenfolge ist richtig, denn "Shane" ist als Variante von "Sean" ein nicht einmal unüblicher Vorname - zu. So offen wäre seine Heimat tatsächlich eher selten. Und ja, es gäbe in Connemara nicht nur praktisch keine Steinmauern, auch die efeubewachsenen Ruinen von Burgen, Klöstern oder Kirchen würden fehlen. Das stimmt tatsächlich, sonst begegnet man ihnen allerdings überall im Land auf Schritt und Tritt.
Von den viel besungenen "fourty shades of green", den vierzig verschiedenen Arten von Grün, die man auf der Insel angeblich finden könnte, sei in der Gegend jedenfalls wirklich nicht viel zu sehen. Es wären wohl eher unzählige Abstufungen von gelb, braun oder grau, denen man in Connemara begegne.
Die Aussage, dass diese karge und kahle Hochmoorlandschaft mit ihren Wollgräsern deswegen viel eher schottisch oder vielleicht sogar skandinavisch wirke, will er aber nicht unbedingt gelten lassen. Völlig einzigartig wäre das in Irland nun auch wieder nicht. Im County Mayo - traditionell als Armenhaus des Landes verschrien - würde es schließlich auch nicht anders aussehen.
Shane Martin liegt damit durchaus nicht verkehrt, wie die überall in den Statistiken nachzulesenden Zahlen zeigen. In seinem Heimatland sind wesentlich größere Areale von Mooren bedeckt als von Wäldern. Diese "Boglands" nehmen nämlich rund ein Sechstel der Landesfläche Irlands ein.
Auch wenn es nicht völlig einzigartig ist, gerne in Connemara ist er natürlich dennoch. Er läuft schließlich schon seinen vierten Marathon. Leider habe er zu spät mit diesem Sport angefangen, bekennt der Endvierziger, sonst könnten es bereits ein paar absolvierte Rennen auf dieser Strecke mehr sein.
Andererseits überlegt er jedoch, ob er im nächsten Jahr noch einmal wieder kommt. Denn weil ihm die Vorbereitung von Mal zu Mal schwerer fiele, habe er sich eigentlich vorgenommen, es in seiner "Karriere" mit insgesamt zwanzig Marathons bewenden zu lassen. Und achtzehn hat er jetzt schon hinter sich.
 |
 |
| Weit reicht der Blick auf den letzten Kilometern über die endlos wirkende Landstraße | |
Noch hat er mit dem welligen Profil des Kurses keine Probleme. Doch da er, wie er klagt, diesmal den Winter über ganz schlecht trainiert hat, ist ihm klar, dass er an den längeren und steileren Steigungen, die später noch kommen werden, wohl die eine oder andere Gehpause einlegen werden muss.
Die erste Bestätigung dafür, dass beim Connemara Marathon durchaus auch mit weniger moderaten Anstiegen als im Anfangsteil zu rechnen ist, gibt es in dem Moment, als der Kurs hinter dem zweiten Verpflegungspunkt bei sechs Meilen in einer ziemlich spitzen Einmündung wieder auf die N59 - diesmal auf ihren nördlichen Ausläufer - stößt.
Innerhalb nicht einmal eines Kilometers gilt es nämlich ungefähr vierzig Meter an Höhe zu gewinnen. Und zwar nicht etwa gleichmäßig sondern in zwei doch recht unangenehmen Stufen. Innerhalb kürzester Zeit überblickt man jedenfalls die Fläche, auf der man gerade noch unterwegs war, von einer deutlich höheren Warte.
Ein weiteres einsames Hotel hat sich an der Einmündung positioniert. Kylemore Pass Hotel nennt es sich, was angesichts einer Lage auf nicht einmal fünfzig Meter über dem Meeresspiegel und bei der breit gefächerten Bedeutung des englischen Wörtchens "pass" in diesem Fall weniger als "Gebirgsquerung" sondern als "Zufahrt" oder "Durchgang" zu verstehen ist. Wenige hundert Meter entfernt beginnt nämlich mit dem Lough Kylemore ein weiterer der unzähligen Seen Connemaras.
An seinem Ufer - genauer gesagt an seinem kleinen Bruder, dem Nebensee Lough Pollacappul - findet sich auch die Kylemore Abbey, eine der wenigen kulturellen Sehenswürdigkeiten in der ansonsten eher durch Naturschönheiten geprägten Region. In einem Mitte des neunzehnten Jahrhunderts von einem reichen Fabrikanten erbauten Schlösschen haben nun Benediktinerinnen eine Klosterschule eingerichtet. Hauptsächlich jedoch der von den Nonnen sorgfältig restaurierte viktorianische Garten zieht inzwischen die Touristen an.
Noch einige Kilometer weiter auf der N59 Richtung Westen stößt man im Dörfchen Letterfrack dann auf das Informationszentrum des Connemara Nationalparks, denn wenig überraschend hat man einen Teil dieser Landschaft unter den besonderen Schutz gestellt. Allerdings nur einen ziemlich kleinen Teil, der von der Ausdehnung her absolut nicht zu vergleichen ist mit seinen amerikanischen oder afrikanischen Gegenstücken.
Statt wie diese eine in die Tausende gehende Zahl von Quadratkilometern zu umfassen oder wie einige besonders große in der räumlichen Ausdehnung sogar deutsche Bundesländer zu übertreffen, kann er gerade einmal mit etwa knapp dreißig Einheiten dieses Flächenmaßes aufwarten. Und so urwüchsig die Landschaft, die man beim Marathon durchläuft, auch sein mag, den Nationalpark berührt man unterwegs überhaupt nicht. Dieser liegt auf der anderen, der westliche Seite der Twelve Bens.
Der inzwischen ganz ordentlich auf Höhe gekommene Marathonkurs führt an einer Kapelle vorbei, die mitten in der Landschaft die vorbeikommenden Autofahrer zu einer kurzen Pause mit geistiger Erbauung einlädt. Ihr moderner Baustil zeigt, dass sie keineswegs schon sehr lange hier steht, sondern erst in jüngerer Zeit erbaut wurde. Noch immer ist der katholische Glaube in Irland eben tief verwurzelt.
 |
 |
 |
| Connemara Marathon, das bedeutet endlose Weite ... | ... Moorlandschaften und kahle Berge ... | ... sowie unverkennbar echte Iren |
Längst haben sich weitere Ultraläufer unter die Marathonis gemischt. Auch Carol Morgan, die in 5:20:19 auf der Langstrecke mehr als zehn Minuten zwischen sich und die Konkurrenz legt, am Ende aber ziemlich kämpfen muss, und die noch auf Sichtkontakt laufende Valerie Glavin, die im letzten Drittel richtig einbrechen und nach 5:32:32 nur Dritte werden wird, haben sich schon bis in deren Mittelfeld vorgearbeitet. Die vorsichtiger anlaufende spätere Zweite Cleo Oliver (5:31:56) hat zumindest den Schwanz auch längst erreicht.
Dennoch ist die Unterscheidung zwischen den Teilnehmern der unterschiedlichen Wettkämpfe leicht. Nicht nur dass die Startnummern derjenigen, die eine volle Runde absolvieren mit einer "39" beginnen, sie sind vor allen Dingen auch gelb und werden nicht nur auf der Brust sondern zusätzlich auch noch auf dem Rücken getragen.
Aber auch die anderen Distanzen haben ihre ganz spezielle Farbenlehre. Die Männer beim Marathon haben ihre Ziffernfolgen nämlich auf dunkelgrünem Papier erhalten, bei den Frauen ist die Farbe orange. Auf der Halbdistanz lautet die Kombination blau und rosa. Zu erklären, was davon für den männlich und was für den weiblichen Teil des Feldes verwendet wird, erübrigt sich dann schon beinahe.
Für die nächsten Meilen bleibt der Kurs dabei erst einmal auf diesem Plateau, das sich sechzig bis achtzig Meter über den nun gar nicht mehr so weit entfernten Meeresspiegel erhebt. Eben ist es allerdings dennoch nicht. Kleinere Senken und die dazu gehörenden Gegenanstiege sorgen dafür, dass immer wieder einmal andere Muskelgruppen zum Einsatz kommen dürfen.
Gleich würde es jetzt aber erst einmal zwei Meilen am Stück bergab gehen, beruhigt Larry Rigney an der markantesten dieser Wellen die um ihn herum befindlichen Marathonis. Eine Aussage, auf die man sich eigentlich verlassen können sollte. Denn die Zahl der Läufe, die der freundliche grauhaarige Herr von den Tullamore Harriers auf dieser Strecke schon hinter sich hat, ist zweistellig.
Wie das geht, wenn doch gerade erst das zehnte Mal durch Connemara gerannt wird und Rigney zudem auch noch die Premiere verpasst hat? Nun, es gibt am Tag vor der eigentlichen Veranstaltung noch einen weiteren Marathon, mit dem ein bis zwei Dutzend der hartnäckigsten Sammler einen sogenannten "Doppeldecker" absolvieren.
Irgendwie ist das zwar dann doch eher eine private Sache unter Freunden. Allerdings kann man sich auf der Internetseite ganz offiziell für die deutlich begrenztere Menge von Startplätzen beim ziemlich sperrig benannten "Connemarathon Race Director Invitational Marathon" bewerben. Allerdings nur wenn man sich auch für ein Rennen am Sonntag angemeldet hat. Und die letzte Entscheidung liegt auf jeden Fall bei Rennchef Ray O'Connor.
Wer am Samstag vor dem Wettkampf durch Connemara fährt um sich die Strecke oder zumindest die Gegend anzusehen und dabei plötzlich Läufern mit Startnummern auf dem Bauch begegnet, muss also nicht gleich in Panik verfallen und glauben, den Termin verwechselt zu haben. Es ist nur das zweiundvierzig Kilometer lange Einladungsläufchen für die Freunde des Organisationsleiters.
 |
 |
 |
| Auch nach 63 (links und rechts) oder 42 (mitte) Kilometern kann man noch ziemlich gut gelaunt sein | ||
Tatsächlich beginnt die Straße sich wenig später zu senken. Und hinter einer lang gezogenen Rechtskurve taucht bald darauf auch der Killary Harbour ein Stück unterhalb der Marathonis auf. Es sind am Ende zwar nicht ganz zwei Meilen, wie von Rigney angekündigt hat. Aber gute zwei Kilometer kann man es zum tiefsten Punkt des Kurses tatsächlich erst einmal konstant rollen lassen.
Etwa bei Meile elf ist man am über ein Dutzend Kilometer langen, an manchen Stellen jedoch nur wenige hundert Meter breiten Fjord angekommen, der zwar bei weitem nicht so steil und spektakulär wirkt wie seine skandinavische Verwandtschaft aber wie diese auch mit etlichen Fischzuchtanlagen gespickt ist. Bis zur Halbzeitmarke wird man ohne weitere Höhenunterschiede an seinem Ufer entlang laufen.
Das ist endlich ein Gelände, wie es Barry O'Sullivan gefällt. Er stammt zwar aus der Gegend, er trägt sogar jenes weinrote Trikot des Athenry AC, das auch Ray O'Connor bei seinen Starts überzustreifen pflegt. Dennoch ist es sein erster Connemara Marathon. Zum Jubiläum sei er so direkt vor der Haustür jetzt doch endlich einmal fällig gewesen.
Ansonsten bevorzugt er aber doch eher flache Marathons. In Barcelona, in Wien und in Hamburg ist er schon gestartet. Den Tipp mit der Hansestadt habe er von deutschen Läufern bekommen, die ihm beim Chicago Marathon begegnet seien.
Keine schlechte Empfehlung wäre das gewesen, sowohl die Stadt wie auch das Publikum hätten ihm ziemlich gut gefallen. Aber für den Lauf in der österreichischen Hauptstadt hat er ebenfalls viel Lob übrig.
Ja, er gehe gerne "nach Europa" rutscht es ihm heraus, um im nächsten Moment am erstaunten Blick seines Gesprächspartners zu bemerken, was er da gerade gesagt hat. Nein, nein, natürlich sei Irland auch ein Teil von Europa, schiebt er nach. Doch diese von den irgendwie sehr an ihrer "splendid isolation" hängenden Briten übernommenen Redewendung sei eben auch auf ihrer Insel weit verbreitet, wenn es um das Festland gehe.
Die ersten Häuser von Leenaun oder Leenane - wieder mal gibt es da verschiedene Arten den alten irischen Ortsnamen An Líonán in eine pseudoenglische Form zu pressen - sind bereits passiert, als die Halbmarathonmarke auftaucht. Während die Marathonis also mitten in der Landschaft auf die Reise gegangen waren, dürfen die Kurzdistanzler in der einzigen echten Siedlung entlang der Strecke auf ihren Start warten.
Lange bevor diese mit ihrer Startaufstellung überhaupt begonnen haben, ist Freddy Keron Sittuk schon in Leenaun durchgekommen. Nach gerade einmal etwas über zweiundsiebzig Minuten löst der Kenianer die Chipmatte aus. Einsam ist er auf der Jagd nach der ausgelobten Prämie für eine neuen Streckenrekord. Die engsten Verfolger Brendan Gill und Padraig MacCriostail liegen zu diesem Zeitpunkt bereits ungefähr eine Meile zurück.
Die Führende bei den Marathonfrauen Fionnuala Doherty erreicht die Halbzeitmarke erst, als die zweitausendköpfige Meute der Halbmarathonis gerade auf die Strecke gegangen ist und muss sich nun durch das komplette, in diesem Fall wohl doch etwas dichtere Feld vor ihr hindurch arbeiten.
Auch die schnellsten Ultraläufer gehen noch vor den Kurzstrecklern auf ihr letztes Streckendrittel. Garrett Crossan hat sich inzwischen mehr als zwei Minuten von seinen Begleitern abgesetzt und wird sich den Erfolg nicht mehr nehmen lassen. Bei für dreiundsechzig Kilometer durchaus beachtlichen 4:22:17 werden ihn auch nicht mehr allzu viele Halbmarathonläufer unterwegs überholen.
 |
 |
| Die Gastspiele der Sonne sind nur kurz, auch zum Schluss liegen die Berggipfel meist in den Wolken | |
Während Martin Rea sich zwar noch etwas weiteren Rückstand einfangen, aber am Ende als Zweiter in 4:27:44 ordentlich durchkommen wird, bezahlt der in Leenaun noch vor ihm liegende Vasily Neumeritski für den Versuch an Crossan dran zu bleiben. Mick Rice, der von allen im Vorderfeld am gleichmäßigsten läuft und auch den schnellsten Schlussabschnitt abliefert, fängt ihn nämlich mit 4:29:05 zu 4:30:09 noch deutlich ab. Der ebenfalls lange in der Spitzengruppe liegende und Leenaun noch als Vierter passierende Piotr Zienkiewicz wird sogar auf Platz neunzehn durchgereicht.
Auch wenn Leenaun die größte Siedlung an der Laufstrecke darstellt, in dem lang gezogenen, zwischen Fjord und Berg hinein gepressten Straßendorf erwartet man dennoch besser nicht die großen Zuschauermassen, erreicht es doch vielleicht mit Mühe gerade einmal eine dreistellige Einwohnerzahl.
Wie groß Leenaun nun wirklich ist, wird nach der Auswertung der am Marathonsonntag stattfindenden Volkszählung dann wieder einmal feststehen. Für diesen alle fünf Jahre angesetzten "Census" werden alle - und zwar wirklich alle - an diesem Sonntag in Irland befindlichen Personen befragt. Und so wartet auch auf ausländische Lauftouristen im Hotel völlig überraschend ein Fragebogen, in dem man unter anderem nach Alter, Ausbildung und Beschäftigungssituation Auskunft geben soll.
Selbst ein Erläuterungsblatt in der jeweiligen Muttersprache ist beigelegt, in dem unter anderem die hohen Strafen herausgestellt sind, die fällig werden, wenn man gar nicht oder falsch antwortet. Was man mit der Information anfangen will, dass der sich ein verlängertes Wochenende auf der Insel befindende Besucher nun wirklich kein einziges Wort auf Gaeilge beherrscht, darf man sich allerdings auch fragen.
So klein Leenaun auch sein mag, ein Foto des eigentlichen Ortskernes mit der typischen bunten Häuserzeile inklusive Kneipe als allerbuntestes unter ihnen würde in jeden Bildband über die Grüne Insel passen. Und hier ist dann doch ein bisschen menschliches Publikum an der Strecke, in deutlich zweistelliger Zahl sogar. Nicht nur Einheimische sondern auch einige mitfahrende Angehörige aus dem Marathongefolge.
Die einzige nennenswerte Ortschaft ist schließlich auch einer der Eckpunkte des Kurses. Genau an der erwähnten Häuserfront mündet in die N59 jene R336 ein, die zurück nach Maam Cross führt. Und diese trägt an diesem Sonntag nicht nur die Hauptlast der Veranstaltung, denn alle Teilnehmer egal über welche Distanz sind ja auf ihr unterwegs. Sie ist aus diesem Grund für die Zeit des Rennens als einzige vollständig gesperrt.
Wer also als Begleiter noch einmal seine Läufer anfeuern will, hat in Leenaun eigentlich die vorerst letzte Möglichkeit dazu. Ganz so genau nimmt man es dann aber doch nicht. Auch auf den nächsten dreizehn Meilen ist die Strecke nicht vollkommen verkehrsfrei. Der vom Anfangsstau einmal abgesehen aber ohnehin schon ziemlich schwache Fahrzeugstrom, fällt noch einmal deutlich spärlicher aus.
Mit dem Abzweig endet allerdings auch der ebene Teil des Kurses. Direkt danach schlägt der Berg zurück. So wie es drei Meilen zuvor hinunter ging, führt die Straße nun wieder den Hang hinauf. Eigentlich macht sie das sogar noch ein wenig heftiger. Knapp hundert Höhenmeter gilt es in einem langen Anstieg innerhalb weniger als einer Meile zu bewältigen, in den steilsten Passagen sogar mit deutlich mehr als zehn Prozent.
An diesen Stellen fällt auch Eoin O'Beara einmal in den Gehschritt. Er stammt schließlich aus einer vollkommen ebenen Region nördlich von Dublin. "My highest hill is a motorway overpass", meint er flapsig zu seinen Trainingvoraussetzungen. Nun ja, ein wenig länger als eine Autobahnbrücke ist dieser Anstieg schon. Vor allem aber - und das ist das eigentlich erstaunliche - läuft er in Connemara seinen ersten Marathon überhaupt.
 |
 |
| Zumindest im Schlussabschnitt ist die Strecke einigermaßen
eben ... |
... so dass durchaus noch Kraft für einen kleinen Gruß an den Fotografen bleibt |
Warum er sich ausgerechnet diesen nicht gerade einfachen für seine Premiere ausgesucht hat, kann er gar nicht einmal genau sagen. Er hat es eben. Doch er stimmt zu, dass es inzwischen auch in Irland ein ziemlich breites Angebot und eine große Auswahl an Rennen geben würde. Auf die Bemerkung, dass Connemara nach Dublin ja immerhin der zweitälteste im Land sei, antwortet er aber sofort mit einem: "Und was ist mit Belfast?"
Hoppla, da ist der ausländische Besucher eindeutig auf politischem Glatteis gelandet. Denn so eindeutig wie auf dem Kontinent ziehen die Iren - und auch die Briten - ihre Grenzen keineswegs. Für die meisten Bewohner der Insel ist sie immer noch eine Einheit. Zwischen der Republik und Nordirland herrschen besondere, allerdings auch ziemlich verwirrende Beziehungen.
Dass eine Grenze ohne jegliche Kontrolle passiert werden kann, ist man dank Schengen auch als Mitteleuropäer ja inzwischen gewöhnt. Im skandinavischen Nordeuropa geht das ja schon seit einem halben Jahrhundert gut. Und die innerirische Grenze ist halt in der Regel als solche ebenfalls nur auf dem Papier existent. Was umgekehrt jedoch auch bedingt, dass Irland wegen der britischen Vorliebe für ihre bereits erwähnte "splendid isolation" auf absehbare Zeit seine Einreisekontrollen für den Rest der EU aufrecht erhalten muss.
Doch haben eben auch alle Nordiren jederzeit ein Anrecht auf einen irischen Pass. Umgekehrt werden auch irische Staatsbürger relativ problemlos zu Untertanen des Vereinigten Königreichs. Insbesondere Sportler können so völlig frei entscheiden, ob sie bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen unter dem Union Jack oder der irischen Flagge starten möchten.
Bei den Meisterschaften in den typisch irischen Sportarten Gaelic Football und Hurling treten wie selbstverständlich Teams aus den - nach einer Gebietsreform in Nordirland formal gar nicht mehr existierenden - sechs nordöstlichen Grafschaften mit an. Ja sogar Fußballsteams aus dem Norden ziehen die Ligen in der Republik vor.
Und im Rugby wird es endgültig seltsam. Da vertritt das Provinzteam von Ulster n tatsächlich neun Counties, nämlich sechs nordirische und drei aus der Republik, hat Anhänger und Spieler von beiden Seiten der Grenze und stößt so diesmal immerhin ins Viertelfinale des Heineken-Cups vor.
Und - noch viel verwirrender - sogar das Nationalteam vertritt nicht einen Staat sondern die ganze Insel bei internationalen Wettbewerben. Unter anderem auch gegen England, Schottland oder Wales. Statt Nationalflaggen weht für diese Mannschaft dann eine grüne Fahne mit einem Kleeblatt am Mast.
Konstellationen, wie sie in der Welt des Sports wohl ziemlich einzigartig sein dürften. Kein Wunder also und aus seiner Sicht auch vollkommen logisch, dass Eoin O'Beara die Frage nach dem Marathon in Belfast stellt. Dieser ist übrigens tatsächlich schon ziemlich alt und unangefochtener Rekordhalter auf der Insel.
Auch an der steilen Rampe, die aus Leenaun hinaus führt, stehen noch einige Häuser. Und davor stehen - und sitzen - auch einige Anwohner, um die Marathonis zu beklatschen. Von dort, wo die Bebauung dann langsam wirklich endet, schallt laute Musik. Zum ersten und einzigen Mal wird der Lauf auch mit Noten unterlegt.
Der dazu gehörende Anblick ist dann doch etwas seltsam. Im ersten Moment fühlt man sich vielleicht an die aus der Määnzer Fassenacht bekannten Schwellköpp erinnert. Im zweiten Moment lässt sich, wenn man sich ein wenig mit dem Thema auskennt, dann aber doch erahnen, dass die vier überlebensgroßen Gesichtsmasken wohl die Mitglieder der irischen Rockgruppe U2 darstellen sollen.
 |
 |
| Ein letzter Blick auf die Uhr ... | .... und es beginnt der Endspurt |
Ihre Träger versuchen sich mit ihren umgehängten echten Instrumenten ein wenig den Anschein zu geben, als spielten sie wirklich die Hits der Originale. Doch unverkennbar kommt die Musik vom Band, selbst wenn dieses heutzutage wohl eher aus einer CD besteht. Mit ständig geschlossenem Mund kann "Bono's Doppelganger" - dieses Wort hat, wenn auch ohne die Strichelchen des Umlautes, tatsächlich die Aufnahme in die englische Sprache geschafft - wohl kaum Gesang erzeugen.
Das Maam - natürlich gibt es auch hier wieder die Variante "Maum" - Valley ist vielleicht nicht wirklich ein Kontrastprogramm zu seinem westlichen Nachbarn. Doch einen etwas anderen Charakter als das Glen Inagh hat es, wie man bald merkt, schon. Nicht ganz so einsam, nicht ganz so karg, nicht ganz so rau ist es. Man befindet sich zwar noch im Westen, das Wörtchen "wild" wäre allerdings nun übertrieben.
Dafür wirkt das Tal stärker landwirtschaftlich geprägt. Als Joyce Country bezeichnet man diesen Teil Connemaras nach jener einst in ihm ansässigen Familie, die zu den mächtigsten der Region zählte. Immer wieder sieht man nun auch einmal einen Hof irgendwo im Gelände stehen, einige davon sogar direkt an der Straße.
Diese hat jedoch ihren welligen Verlauf aus dem Inagh-Tal reaktiviert. Allerdings mit nun doch etwas höheren Ausschlägen. Zumindest fühlt es sich subjektiv so an, was allerdings durchaus auch mit der inzwischen zurückgelegten Distanz zu tun haben könnte. Dafür hat es zwischenzeitlich die Sonne geschafft, sich einen Weg durch die Wolken zu bahnen.
Allerdings ist das ein Zustand, der nicht allzu lange anhält. Nur eine Viertelstunde später macht bereits leichter Nieselregen den Asphalt feucht. Der im Hinblick auf die wechselhafte Witterung immer wieder gern zitierte Spruch "wenn dir in Irland das Wetter nicht gefällt, warte eine Viertelstunde" findet zum x-ten Mal seine Bestätigung. Doch auch der Regen ist nicht von langer Dauer. Und am Ende kommen die Läufer fast unter den gleichen Bedingungen zum Ziel, bei denen sie auch gestartet sind.
Das Schild mit der Aufschrift "An Gaeltacht" am Straßenrand macht deutlich, dass man ab nun wieder im irischen Sprachgebiet unterwegs ist. Das abgelegene County Galway stellt eine der letzten Rückzugsregionen des Gaeilge dar. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist angeblich noch dieser Sprache mächtig. Und im Bereich des Gaeltacht dürften es sogar noch deutlich mehr sein. Auch die anderen dieser Gebiete liegen praktisch ausschließlich ganz im Westen des Landes auf Inseln oder Halbinseln direkt am Atlantik.
Ihre besondere Förderung durch den Staat ist ein ziemlich zweischneidiges Schwert. Sie sorgt zwar einerseits dafür, dass nicht noch mehr Menschen in die Städte abwandern, die Bevölkerung überaltert und die Landstriche endgültig veröden. Doch lockt sie auf der anderen Seite auch Zuzügler an, die des Irischen eigentlich nur bedingt mächtig sind.
Dass zusätzlich gerade wegen der kulturellen Besonderheiten auch noch eine Vielzahl von Touristen angelockt wird, mit denen man ebenfalls nur auf Englisch kommunizieren kann, ist ein weiterer unangenehmer Nebeneffekt. Wirklich dabei geholfen, das langsame Verschwinden des Irischen zu verhindern, haben diese Sonderregionen, die man in besonders kritischem Unterton fast schon als "Reservate" bezeichnen könnte, bisher jedenfalls nicht.
Das Schild mit der "18" hat man gerade hinter sich gebracht, befindet sich also in Kilometern gerechnet langsam in der Nähe der "30", da wartet der Kurs mit der nächsten kleinen Gemeinheit auf. Ein ziemlich steiler Hügel führt hinauf zu einem kleinen Wäldchen und zieht weitere Kraft aus den Beinen. Oben wartet nicht nur die erhoffte Verpflegungsstelle - die mit dem Elektrolytgetränk - sondern auch eine Kneipe, die allerdings ein Stück entfernt von der nächsten Ortschaft ein wenig schlecht positioniert wirkt.
 |
 |
| Erst direkt vor dem Ziel endet die Einsamkeit ... | ... dort warten schon fleißige Helfer auf die Läufer |
Nur eine Kurve später - die zwanzig bis dreißig Höhenmeter gehen im direkten Anschluss an den Aufstieg mindestens genauso steil verloren, wie sie erkämpft wurden - bringt eine Kirche eine mögliche Erklärung. Vielleicht nimmt man ja nicht nur "in Europa" sondern auch in Irland nach dem Kirchgang gerne noch einmal ein Bier zu sich.
Einundzwanzig Meilen hat man geschafft, als Maum, Maam oder eben An Mám - an die vielen Varianten hat man sich ja inzwischen längst gewöhnt - auftaucht, die letzte Zwischenstation vor dem Ziel. Eine wirkliche, eine zusammenhängende Ortschaft ist das aber eigentlich nicht, eher mehrere lose in der Landschaft verstreute einzelne Häusergruppen. An einer von ihnen teilt sich die Straße. Nach rechts führt dort der Kurs, auf einer Brücke über einen Bach.
"When you're in Maam, you can see Maam Cross", hatte Larry Rigney vorhin so schön versprochen. Es war wohl maximal bildlich gemeint. Das einzige, was man sehen kann, ist nämlich dass die Straße sich auf der anderen Seite des Maam Valley den Berg hinauf schraubt. Der flache Kilometer durch den Talboden hinüber ist nur noch ein kleiner Aufschub.
Noch einmal heißt es klettern, diesmal nun wirklich hinauf zum höchsten Punkt der Strecke. Kaum hundert Meter ist er hoch. Doch in der Summe aller Anstiege kommen beim Connemara Marathon wohl doch vier- bis fünfhundert Meter zusammen. Ein richtiger Berglauf ist er damit natürlich noch nicht, doch von einer Rekordpiste ist er eben mindestens genauso weit entfernt.
So muss man dann auch die Leistung von Freddy Sittuk wohl doch deutlich höher bewerten, als es die bloßen Zahlen aussagen. Denn selbst wenn der Ostafrikaner auf der zweiten allerdings eindeutig schwereren Hälfte noch ein wenig Zeit liegen lässt, erreicht er mit 2:27:48 ganz überlegen als Sieger das Ziel und verbessert die Streckenbestzeit deutlich. Seine Konkurrenten müssen sogar noch erheblich mehr Federn lassen.
Brendan Gill verliert volle zehn Minuten auf seine Durchgangzeit und läuft erst mit zwanzig Minuten Rückstand auf Sittuk nach 2:47:40 in Maam Cross ein. Dennoch kann er sich damit klar den zweiten Platz sichern. Padraig MacCriostail erwischt es nämlich noch wesentlich heftiger, indem er einer knappen 1:19 auf dem ersten Teil eine 1:35 für eine Endzeit von 2:54:17 folgen lässt. Keith Whyte, der sich das Rennen wesentlich besser einteilt und mit zwei fast gleichen Hälften durchkommt, verdrängt ihn deshalb mit einer 2:51:16 auch noch von Rang drei.
Während Freddy Sittuk von keinem Halbmarathonläufer mehr passiert wird und damit als Allererster an der Straßenkreuzung ankommt, müssen alle anderen Marathonis zumindest einen der Kurzstreckler vorbei lassen. Denn Sittuks kenianischer Landsmann Lezan Kimutai jagt mit der Streckenrekordprämie vor Augen in ebenfalls nicht gerade schlechten 1:11:16 durch die Weite des irischen Westens. Da spielen Thomas Kelly mit 1:19:31 und John MacEnri mit 1:21:40 auf den Plätzen zwei und drei eben doch in einer anderen Liga.
Regina Casey, die als Läuferin der Galway City Harriers praktisch ein Heimspiel hat, lässt als Frauensiegerin in 1:31:08 gerade einmal siebenundzwanzig Männern den Vortritt. Dahinter liefern die Läuferinnen mit dem nun wirklich ziemlich irischen Namen Orla Ni Mhuircheartaigh und die mit dem gleichen Vornamen ausgestattete Orla Gormley den knappsten Ausgang beim Kampf um die Treppchenplätze. Bei 1:34:01 und 1:34:17 trennen die beiden nämlich gerade einmal sechzehn Sekunden.
Auch die Marathonsiegerin Fionnuala Doherty tut sich wie ihr männlicher Gegenpart auf dem Weg durchs Maam Valley deutlich schwerer als im ersten Teil bis zur Zwischenzeitmatte in Leenaun. Doch selbst wenn sie dabei für ihre 3:11:47 neun Minuten drauf packt, ist ihr Erfolg vor Vanessa Fenton nur bedingt gefährdet. Denn ihre Verfolgerin ist zwar auf der zweiten Hälfte etwas schneller. Aber eben nur wenige Sekunden. Sie kann deshalb die Lücke nicht mehr schließen und bleibt bis zu ihrem Zieleinlauf nach 3:13:51 auf Rang zwei.
Fast noch unspektakulärer ist der Lauf der 3:17:20 benötigenden Rosemary Heneghan. Bei Halbzeit wird sie als Dritte registriert, und auch im Ziel ist sie Dritte. Einige Minuten Abstand hat sie nach vorne und noch viel mehr Minuten nach hinten. Es ist eine Platzierung, die wohl nie ernsthaft in Gefahr kommt.
"C'est dur" stöhnt Jean-Benoit Portier im Anstieg. "C'est vraiment dur". Seit einer Meile geht es - und manchmal auch der Franzose - ununterbrochen den Berg hinauf und noch immer ist die Kuppe nicht erreicht. Es ist vielleicht nicht ganz mit der Tour in seinem Heimatland vergleichbar, aber je weiter man nach oben kommt, umso mehr Leute stehen dann doch an der Straße, um den Marathonläufern über die letzte Schwierigkeit der Strecke zu helfen.
Der in leuchtendem Grün gekleidete Portier läuft ebenfalls seinen allerersten Marathon. Da ist es wenig erstaunlich, dass er diese Steigung am liebsten verfluchen würde. Doch hat er sich nicht alleine für Connemara entschieden, sondern ist mit einer kleinen Gruppe angereist, die schon vor dem Start mit ihren einheitlichen T-Shirts aufgefallen waren.
Doch sind die Grünen beileibe nicht die einzigen aus ihrem Heimatland im irischen Westen. Unterwegs begegnet man auch sonst immer wieder einmal einem Läufer mit den Farben bleu-blanc-rouge auf den Wangen oder auch den Waden. Auch auffallend viele Belgier tragen ihre Trikots durch die weite Landschaft.
Von den ebenfalls anwesenden und - zumindest wenn es sich dabei um Flamen und nicht um Wallonen handelt - einen ähnlichen Dialekt sprechenden Niederländern kann man sie durch deren Bekleidung in Oranje unterscheiden. Und natürlich hört man auch den einen oder anderen deutschen Gesprächsfetzen. Ja selbst aus dem fernen Kalifornien sind Teilnehmer am Start.
Selbst wenn man die natürlich in relativ großer Zahl anwesenden Briten außen vor lässt, sind für einen Marathon dieser Größenordnung wirklich ziemlich viele ausländische Gäste am Start. Der touristische Faktor schlägt in Connemara wohl tatsächlich stark zu Buche. Angeblich stammen fast neunzig Prozent der Teilnehmer nicht aus dem County Galway.
Bei Meile vierundzwanzig lässt sich Maam Cross dann endlich in der Ferne erkennen. Denn die Straße ist auf der Passhöhe angekommen und erlaubt einen Blick in beide Richtungen. Die Landschaft hat nun an der höchsten Stelle des Kurses wieder jenen rauen und einsamen Charakter angenommen, den sie für die Marathonis - und auch die Ultraläufer - in der Anfangsphase hatte. Und sie wird ihn bis zum Ziel auch behalten.
Eine Meile fällt die Straße hinunter in jene weite Ebene, in der dann die letzte Meile zu absolvieren ist. Noch wenige hundert Meter vor dem Ziel ist da nicht viel mehr als das sich durch die Landschaft windende Asphaltband. Hindurch zwischen Felsen, Gräben und kleine Seen, vorbei an Wollgräsern und Ginsterbüschen.
Auch der Zieleinlauf selbst ist keineswegs triumphal, selbst wenn der Applaus der Zuschauer auf den letzten Metern dann doch ein wenig zunimmt. Pflichtgemäß begrüßt der Sprecher jeden der Einlaufenden mit Namen. Doch in jene überdrehten Jubelarien, die man anderswo durchaus schon einmal zu hören bekommen kann, bricht er dabei nicht aus.
Und auch die Einlaufenden drücken viel häufiger einfach nur ihre Stoppuhr ab als - wie bei Stadtmarathons häufig zu beobachten - in Siegerpose die Arme nach oben zu reißen. In Connemara geht es eben definitiv nicht darum gesehen zu werden. Bei diesem Marathon ist eher nüchterne Sachlichkeit angesagt. Wer unbedingt feiern will, der kann das schließlich noch auf der abschließenden Jubiläumsparty tun.
Denn eigentlich geht es beim Connemara Marathon um etwas anderes. Man wendet sich an eine völlig andere Klientel. Eine, die lieber in der Natur als im Trubel eine Stadt unterwegs ist. Eine, für die der Weg vielleicht tatsächlich noch das Ziel ist. Eine, die sich mit der Einsamkeit und Weite unterwegs überhaupt nicht schwer tut. Jener Einsamkeit und Weite, die Connemara, die Irlands wilden Westen so auszeichnet.
 |
Bericht und Fotos von Ralf Klink Ergebnisse und Infos www.connemarathon.com Zurück zu REISEN + LAUFEN – aktuell im LaufReport HIER |
 |
© copyright
Die Verwertung von Texten und Fotos, insbesondere durch Vervielfältigung
oder Verbreitung auch in elektronischer Form, ist ohne Zustimmung der LaufReport.de
Redaktion (Adresse im IMPRESSUM)
unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes
ergibt.